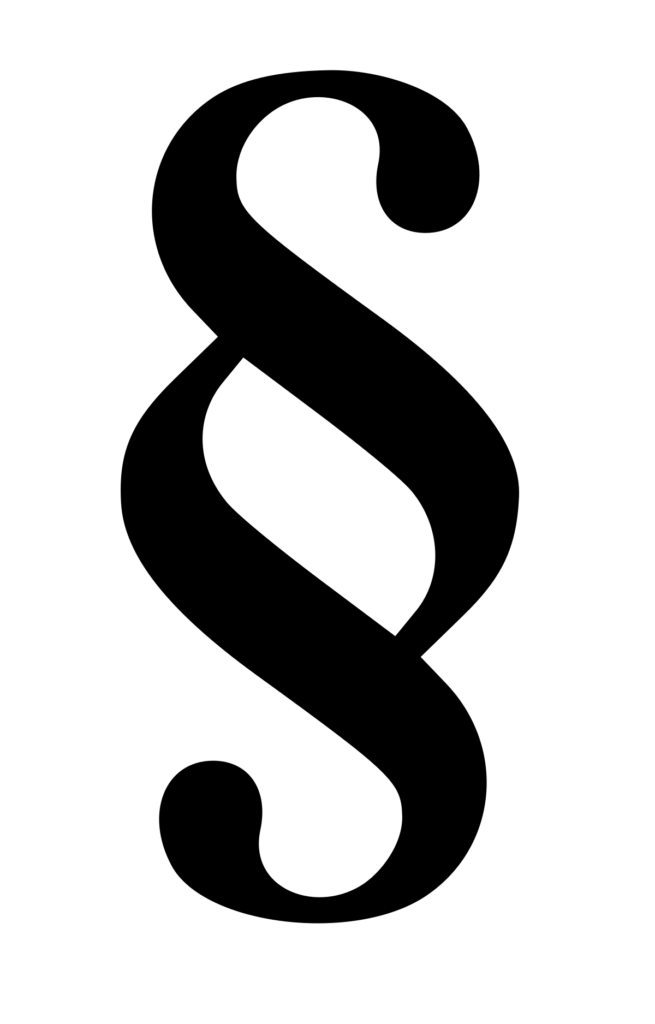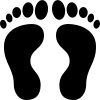Silbern glänzt der Luapula

87.578 Wörter, 463 Minuten Lesezeit
!!! ca. alle 10.000 Zeichen gibt es ein neues Kapitel als Lesemarke, hier kannst du problemlos pausieren und später weiterlesen!!!
Vorab: Die Geschichte spielt im Zeitraum 1976/77 und es handelt sich nicht um eine Fetisch-Geschichte
Kapitel 1
Freitag, 26. Mai, 19.50 Uhr
Im Studio 4 des Funkhauses leuchtete das Rotlicht auf und der soeben gespielte Titel klang langsam aus. Meine Radiosendung, die für junge Leute zugeschnitten war, neigte sich dem Ende zu. Ich rückte meinen Kopfhörer zurecht und näherte mich dem Mikrofon. „Bevor es gleich mit Monika weitergeht, möchte ich mich von Euch verabschieden. Es ist heute meine letzte Sendung und ich bedanke mich bei allen, die mir im letzten Jahr zugehört haben. Bleibt dem Sender und meinen Kollegen gewogen. Vielleicht hören wir uns im nächsten Jahr wieder. Bis dahin erfülle ich mir meinen Traum und mache eine Reise quer durch Afrika. Ich sage tschüs und bye-bye Euer Micha.“
Bei den letzten Worten lief ein Titel an, den ich mir extra für diesen Moment ausgesucht hatte. Es war `Sailing` von Rod Steward.
Als das Rotlicht erloschen war, kam Monika, eine sehr nette Kollegin mit wunderschönen rotbraunen Haaren ins Studio und umarmte mich. „Schade, dass ich keinen Sekt mittrinken kann“, sagte sie mit bedauernder Mine.
„Ich lass Dir was übrig“, bot ich ihr an.
Nach einem kurzen Gespräch verabschiedete ich mich mit einem angedeuteten Kuss auf ihre Wange und wurde im Flur von den anderen Kollegen, Redakteuren und Technikern mit einer Flasche Sekt erwartet, um auf meinen Abschied anzustoßen. Es war ein junges Team. Alle zwischen zwanzig und sechsundzwanzig. Ich war mit neunzehn Jahren der jüngste aber ich hatte den Job auch nur nebenbei und immer nur freitags gemacht.
Es war immer toll im Sender zu arbeiten, um neben der Schule, die ich nun nach dem Abitur beendet hatte, das Geld für meine Reise zu verdienen.
Was alle meine Freunde kannten war mein Hobby, das Fliegen und auch meine Liebe zu Afrika. Bereits seit meinem zwölften Lebensjahr hatte mich dieser geheimnisvolle Kontinent fasziniert. In allen Büchereien der Umgebung hatte ich mir im Laufe der Jahre Bücher über Afrika ausgeliehen und je mehr ich erfahren konnte, umso größer wurde mein Wunsch einmal dorthin zu reisen um es selbst sehen und erleben zu können.
Jetzt nach meinem Abitur war es soweit. Mein Studium sollte noch ein Jahr warten und für diese Reise hatte ich mir sechs Monate Zeit eingeplant.
Nach dem kleinen Umtrunk verließ ich das Funkhaus, wo mich mein bester Freund und Fliegerkollege Patrick mit dem Auto abholte. Ich hatte zwar einen Führerschein aber für ein eigenes Auto hatte ich noch kein Geld übrig.
„Schade, dass ich Dich jetzt nicht mehr im Radio hören kann“, sagte Patrick, als ich eingestiegen war.
„Ich finde es schade, dass Du nicht mit mir kommst“, entgegnete ich.
Patrick würde mir fehlen, das wusste ich. Wir waren von Kind auf dicke Freunde und hatten fast alles zusammen gemacht. Sogar unsere Leidenschaft zum Fliegen hatten wir gemeinsam entdeckt und mit 15 Jahren begonnen, den Segelflugschein zu machen. Inzwischen hatten wir den Pilotenschein für Motorflugzeuge und nutzten jede Gelegenheit zum Fliegen.
Patrick hatte sich bei der Luftwaffe als Zeitsoldat beworben, weil er Jet-Pilot werden wollte. Im August würde er in die Kaserne ziehen und deshalb sollten sich unsere Wege nun trennen.
An diesem Abend fuhren wir in unser Heimatdorf, um mit Freunden und Fliegerkollegen meinen Abschied zu feiern. Es war ein schöner Abend, bei dem mich die Dorfjugend ein wenig beneidete und einige meinen Mut bewunderten, allein in die `Wildnis` zu reisen, wie sie es nannten.
An den nächsten beiden Tagen traf ich meine letzten Vorbereitungen und überprüfte sorgfältig ob ich alles eingepackt und richtig verstaut hatte. Es war gar nicht so leicht für ein halbes Jahr zu packen und es trotzdem tragen zu können. Es ging also nicht um die Menge der Kleidung, sondern darum das richtige dabei zu haben und unterwegs mal waschen zu können.
Meine Mutter versuchte mir ständig gute Ratschläge zu geben und nervte mich ziemlich damit. Es war nicht einfach gewesen meine Eltern von meinen Reiseplänen zu überzeugen aber irgendwann hatten sie sich damit abgefunden und hofften, dass alles gut gehen würde.
In der Nacht zum Sonntag konnte ich vor Aufregung kaum schlafen. Nach dem Frühstück kam mein bester Freund Patrick, um mich abzuholen. Es war für ihn Ehrensache, mich mit dem viersitzigen Vereinsflugzeug zum Flughafen Köln-Bonn zu fliegen, wo meine eigentliche Reise begann.
Meine beiden jüngeren Brüder begleiteten uns bis dahin.
Nach einer rührseligen Verabschiedung von meinen Eltern unter vielen Tränen meiner Mutter ging es los und Patrick fuhr zu unserem kleinen Flugplatz wo ich mich auch von meinen Vereinskollegen verabschiedete, die dort das Wochenende verbrachten. Patrick und ich hatten ausgemacht, dass ich bis Köln-Bonn und er die Maschine zurückfliegen würde. Meine beiden Brüder saßen hinten, als ich kurz nach dem Start eine Ehrenrunde über unserem Haus drehte, um dann eine halbe Stunde später auf dem großen Flughafen in Köln-Bonn zu landen.
Eine Bekannte, die in einem Reisebüro arbeitete, hatte als preiswerteste Möglichkeit eine Flugroute von Köln-Bonn über Budapest nach Lusaka in Sambia herausgefunden.
Als der Flug aufgerufen wurde, und ich mich von meinen Brüdern verabschiedet hatte, umarmte mich Patrick und klopfte mir auf die Schulter. „Pass auf Dich auf“, sagte er, zog einen ganz kleinen Teddybär aus seiner Jackentasche und legte ihn in meine Hand. „Falls Du mal keinen hast, mit dem Du reden kannst.“
Bevor mir eine Träne über das Gesicht laufen konnte, drückte ich ihm die Hand und ging durch die Kontrolle.
Als ich im Flugzeug nach dem Start einen Kaffee bekam, atmete ich tief durch. Von allen Abschiedsszenen hatte mich der Teddybär von Patrick am tiefsten gerührt. Ich zog ihn aus der Tasche und betrachtete ihn. Patrick war wirklich der beste meiner Freunde. Einer mit dem ich über alles reden konnte und einzige der wusste, dass ich meinen Teddy aus der Kinderzeit noch immer hütete und ihn wegen seiner Größe wohl nicht dabei haben könnte. Ihm hatte ich auch schon mit siebzehn etwas anvertraut, was ich als sehr persönlich verstand und vor allen anderen verbarg.
Nach einem zweistündigen Aufenthalt in Budapest ging es mit einer Zwischenlandung in Addis Abeba weiter nach Lusaka. Als ich aus dem Flugzeug stieg, war es schon dunkel. Die Zoll- und Einreisekontrolle dauerte eine Weile. Ich hatte meine Papiere und mein Bargeld, das ich in amerikanische Dollar getauscht hatte, gut auf einen Brustbeutel, eine Brieftasche und ein Portemonnaie verteilt, um nicht alles zu verlieren, falls mir etwas gestohlen würde. Fünfhundert Dollar hatte mir meine Mutter außerdem als eiserne Reserve in den oberen Saum meiner Jeans eingenäht.
Am Flughafen erkundigte ich mich nach einer Übernachtungsmöglichkeit und nahm mir ein Taxi in die Stadt. Da in Sambia überwiegend englisch gesprochen wird, hatte ich keine Probleme.
Nach drei Tagen hatte ich von Lusaka genug gesehen und bestieg einen Zug nach Livingstone, um die berühmten Victoria-Fälle zu besuchen.
Dort traf ich auch viele Touristen aus Europa und war überwältigt von dem Naturschauspiel, wo sich der Sambesi in großer Breite atemberaubend in die Tiefe stürzt.
Am gleichen Abend saß ich in einem kleinen Restaurant. Etwas später kam großer schlanker Typ und fragte, ob er sich an meinen Tisch setzen dürfe. Er hieß Marc, war 25 Jahre alt und Student der Naturwissenschaften in Oxford. Er sah nicht schlecht aus, hatte aber etwas typisch Britisches in seinen Gesichtszügen. Wir unterhielten uns gut und sprachen über unsere weiteren Pläne. Er hatte vor, eine Fotosafari im Kafue-Nationalpark zu machen, der sich etwa 200 Kilometer nördlich von hier befand. Da ich auch nicht abgeneigt war, diesen Nationalpark zu besuchen, beschlossen wir bis dorthin gemeinsam zu reisen. Am übernächsten Tag gab es einen Zug von Livingstone nach Kataba, in dem wir die einzigen Touristen waren und entsprechend neugierig von den einheimischen Mitreisenden beobachtet wurden. Ich war ganz froh, nicht ohne Begleitung in diesem Zug zu sitzen und unterhielt mich angeregt mit Marc, wenn wir nicht gerade die vorbeiziehende Landschaft betrachteten.
Kataba war ein kleiner Ort, in dem wir Übernachtungsmöglichkeit in einer Missionsstation fanden. Von dort ging es am nächsten Tag mit einem uralten klapprigen Bus auf einer staubige Piste über Kaoma nach Chunga, wo sich die Verwaltung und einige Hütten des Nationalparks befanden.
Nach der Strapaze der achtstündigen Busfahrt in Hitze und Staub war ich froh eine kalte Dusche, ein bescheidenes Bett und Verpflegung in einer Safarihütte zu finden.
Die täglich angebotenen Ausflüge mit Geländewagen der Wildhüter waren sehr beeindruckend. Auch die Abende mit gebratenem Fleisch am offenen Lagerfeuer fand ich toll und romantisch. Nach drei Tagen verabschiedete ich mich von Marc und bestieg einen Bus nach Lusaka, der ausschließlich für Besucher des Parks verkehrte.
Da ich Lusaka schon kannte, beschloss ich mit dem Zug in nördliche Richtung nach Zaire zu fahren, denn ich wusste, dass es eine Bahnverbindung durch den Süden Zaires bis an die Westküste Angolas gab. Vorher machte ich aber in der kleinen Stadt Kabwe Station, um mir die kleinen, ebenfalls sehr imposanten aber bei weitem nicht so bekannten Lusemfwa-Wasserfälle anzuschauen.
Bei der Fahrt mit dem Zug auf der für mich ungewöhnlich schmalen 1.097 Millimeter Spur, war ich fasziniert von den mächtigen Dampfloks, die wegen ihrer vierachsigen Drehgestelle nach ihrem Erfinder `Garret` genannt wurden. In meiner Heimat waren die Dampflokomotiven bereits von modernen Diesel- und Elektrolokomotiven abgelöst worden, was ich sehr bedauerte. Da die Züge aus Sambia bereits vor der Grenze in Ndola endeten, musste ich dort einen Tag verbringen. In diesem Grenzbereich zu Zaire befindet sich das größte Abbaugebiet für Kupfer der Erde. Entsprechend sah es dort aus. Abraumhalten und Fördertürme beherrschten das Bild und ich war froh, dass ich gleich am nächsten Tag einen Zug nach Lubumbashi in Zaire bekam.
Lubumbashi ist die zweitgrößte und wirtschaftlich bedeutendste Stadt in Zaire. Sie ist das Zentrum des Kupfer- Zink- und Manganabbaus in Zaire und gleichzeitig die Hauptstadt der Provinz Shaba, die sich nach einem Militärputsch, bei dem Mobutu die Präsidentschaft errang, von Zaire abspalten wollte. Als Zaire noch „Belgisch-Kongo“ hieß, trug die Provinz Shaba den Namen „Katanga“ und Lubumbashi hieß „Elisabethsville“.
In Lubumbashi spürte man sehr deutlich den Einfluss der Belgier, die bis 1960 offizielle Kolonialmacht waren. Was mir Probleme machte, war die Tatsache, dass hier fast ausschließlich französisch gesprochen wurde, was ich leider nicht gelernt hatte, weil in meinem Gymnasium als zweite Fremdsprache nur Latein auf dem Stundenplan gestanden hatte. Nur vereinzelt fand man Menschen und Geschäfte amerikanischer oder britischer Herkunft.
Lubumbashi war eine Industriestadt mit ärmlichen Randgebieten. Nachdem ich mich in der Stadt umgesehen hatte, beschloss ich am nächsten Tag zum Flughafen zu fahren. Ich wollte mich erkundigen, ob es für einen Piloten wie mich eine Gelegenheit gab hier zu fliegen.
Der Flughafen war von der Fläche her ziemlich groß aber es standen nur sehr wenige Flugzeuge auf den Vorfeldern. Im bescheidenen Abfertigungsgebäude war es leer, denn es gab nur zwei Passagierflüge nach Kinshasa pro Tag.
Nach einigem Suchen fand ich einen einheimischen Flughafenangestellten, der ein paar Worte Englisch verstand. Als ich ihm erklärte was ich wollte, schickte er mich temperamentvoll gestikulierend zu einer Baracke am anderen Ende des Vorfeldes. Ich ging an einem rostigen Zaun entlang und fand in der Nähe der beschriebenen Baracke ein Tor. Es war offen. Nachdem ich das Tor passiert hatte, konnte ich hinter den Gebäuden eine kleine Frachtmaschine aber keine Leute entdecken. Ich ging vorsichtig weiter und hielt Ausschau, ob ich irgendwo jemanden finden konnte.
Eine ganze Weile passierte nichts aber dann kam plötzlich ein Militärfahrzeug um die Ecke und bremste scharf ab. Blitzschnell sprangen drei Soldaten heraus und richteten ihre Gewehre auf mich. Trotz meines Schrecks nahm ich instinktiv die Arme hoch und blieb still stehen.
Einer der Soldaten rief mir etwas zu aber ich verstand ihn nicht. Dann kam er mir vorgehaltener Waffe auf mich zu, packte mich am Arm und schob mich unsanft gegen das Fahrzeug, um mich anschließend abzutasten. Als er keine Waffe oder sonstigen Gegenstände bei mir feststellen konnte, fragte er etwas und ich versuchte deutlich zu machen, dass ich seine Sprache nicht verstand. Ich versuchte es mit englisch aber ohne Erfolg. Etwas ratlos zerrten sie mich in das Fahrzeug und brachten mich in ein entferntes Gebäude, welches sich als eine Art Polizei- oder Militärwache darstellte.
Mir war angesichts der Tatsache, dass ich mich nicht verständigen konnte, ziemlich mulmig zumute. Als weitere Fragen auch zu nichts führten, wurde ich von zwei Soldaten in einen Nebenraum geführt und bis auf die nackte Haut durchsucht. Es war eine ziemlich rüde und demütigende Behandlung aber ich zwang mich ruhig zu bleiben und nicht die Beherrschung zu verlieren. Als sie fertig waren, gaben sie mir meine Kleidung zurück und behielten meinen Brustbeutel mit meinem Ausweis und mein Portemonnaie, in dem 150 Dollar steckten.
Einer verließ damit den Raum und der andere blieb zu meiner Bewachung zurück. Ich zog mich wieder an und hatte keine Ahnung was jetzt passieren würde. Kurze Zeit später kam der zweite ohne Portemonnaie und Brustbeutel zurück, packte mich ziemlich unsanft und brachte mich am Ende eines Ganges in eine kleine schäbige Gefängniszelle mit einer Tür aus Gitterstäben, in der sich nur eine schmale Holzpritsche befand. Als er das Gitter verschloss bekam ich panische Angst und mir wurde klar, dass ich einen großen Fehler gemacht hatte, in dem ich auf eigene Faust den Flughafen- und vielleicht sogar einen verbotenen Militärbereich betreten hatte.
Nachdem ich etwa zwei Stunden wie ein Häufchen Elend mit dem Rücken zur Wand auf dem Boden gesessen hatte, wurde das Gitter geöffnet und einer der Soldaten führte mich in ein Büro. Da saß jetzt ein älterer Soldat mit höheren Rangabzeichen und bedeutete mir, mich auf einen Stuhl zu setzen. Er konnte ein paar Worte Englisch und stellte mir einige abgehackte Fragen, die ich so gut es ging beantwortete. Ich versuchte ihm klarzumachen, dass ich Tourist sei und nur fragen wollte, ob es eine Möglichkeit zum Fliegen gäbe. Ich merkte aber bald, dass er den Grund für mein Hier sein nicht verstand oder nicht verstehen wollte. Er gab mir aber zu verstehen, dass er versuchen würde morgen einen Dolmetscher zu finden und ließ mich wieder in die Zelle bringen.
Ich fühlte mich total hilflos und setzte meine einzige Hoffnung darauf, dass morgen tatsächlich ein Dolmetscher kommen würde, um die Sache aufklären zu können.
Am Abend brachte mir der jüngere und freundlichere Soldat einen Becher Tee und ein Stück Fladenbrot. Es war schlecht zu schätzen aber er war wohl kaum älter als ich. Ich bedankte mich für die Verpflegung. Er muss wohl meine Angst gespürt haben, denn er sagte irgendetwas zu mir und unterstrich es mit einer beruhigenden Geste.
Die folgende Nacht wurde die längste meines bisherigen Lebens. Immer wieder wurde ich wach weil ich mich fragte was passieren würde, wenn kein Dolmetscher kommen oder man mich nicht wieder laufen lassen würde.
Als es endlich hell geworden war, brachte mir ein anderer Soldat wieder einen Becher Tee und Fladenbrot. Ansonsten tat sich aber nichts und das zehrte an meinen Nerven. Erst gegen Mittag wurde ich in das Büro gebracht.
Dort saß nun außer dem Kommandanten ein junger Schwarzer in Zivilkleidung. Als man ihm sagte worum es gehe, begrüßte er mich in englischer Sprache und ich war sehr erleichtert. Es gestaltete sich ziemlich zeitraubend wenn er mir die Fragen übersetzte und meine Antworten zurückübersetzen musste. Manche Fragen wurden mehrfach oder in anderem Zusammenhang gestellt aber ich konnte offensichtlich klarstellen, dass ich kein Spion und kein Dieb, sondern nur ein Tourist war, der einen Pilotenschein hatte.
Nach zwei Stunden Verhör war es endlich vorbei. Ich durfte gehen und bekam meine Sachen zurück.
Mit dem Militärfahrzeug brachten sie den Dolmetscher und mich zum Abfertigungsgebäude. Dabei erfuhr ich, dass der Dolmetscher Kintu hieß und bei der Flugabfertigung arbeitete. Er war sehr freundlich und sprach zu meinem Glück ein sehr gutes Englisch.
„Wenn Du als Pilot arbeiten willst, wüsste ich vielleicht eine Möglichkeit“, sagte Kintu nachdem wir ausgestiegen waren.
„Ja wirklich?“ gab ich mich interessiert.
„Ich kenne Leute von einer amerikanischen Firma in der Gegend. Die suchen einen Piloten. Wenn Du willst frage ich mal. Die Maschine kommt morgen.“
„Ja gern“, sagte ich.
„Okay dann komme morgen Nachmittag zu mir. Ich bin da drin.“ Kintu deutete auf das Abfertigungsgebäude und lachte in Anspielung auf die anderen Gebäude, die mir beinahe zum Verhängnis geworden wären.
Ich bedankte mich und machte mich auf den Weg zurück in die Stadt. Ich war ziemlich erschöpft als ich in der kleinen Pension ankam. Ich besorgte mir etwas zu essen und wollte erst einmal schlafen. Erst jetzt bemerkte ich, dass die 150 Dollar aus meinem Portemonnaie verschwunden waren. Einer der Soldaten musste sie wohl an sich genommen haben aber das war nun nicht mehr zu ändern. Ich war nur froh, dass ich nicht mehr in der Zelle saß und wenn das klappte, was Kintu angedeutet hatte, hätte die ganze Aktion schließlich auch was gebracht.
Am nächsten Nachmittag marschierte ich wie vereinbart zum Flughafen. Ich fand Kintu und er sagte mir, ich solle in der Abflughalle warten. Die Amerikaner würden vor ihrem Abflug zu ihm kommen.
Ich saß vielleicht eine halbe Stunde in der Wartehalle, als zwei Männer hereinkamen und zu den Büros gingen. Sie trugen dunkelblaue Overalls wie ich sie von Piloten der US-Airforce kannte. Einer von ihnen war noch ziemlich jung und schaute mich im Vorbeigehen interessiert an. Ich registrierte das mit einem Lächeln, denn der Typ war alles andere als hässlich.
Es dauerte nicht lange, bis Kintu mit genau den beiden zu mir kam.
„Das ist Micha, der junge Mann, den ich gestern aus dem Gefängnis geholt habe“, erklärte er den beiden.
Der jüngere war einen halben Kopf größer als ich, was so um die zwei Meter bedeutete und hatte eine sportlich muskulöse Figur. Seine kurzen Haare waren mittelblond. Ich schätzte sein Alter auf Anfang zwanzig. Er schaute mich wieder an und setzte ein freundliches Lächeln auf.
„Du bist der Typ der einen Job als Pilot sucht?“ fragte er.
„Ja“, antwortete ich. „Für ein paar Wochen vielleicht. Ich möchte Afrika kennen lernen und ich bin Pilot.“
„Das ist ja großartig. Ich heiße Norman und das ist im Moment unser einziger Pilot Steve.“
Steve, den ich auf etwa 35 Jahre schätzte, war etwas kleiner als Norman aber ein drahtiger Typ, der mich sehr kritisch betrachtete.
„Der Pimpf ist ja noch nicht trocken hinter den Ohren und den willst du auf unsere Maschinen lassen?“ sagte er in einen sehr missbilligenden Ton.
„Entweder kann er fliegen oder nicht. Außerdem bin ich ja dabei wenn Du darauf hinaus willst, dass er sich hier nicht auskennt, “ entgegnete Norman.
„Ich finde er ist viel zu jung und unerfahren.“
„Lass das meine Sorge sein. Wenn er die Maschine fliegen kann, brauchst du ihm nur die Strecken zu zeigen. Um alles andere kümmere ich mich, “ konterte Norman.
Damit war die Diskussion beendet und Norman wandte sich wieder mir zu.
„Unser Camp ist in Kabunda, etwa zwei Flugstunden von hier. Kannst Du gleich mitkommen?“ wollte Norman von mir wissen.
Ich war nicht darauf gefasst, dass es so schnell gehen würde aber warum eigentlich nicht.
„Ja okay aber ich habe meine Sachen in einer Pension in der Stadt und muss noch bezahlen“, erklärte ich.
„Kein Problem“, meinte Norman. „Ich fahre schnell mit Dir hin“, und fügte an Steve gerichtet hinzu: „Kümmerst Du dich um das Einladen? Ich bin bald wieder zurück.“
Ohne auf eine Antwort zu warten ging Norman mit mir hinaus und ließ mich in einen Geländewagen einsteigen. Während der Fahrt fragte er mich wie es mir im Gefängnis ergangen sei. Als ich es ihm erzählt hatte, meinte er: „Glück gehabt. Das geht hier nicht immer so gut aus.“
Ich bezahlte rasch meine Übernachtungen und kam mit meinem Rucksack zurück.
Norman freute sich, dass ich für sie fliegen wollte und ich fand ihn sehr nett. Er konnte nur nicht verstehen, warum ich als junger Deutscher ganz allein durch Afrika reiste.
„Wenn Du willst, erkläre ich es Dir bei Gelegenheit“, bot ich an.
Als wir am Flughafen ankamen, stellte er den Wagen ab und ging mit mir zum Flugzeug. Es war eine DO 27, ein einmotoriger Schulterdecker, der für Kurierflüge auf kleinen unbefestigten Landebahnen gut geeignet ist. Ich kannte diesen Flugzeugtyp. Ich hatte damit schon viele Flüge gemacht, um Fallschirmspringer abzusetzen. Der Laderaum war gut gefüllt und es kostete einige Mühe meinen Rucksack noch unterzubringen.
Steve hatte bereits gewartet. Er wies mir den linken Pilotensitz zu. „Na los Kleiner dann zeige uns mal ob Du fliegen kannst.“ Sein Ton verriet, dass er jetzt einen Triumph erwartete.
Ich stieg ein, schaute beim Anschnallen kurz über die Instrumente, überprüfte die Türen und ließ den Motor an. Steve erledigte den Sprechfunkverkehr und so waren wir bald in der Luft. Ich flog den Kurs und die Höhe, die Steve mir angab und schaute auf die weite Landschaft, die mit einzelnen Baumgruppen und gelblich schimmernden Gras- oder Steppenflächen unter uns lag. Die Maschine lag wie ein Brett in der Luft und dank der guten Trimmung ließ sie sich mit zwei Fingern am Steuerknüppel fliegen. Nach 90 Minuten Flugzeit wurden die bewaldeten Flächen dichter und bald darauf erklärte mir Steve wie ich die kleine Landebahn von Kabunda finden konnte. Ein kleiner Fluss war die Auffanglinie. Jetzt eine Rechtskurve und die Landebahn lag nach einer weiteren Linkskurve mitten im Wald vor uns.
Ich schätzte die Höhe und teilte die Landung ein. Die Maschine setzte ziemlich sachte am Anfang der Graspiste auf.
“Okay starte durch, “ rief Steve. Ich erschrak, weil ich damit gerechnet hatte aber ich tat es und als wir wieder in der Luft waren, verlangte er von mir weitere sechs Landungen aus verschiedenen Richtungen und Höhen. Beim letzten Anflug zog er das Gas heraus und verlangte eine präzise Landung ohne Motorhilfe.
Als ich auch das geschafft hatte, war er ziemlich kurz angebunden. Ich spürte, dass es ihm nicht passte. Ich konnte offensichtlich besser mit dem Flugzeug umgehen als ihm lieb war. Ich tat deshalb ganz bescheiden und half beim Ausladen der Sachen.
Norman legte bei nächster Gelegenheit seinen Arm auf meine Schulter und sagte: „Willkommen in Kabunda.“
So, dass Steve es nicht hören konnte, fügte er hinzu: „Das mit dem Flug hast Du super gemacht.“
Das machte mich ein bisschen stolz.
Wir standen vor einem hölzernen Hangar. Ein älterer stämmiger, grauhaariger Mann mit gegerbtem Gesicht kam heraus und Norman stellte ihn mir vor. „Das ist Sam unsere gute Seele. Er sorgt dafür, dass unsere Flugzeuge immer okay sind. Sam, das ist Micha. Er ist für die nächste Zeit unser neuer Pilot.“
Sam lachte freundlich und reichte mir die Hand. „Hallo junger Freund. Wie ist noch mal Dein Name?“
„Eigentlich heiße ich Michael aber meine Freunde nennen mich Micha. Ich habe aber auch nichts dagegen, wenn ihr mich `Mike` nennt, wie es Amerika eher üblich ist.“
Sam übte sich in ‚Micha‘ und er zeigte mir gleich sein Reich, den Hangar mit Werkstatt und die beiden anderen DO 27, die in dem Hangar standen.
Nachdem die Maschine mit der wir gekommen waren in den Hangar geschoben war, fuhr mich Norman mit einem Geländewagen zu einem kleinen flachen Holzhaus unter Bäumen. „Hier wohnen wir“, verkündete er gut gelaunt.
Hinter dem Eingang befand sich ein kleiner Flur. Er deutete nach links: “Hier wohne ich und hier, “ er deutete auf die rechte Tür, „ist Dein Zimmer.“
Waau, dachte ich. Mit ihm Tür an Tür zu wohnen ist ja irre.
Es war ein karg eingerichteter Raum mit zwei gegenüberliegenden Fenstern, einem Bett, einem Tisch mit Stuhl und einem Kleiderschrank.
Er ließ mir eine halbe Stunde Zeit um mich mit meiner geringen Habe einzurichten und wollte mich dann zum Abendessen abholen.
Ich schaute mich um und räumte meine Sachen aus dem Rucksack in den Schrank. Eine Toilette mit Dusche befand sich am Ende des kleinen Flurs, die offensichtlich beiden Zimmern zur Verfügung stand.
Als Norman herüber kam, trug er einen hellgrauen Jogginganzug und weiß-blaue Nike-Turnschuhe. Er sah gut und sehr sportlich aus.
„Hast Du auch Hunger?“ fragte er.
„Ja, sehr sogar“, gab ich zu.
„Gut dann gehen wir in die Kantine.“
Vor dem Holzhaus zeigte er nach links. „Hundert Meter weiter ist die äußere Umzäunung des Camps mit einer Wache“, erklärte er und ging mit mir in die andere Richtung.
„Was ist das hier?“ wollte ich wissen und meinte damit das ganze Areal.
„Das erzähle ich Dir später.“
Ein Stück voraus kam ein größeres Holzhaus in Sicht.
„Das ist die Kantine“, erfuhr ich nun.
Als wir eintraten, kamen wir in einen kleinen Raum, in dem drei Tische mit je vier Stühlen standen. Gegenüber dem Fenster befand sich eine Öffnung, eine Art Durchreiche zur Küche. Im Hintergrund hörte man, dass wir nicht allein waren.
„Auf der anderen Seite ist die Kantine viel größer. Da essen die Leute von der Mine. Hier wo wir sind, ist der Transportbereich und wir sind ja nicht viele, “ erklärte mir Norman.
Bevor ich etwas fragen konnte erschien eine rundliche schwarze Frau an der Durchreiche und Norman stellte sie mir als `Kitty`, die Küchenfrau vor. Nachdem er Kitty gesagt hatte wer ich bin, bestellte er das Abendessen und eine große Flasche Orangenlimonade.
„Hier kannst Du immer hingehen, wenn Du Hunger hast oder Dir Getränke holen willst.“ Norman füllte die Gläser und wir tranken von der kühlen Limonade.
Gerade als ich wieder etwas fragen wollte, reichte Kitty das Essen aus der Küche. Es gab Impala-Steaks mit Kartoffeln und dicken Bohnen.
Ich hatte lange nicht mehr so gut gegessen und war am Ende satt und zufrieden. Als wir die Kantine verließen, war es schon dunkel. Norman hatte die Limonade mitgenommen und zeigte mir auf der Rückseite unseres kleinen Holzhauses eine Sitzbank und zündete eine Petroleumlampe an. Es war sehr mild und am Himmel waren Sterne zusehen.
Wir saßen nun nebeneinander und Norman erklärte mir das Camp. Es handelte sich um einen Untertagebau, in dem Industriediamanten gefördert wurden. Außer der äußeren Umzäunung, von der Norman vor dem Essen sprach, gab es noch eine innere Umzäunung für den eigentlichen Minenbereich. Aus Sicherheitsgründen gäbe es keinen Kontakt der Transportgruppe zu den Minenarbeitern. Deshalb sei auch die Kantine getrennt. Der Abbau habe in den fünfziger Jahren durch eine amerikanische Firma begonnen. Seit 1970 sei der Betrieb zwar von General Mobutu verstaatlicht worden aber de facto hätten die Amerikaner immer noch das Sagen. Sie müssten nur bestimmte Abgaben für die ausgeführten Mengen leisten.
„Und Du? Wie kommst Du hierher?“ fragte ich ihn.
Norman lachte. „Ich bin mit vier Jahren mit meinen Eltern hierhergekommen. Mein Vater ist der Direktor der amerikanischen Firma und hat noch eine Mine in Kamina.“
„Leben Deine Eltern hier in Kabunda?“
Norman schüttelte den Kopf. „Nicht mehr. Mein Vater hat sein Büro jetzt in Lubumbashi. Unsere Familie hat hier gelebt, bis meine Mutter vor sechs Jahren tödlich mit dem Auto verunglückt ist.“
„Und Du bist hier geblieben?“ fragte ich überrascht.
„Mein Bruder und ich waren im Internat in Lubumbashi. Ich bin jetzt hier und jobbe in der Firma bis Jason den Schulabschluss hat. Seit dem Tod unserer Mutter hängt er sehr an mir und ich will ihn nicht alleine lassen. Er ist erst 17.“
Das konnte ich gut verstehen.
Jetzt wollte er aber auch etwas von mir wissen und ich erzählte ihm wo ich herkam und was mich getrieben hatte, um nach Afrika zu reisen.
„Ich bin sicher, dass Dir dieses Land gefallen wird aber Du solltest jetzt schlafen gehen, denn morgen ist ein anstrengender Tag für Dich“, meinte Norman und stand langsam auf.
Im Flur sagte er: “Wie Du siehst, haben die Türen keine Schlösser. Wenn Du etwas willst oder brauchst, kannst Du jederzeit zu mir kommen.“
Ich nickte. „Kannst Du mich morgen früh wecken?“
Norman lachte und tippte mit dem Handrücken gegen meine Schulter. „Klar. Ich passe schon auf, dass Du nicht zu lange schläfst – gute Nacht.“
An diesem Abend war ich bald im Bett und schlief sofort ein. Als mich Norman weckte, war es draußen noch dunkel und ich drehte mich verschlafen noch einmal um.
„Hey – aufstehen“, rief Norman und zog mir die Bettdecke weg.
Ich stand brummig auf und konnte nicht verstehen, dass Norman um diese Zeit schon so gut drauf war.
Etwas später, als wir in der Kantine frühstückten, gab es starken Kaffee.
„Was ist los, hast Du schlecht geschlafen?“ fragte Norman.
Ich schüttelte den Kopf. „Entschuldige aber ich bin ein typischer Morgenmuffel. Nach dem Frühstück geht es dann schon besser.“
Norman lachte. „Was ist ein `Morgen-Muffel`?“
Jetzt fiel mir ein, dass ich das Wort einfach so übersetzt hatte wie es mir einfiel und das machte im amerikanischen wohl keinen Sinn. Ich umschrieb also was ich damit meinte.
„Ja das dachte ich mir schon aber es klang sehr komisch was Du vorher gesagt hast.“
Ich musste mich daran gewöhnen, dass in diesen Breitengraden die Sonne immer sehr schnell und zu den gleichen Zeiten auf- und untergeht. Als wir die Kantine verließen, war es bereits taghell.
Norman fuhr mich zum Hangar und ich half Sam die Maschine heraus zu schieben. Kurz darauf kam ein Geländewagen und übergab Sam eine Holzkiste, die wir in den Laderaum hievten und festzurrten. Als alles fertig war kam Steve mit einem Geländewagen angefahren. Er drückte mir eine alte abgegriffene Karte in die Hand und zeigte mir kurz die Flugroute. Unser Ziel war Cameia im Osten von Angola.
Nach dem Start gab er mir den Kurs mit 290 Grad, also West-Nord-West an. Bei blauem Himmel flog ich nun etwa tausend Meter über Grund und dabei wurde mir erst so richtig bewusst, dass es sich hier um eine riesige Hochebene mit nur sanften Hügeln und Tälern handelte. Die mittlere Höhe dieses Geländes betrug immerhin 1.200 Meter über dem Meeresspiegel. Südlich von Lubumbashi überflogen wir das Kupfer-Abbaugebiet mit den unaussprechlichen Namen von Orten wie Mokambo, Tshinsenda, Kasumbalesa und Chililabombwe. Nun befanden wir uns im Luftraum von Sambia nahe der Grenze zu Zaire. Eine Weile flogen wir über das satte Grün eines Hochmoores, welches sanft in eine trockene Graslandschaft mit einzelnen Baumgruppen oder einzeln stehenden Bäumen überging. Nächster Auffangpunkt waren die benachbarten Orte Solwezi und Kansanshi. Von nun an wurde es einsam. Weit und über lange Etappen waren keine Siedlungen, Flüsse oder Straßen auszumachen. Ich musste mich zwingen exakten Kurs zu halten und prägte mir besondere Landschaftsformationen ein. Kurz vor der Grenze zu Angola zeigte mir Steve die kleine Siedlung Mwinilungwa, wo es ebenso wie in Solwezi eine unbefestigte Landepiste gab.
Auf angolanischem Gebiet fiel das Geländeniveau langsam ab. Hier befindet sich das Quellgebiet des Sambesi-Flusses.
Ein letzter wichtiger Navigationspunkt war der kleine Dilolo-See am Rande des Cameia-Nationalparks.
Nach wenigen Minuten überflogen wir die Eisenbahn, die von Zaire kommend zum Atlantik führt und die Landung erfolgte anschließend auf einem ausgedorrten Grasgelände neben einer einfachen Safarihütte.
Nach etwas mehr als fünf Flugstunden kletterte ich mit steifen Knochen aus dem Flugzeug. Ich war nassgeschwitzt und froh, dass mir Norman geraten hatte, ein frisches Hemd mitzunehmen.
Steve ging mit mir in die Hütte, wo uns fünf Männer erwarteten. Es waren drei Schwarze und zwei Weiße. Zuerst bekamen wir lauwarmen Tee. Nach einigen belanglosen Worten gingen die Männer zum Flugzeug und tauschen unsere Holzkiste gegen eine andere, vermutlich leere Kiste aus. Anschließend holte einer der Männer einen uralten klapprigen LKW, der neben der Hütte gestanden hatte und mit Fässern beladen war. Aus diesen Fässern wurde unser Flugzeug mit einer Handpumpe betankt. Beim Anblick der rostigen Fässer und der Tatsache, dass sie zum Tanken keinen Filter benutzten, wurde mir ein bisschen mulmig aber ich wollte mich mit Steve nicht anlegen und sagte nichts dazu.
Um die Tanks der Maschine zu füllen, brauchten die Männer fast eine Stunde. In der Zwischenzeit brachte uns eine ältere schwarze Frau aus der Küche eine Art Fleischragout mit Reis.
Als wir mit dem Essen fertig waren, schickte mich Steve zum Flugzeug, um den Ölstand zu prüfen. Ich füllte einen halben Liter nach und dann begann der Rückflug.
Ich hätte Steve gerne einiges über die Landschaft gefragt aber er war so wortkarg und muffig, dass ich lieber darauf verzichtete.
Als wir elfeinhalb Stunden nach unserem Abflug wieder in Kabunda gelandet waren, klebte der Stoff an meinem Körper und ich hatte den Eindruck jeden Kochen im Leibe einzeln zu spüren.
Norman erwartete mich bereits und nahm mich nach dem Einräumen der Maschine mit in unsere Unterkunft.
„War es sehr anstrengend?“
„Ja“, sagte ich, „die Hitze und das lange Sitzen macht einen so richtig fertig.“
Ich wollte duschen aber er gab mir einen Jogginganzug von sich. „Zieh Dir das an. Ich will Dir erst etwas zeigen.“
Obwohl mir eine Dusche lieber gewesen wäre, schlüpfte ich in den Jogginganzug, der mir etwas zu groß war und folgte Norman, der zu meiner Überraschung einen Waldlauf mit mir veranstaltete. Nach einigen Umwegen erreichten wir neben dem Kantinengebäude eine Remise. Norman, der mir immer voraus war, öffnete einen Flügel des Tores und zeigte mir stolz den darin eingerichteten Kraftraum.
Ich war noch außer Atem und schwitzte aus allen Poren aber ich staunte nicht schlecht über die Trainingsgeräte und Matten, die sich hier befanden. Jetzt wusste ich auch wie er zu seiner athletischen Figur gekommen war.
„Jeden Tag eine Stunde Training, “ erklärte er mir. „Am besten Du fängst gleich mit dem Ruderschlitten an.“
Ich muss wohl ziemlich blöd geschaut haben, denn er lachte. „Du hast doch selbst gesagt, dass das lange Sitzen sehr anstrengend ist. Da musst Du dich anschließend bewegen – also los, wenigstens ein bisschen für den Anfang.“
Ich seufzte und gab mich geschlagen. „Also gut.“
Nach einer halben Stunde gemeinsamen Trainings hatte ich genug und wir trabten zurück in die Unterkunft.
Endlich kam ich unter die Dusche und fühlte mich anschließend sichtlich wohler. Nach dem Abendessen saßen wir wieder draußen im Schein der Petroleumlampe und redeten über unsere Kindheit und wie wir aufgewachsen waren.
Irgendwie machte es Spaß Norman zuzuhören und ihn lachen zu sehen, wenn ich erzählte. Es war auch ganz lustig, wenn mir mal eine Vokabel nicht einfiel und wir gemeinsam nach dem richtigen Wort suchten. Es schien so, als hätte er lange darauf gewartet mit jemandem mal so persönlich und unbefangen zu reden.
Ich bewunderte auch seine Disziplin, als er pünktlich um 22 Uhr feststellte, dass es Zeit zum Schlafen sei.
Ich lag noch eine Weile wach und dachte über Norman nach. Er hatte ganz andere und aufregende Erlebnisse als ich. Ich musste mir eingestehen, dass er mir gefiel. Seine gute Figur, sein hübsches Gesicht, sein freundliches Lachen und seine Ausstrahlung verursachten ein gutes Gefühl in mir und deshalb freute ich mich schon auf den nächsten Abend.
Am nächsten Tag, es war ein Dienstag, bekam ich die Einweisung für die zweite Route. Sie führte nach Cabora Bassa in Mozambique. Ich hatte viel darüber gelesen, dass dort mit Hilfe der ehemaligen Kolonialmacht Portugal ein riesiger Staudamm gebaut wurde, der den Sambesi-Fluss aufstauen sollte. In den Berichten war aber auch von Rebellen die Rede, die den Bau des Dammes zu verhindern suchten.
Gleich nach dem Start ging es auf südöstlichem Kurs über unbesiedeltes, waldreiches Gebiet. Irgendwo überquerten wir nach etwa dreißig Minuten die unsichtbare Grenze zu Sambia und weitere dreißig Minuten später ein flaches Tal mit dem Ort Serenje. Außer der asphaltierten Straße fielen mir Bauarbeiten für eine Eisenbahnlinie auf. Ich hatte darüber gelesen, dass China dieses Eisenbahnprojekt begleitete. Es hatte zum Ziel, eine Eisenbahnverbindung von Lusaka nach Dares Alam am Indischen Ozean zu schaffen. Mit dieser Neubaustrecke würde es einmal möglich sein, den afrikanischen Kontinent von Tansania über Sambia, Zaire und Angola in Ost-West Richtung oder umgekehrt zu durchqueren. Ich war allerdings einige Jahre zu früh, um diese Verbindung nutzen zu können.
Es folgte ein steppenartiges Gelände mit einzelnen Baumbeständen und den kleinen Flussläufen Lunsemfwa und Luangwa, bis wir nach einer weiteren Stunde eine asphaltierte Straße bei dem Ort Petauke überquerten. Nur dreißig Kilometer weiter befand sich die Grenze zu Mozambique. Hier war noch ein schmaler und nicht sehr hoch aufragender Gebirgszug zu überwinden, bevor das Gelände stetig abfiel. Nach dreieinhalb Stunden Flugzeit sah ich den Sambesi und die riesige Baustelle für den Staudamm vor mir.
Am nördlichen Rand der Baustelle wies mich Steve auf einen staubigen Behelfsflugplatz ein. Nach der Landung sah ich vor Baracken einige ein- und zweimotorige Kurierflugzeuge stehen, die offensichtlich mit der Baustelle in Zusammenhang zu bringen waren. Vor einer der Baracken parkte ich unsere Maschine. Gleich nach dem Aussteigen palaverte Steve mit einigen Männern und ließ mich warten.
Als ein Wagen kam, rief Steve mir zu, ich solle mich um den Austausch unserer Ladung kümmern. Später bekamen wir in der Baracke Verpflegung und draußen wurde unsere Maschine genauso umständlich betankt wie in Cameia.
Steve sprach die ganze Zeit mit anderen Leuten und beachtet mich nicht. Erst als es Zeit zum Abflug war, drehte er sich zu mir um. „Mach die Maschine klar, ich komme gleich.“
Sein Kommandoton vor den anderen Männern machte mich ziemlich sauer aber ich konnte mich in dieser Situation nicht mit ihm streiten. Der Rückflug war entsprechend einsilbig.
Die Landung in Kabunda war für mich doppelt schön. Zum einen war die Strecke kürzer, womit noch etwas Zeit bis zum Abend blieb und zum anderen war es der letzte Flug, den ich mit Steve zu absolvieren hatte. Der Gedanke, dass ich ihn bei den folgenden Flügen nicht mehr ertragen musste, machte mich unheimlich froh.
Norman holte mich am Hangar ab. Er war gut gelaunt und begleitete mich in mein Zimmer. „Ich habe heute den neuen Einsatzplan gemacht“, erklärte er mir und legte einen Zettel auf den Tisch.
Ich schaute ihn an und stellte fest, dass ich montags und freitags nach Cameia, dienstags und samstags nach Cabora Bassa zu fliegen und an den übrigen Tagen frei hatte.
Steve hatte dienstags Cameia, donnerstags Cabora Bassa, montags, mittwochs und freitags Lubumbashi auf dem Plan.
„Warum kriege ich keinen Flug nach Lubumbashi?“ fragte ich enttäuscht.
Norman lehnte sich an die Wand und hob die Arme etwas an. „Tut mir leid aber bei den Kurierflügen sind eine Menge Erledigungen zu machen. Versorgungsgüter und Ersatzteile besorgen, Reparaturen organisieren und Papierkram erledigen. Das kann nur Steve.“
„Schade“, fand ich, denn ich wäre gern mal zwischendurch in die Stadt gegangen.
„Mittwochs fliege ich immer mit nach Lubumbashi. Da regele ich einige Sachen mit meinem Vater und besuche anschließend Jason im Internat, “ erzählte Norman.
Da dieser Flug schon morgen sein würde, verlangte Norman meinen Pass und meine Fluglizenz. „Ich bringe Dir morgen die Papiere mit, die Du hier brauchst“, erklärte er mir.
Außerdem würde er mir Overalls und Stiefel mitbringen, wie Steve und er sie auch trugen. Da mir die Sachen gut passen sollten, nahm er ein Maßband.
„Stell Dich mal hier hin“, sagte er und deutete vor sich. Dann begann er die Bundweite zu messen, wobei ihm mein Gürtel im Weg war.
Er lächelte mich an. „Das geht so nicht“, meinte er. „Am besten ziehst Du mal Deine Jeans und das Hemd aus.“
Mich so unvermittelt vor einem hübschen Typen bis auf die Unterhose auszuziehen, machte mich ziemlich verlegen und ich zögerte zunächst.
„Na mach schon. Wir sind doch unter uns, “ sagte Norman und zwinkerte mir verschmitzt zu.
Mir blieb also nichts anderes übrig und ich redete mir ein, dass es ja schließlich eine rein dienstliche Angelegenheit sei.
Beim Ausziehen fiel mir auf, dass Norman meinen Körper betrachtete, bevor er ihn vorsichtig zu vermessen begann. Erst maß er die Bundweite, den Brust- und Halsumfang und die Armlänge. Dann ging er in die Hocke und begann die Bein- und Schrittlänge zu messen. Ich versuchte mich abzulenken, denn mir lief jedes Mal ein Kribbeln durch den Körper, wenn er meine Beine und meine Oberschenkel berührte. Ich schickte ein Stoßgebet zum Himmel und bat den lieben Gott, dass ich bei diesen wunderbaren Berührungen mal ausnahmsweise keinen Steifen bekommen sollte oder wenigstens erst später. Allein der Gedanke, dass Norman es bemerken würde, war mir schon peinlich. Ausgerechnet die Schrittlänge wollte Norman noch einmal genau nachmessen, weil sie doch so wichtig sei und da konnte auch der liebe Gott nichts machen.
Zum Glück schrieb Norman die Maße gleich auf. Ich ergriff sofort die Gelegenheit, drehte mich um und schlüpfte in meine Jeans, in der ich mein aufmüpfiges Teil einsperren konnte.
Ich hoffte, dass er nichts bemerkt hatte. Jedenfalls machte er nicht den Eindruck.
Bevor wir in den Kraftraum joggten, zeigte er mir sein Zimmer. Es war genauso groß wie meines aber viel wohnlicher und mit einem breiteren Bett eingerichtet.
Er zeigte mir sein Bücherregal und sein Transistorradio. „Wenn Du morgen frei hast, kannst Du lesen oder Radio hören“, bot er mir an.
Ich fand das sehr nett von ihm und bedankte mich.
Beim Training war ich an diesem Tag besonders gut drauf und strengte mich richtig an. Als ich von der Ruderbank aufstand und die Hanteln nehmen wollte, stand Norman auf der Bodenmatte. „Du hast wohl zu viel Kraft heute.“
Ich grinste ihn an und nahm eine typische Ringerhaltung ein. Norman lachte verschmitzt und wir begannen auf der Matte herumzutänzeln. Aus unserem Ringkampf wurde ein fröhliches Herumbalgen, denn er war mir ja kräftemäßig überlegen.
Irgendwann lagen wir nebeneinander auf dem Rücken und schnappten nach Luft. Ich hatte bei der Balgerei schon wieder einen Steifen bekommen und musste meine Beine anziehen und zur Seite rollen, damit man es durch die Trainingshose nicht sehen konnte.
„Du bist wohl so gut drauf, weil morgen Dein freier Tag ist“, vermutete Norman.
„Nein, weil ich das Ekel Steve jetzt nicht mehr ertragen muss“, erklärte ich.
„Du magst ihn nicht – oder?“
„Er mag mich nicht und das hängt er bei jeder Gelegenheit raus.“
„Mach Dir nichts daraus. Steve ist ein Einzelgänger. Von jetzt an musst Du aber mich ertragen wenn Du fliegst.“
„Ja aber wenn Du auch so ekelig werden solltest wie er, kündige ich“, drohte ich scherzhaft.
Norman kniff mich in den Oberarm und sagte: „Komm Lass uns duschen gehen.“
Da ich als erster unter die Dusche kam, wartete ich anschließend draußen auf ihn. In der Kantine ließ sich Norman von Kitty einen gefüllten Korb geben. Ich schaute etwas irritiert und er sagte: „Frag nicht und komm mit.“
Ich folgte ihm in Richtung Unterkunft und dann nach rechts quer durch den Wald. Wir kamen an einen merkwürdigen steilen Hügel und stiegen hinauf. Der Gipfel befand sich etwa in der Höhe wie die Wipfel der Bäume rundherum. Der Hügel war nicht bewachsen und bildete oben eine runde Plattform von etwa zehn Metern im Durchmesser. Ein richtiger Fremdkörper umgeben von dichtem Wald.
Oben angekommen, stellte Norman den Korb ab und zeigte in nördliche Richtung. Ich drehte mich um und verstand was er meinte. Es eröffnete sich ein phantastischer Weitblick über die Bäume hinweg. Das Gelände fiel jenseits des Camps leicht nach Norden hin ab. Die tief stehende Sonne färbte die Landschaft in ein seidenmattes Licht und ließ den Flusslauf im Tal silbrig glänzen. Norman stand dicht neben mir. „Der Fluss da unten ist der Luapula. Er kommt aus dem Bangweulu-See in Sambia. Er bildet hier die Grenze zwischen Zaire und Sambia, bis er 300 Meilen im Norden in den Maero-See fließt. Dieses Wasser fließt dann weiter in den Zaire-Fluss, durchquert das ganze riesige Land und mündet irgendwann in den Atlantik.“
Seine Stimme verriet dabei ein gewisses Maß an Ehrfurcht und Stolz. Ich war von der Aussicht so beeindruckt, dass ich mich gar nicht satt sehen konnte. Es schien alles viel weicher und lieblicher als der Blick von oben aus dem Flugzeug.
Ich hörte, wie Norman etwas machte und schaute nach ihm. Erst jetzt bemerkte ich eine Vertiefung in der Mitte der Gipfelplattform, die als Feuerstelle hergerichtet war. Daneben lagen einige große Steine und trockenes Holz. Während Norman Holz in die Feuerstelle legte, erzählte er: „Das hier ist eine alte Abraumhalde. Ich habe sie als Kind schon entdeckt und war immer gerne hier oben. Außer meinem Freund Phillipe und Dir habe ich sie noch niemandem gezeigt.“
„Das ist ein wunderschöner Platz“, bestätigte ich.
Er lächelte zu mir herüber. „Ja es ist ein kleines Highlight in dieser gottverlassenen Gegend.“
Bis die dicken Holzstücke richtig brannten, sahen wir schweigend die Sonne am Horizont untergehen. Es war unglaublich romantisch und irgendwie empfand ich ein starkes Gefühl der Zuneigung zu Norman, dem ich erst drei Tage zuvor begegnet war.
Als das Feuer gut durchgebrannt war, legte Norman eine Stahlplatte auf die Steine über das Feuer und packte den Korb aus. Auf der heißen Platte briet er saftige T-Bone-Steaks, die wir anschließend mit einer Art Maissalat verspeisten. Es schmeckte köstlich.
Der Abend und die Atmosphäre waren zu schön, um viel zu reden. Wir saßen uns schräg gegenüber und schauten uns im Schein des Feuers an.
Als das Feuer schwächer wurde und nur noch die rote Glut zusehen war, kam Norman zu mir und setzte sich auf den Boden. Mit angezogenen Beinen betrachtete er mich und sagte nach einer Weile: „Du bist sehr schön, weißt Du das?“
Ich bekam ein Kribbeln im Bauch und rutschte ohne darüber nachzudenken von meinem Holzklotz auf den Boden, um ihm etwas näher zu sein.
„Danke, das gleiche kann ich von Dir auch sagen“, brachte ich mühsam hervor.
Als er ganz zaghaft mit einer Hand mein Knie berührte, traute ich mich das gleiche zu tun. Da uns beiden die Berührung nicht unangenehm war, kamen wir uns immer näher. Ich spürte meinen Herzschlag bis in die Haarspitzen als Norman einen Arm auf meine Schulter legte und sich zu mir drehte. Einen Moment sahen wir uns tief in die Augen, wie um ein gegenseitiges Einverständnis zu finden. Ich spürte seinen Atem, seine Hände an meinem Körper und schließlich seine Lippen auf den meinen. Diesem zaghaften Kuss folgte ein zweiter intensiver Kuss, bei dem wir unsere Zunge auf eine wunderbare Reise schickten. Am liebsten hätte ich ihn nie wieder losgelassen aber wir verständigten uns wortlos nach unten zu gehen.
Norman deckte die Glut mit der Stahlplatte zu und umfasste meine Schulter, um mich in der Dunkelheit sicher den Abhang hinunterzuführen. Als ich im Wald über eine Wurzel stolperte, griff er mir unter die Kniekehlen, trug mich mühelos in sein Zimmer und legte mich auf sein Bett.
Ich konnte mein Herz klopfen hören, als er zwei Kerzen anzündete und das elektrische Licht ausknipste.
„Lass mal sehen, ob Du dir vorhin wehgetan hast“, flüsterte Norman und begann mir die Schuhe und die Socken auszuziehen. Ohne Widerstand half ich ihm auch meine Jeans abzustreifen.
Ganz zart strich er nun mit den Fingern über meine Fußrücken und tastete die Fußgelenke ab.
Ich bestätigte, dass mir nichts wehtat und er quittierte es damit, dass er anfing meine Beine zu küssen und auf diese Weise langsam nach oben zu arbeiten.
Es war ein wahnsinnig schönes Gefühl, seine Lippen, seine Zunge und die zarten Bartstoppeln auf meiner Haut zu spüren. Um dieses Gefühl besser ertragen zu können schloss ich die Augen und es war mir völlig egal, dass meine Unterhose jetzt eher wie ein Zirkuszelt aussah.
Als Norman zwischen meinen Oberschenkeln ankam, war ich so erregt, dass ich gar nicht merkte, wie seine Finger mein Hemd öffneten und meine Brust freilegten. Das wurde mir erst bewusst, als ich seine zarte Zunge am Bauchnabel und an den Brustwarzen spürte. Ich öffnete die Augen und als er mit seinen Händen andeutete, mein Hemd ausziehen zu wollen, fand ich es nicht okay, dass er noch vollständig angezogen vor dem Bett kniete.
„Nur wenn ich Dich dann auch ausziehen darf“, sagte ich.
Norman lächelte mich an. „Lass nur. Das mache ich schon.“
„Nein“, protestierte ich und richtete mich auf. „Das möchte ich tun.“
Ich machte ihm Platz auf dem Bett und krabbelte an das Fußende, wo ich mich über seine Beine kniete, um ihm die hohen Nike-Turnschuhe auszuziehen, die mir so gut gefielen. Jetzt, aus der Nähe betrachtet, kamen sie mir riesig vor aber bei seiner Körpergröße war Schuhgröße 13 nicht soo ungewöhnlich.
Als ich sie endlich ausgezogen hatte und mich mit seinen weißen Sportsocken abmühte, ließ Norman seine Finger über mein ihm zugewandtes Hinterteil gleiten, welches noch von meiner Unterhose bedeckt war. Das machte mich so an, dass ich die zweite Socke nicht mehr herunter bekam und ich half mir, indem ich mit der Zungenspitze seine nackte Fußsohle kitzelte, wobei er sich lachend in sein Kopfkissen fallen ließ.
Bald hatte ich ihn auch von seiner Jeans und seinem T-Shirt befreit. Was sich bei ihm gegen den engen Slip aufbäumte, konnte ich nur erahnen. Ich kniete über ihm und beugte mich über seine kräftige Brust, die genauso wenig behaart war wie meine und das lud mich geradezu ein, sie zu berühren. Zuerst küsste ich seinen Bauchnabel, bevor ich vorsichtig meine Zunge zu Hilfe nahm. Norman atmete tief und genüsslich. Doch plötzlich fasste er meine Schulter und drehte sich mit mir so geschickt herum, dass ich wieder auf dem Rücken lag und er über mir war. Dabei grinste er so schelmisch, dass ich lachen musste. Er spielte mit seiner Kraft und es machte mir nicht das Geringste aus, mich zu fügen. Ich wurde mit einem Kuss belohnt und dann setzte Norman seine Zunge wieder an meinem Körper ein. Sie erforschte jede erreichbare Stelle und ich konnte nichts anderes tun, als seine unendliche Zärtlichkeit zu genießen.
Langsam erreichte er wieder meinen Bauchnabel und fuhr mit den Händen unter den Bund meiner Unterhose. Das war so geil, dass ich stöhnte und ihn ermunterte, das störende Ding schnell über meine Beine zu streifen. Jetzt hatte er mich ganz und als er anfing mein Säckchen zu lecken, war mir, als müsste ich abheben. Er saugte die Kugeln in den Mund. Erst eine und dann alle beide. Es war so warm und so neu für mich, dass ich fast enttäuscht war, als er sie wieder in die Freiheit entließ. Ich hatte aber keine Zeit enttäuscht zu sein, denn jetzt leckte er meinen Schwanz, der kaum noch härter werden konnte.
Wie oft hatte ich mir so etwas gewünscht wenn ich abends im Bett gewichst habe und meine Phantasie mit mir auf die Reise gegangen war. Jetzt war es Realität und es übertraf all meine Erwartungen. Besonders der Moment, wo sich seine Lippen um meine Eichel legten und seine Zunge ganz zart darüber fuhr, war ein unbeschreibliches Gefühl. Mein ganzer Körper bebte und kribbelte. Ich war kurz vor dem Höhepunkt aber Norman dachte nicht an eine schnelle Nummer und machte immer wieder eine kurze Pause, wenn er meinen Schwanz einige Male mit den Lippen massiert hatte. Ich stöhnte und die Schweißperlen liefen mir von der Stirn in die Augen. Dann knabberten seine Zähne ganz zart an meiner Eichel, seine Lippen schlossen sich enger um den Schafft und er trieb mich zum Höhepunkt.
„Norman!“ schrie ich als Warnung, dass es mir jetzt kam aber er machte keine Anstalten meinen Zauberstab aus dem Mund zu nehmen. Im Gegenteil. Er lutschte und saugte so heftig, dass ich meinen Saft in vielen Schüben in seinen Mund abgeben musste.
Während ich total erschöpft in das Kopfkissen sank, ließ Norman mein abschwellendes Teil langsam aus seinem Mund, leckte sich die Lippen und beugte sich über mein Gesicht.
„Hmm, von dem Nachtisch kann ich wohl nie genug kriegen.“
Das war für mich das Signal, mich ganz schnell zu erholen, denn für den aufregendsten Orgasmus, den ich je erlebt hatte, wollte ich mich schnell revanchieren.
Ich machte Norman Platz und begann ihn genauso zu verwöhnen, wie er mich verwöhnt hatte.
Auch ich erforschte mit der Zunge jeden Winkel seines Körpers und wand mich dabei auch seinen kräftigen Beinen und seinen Füßen zu, die ich sehr erotisch fand. Erst zuckte Norman, als meine Zunge über die weichen glatten Sohlen glitt aber dann schien es ihm doch zu gefallen, denn ich konnte ein leichtes Stöhnen vernehmen.
An seinen Beinen arbeitete ich mich wieder nach oben und befreite ihn von seinem engen Slip.
Was mir da entgegen sprang, verschlug mir fast den Atem. Dieser feste Schwanz war nicht nur länger, sondern auch dicker als meiner. Norman war beschnitten, genau wie ich und das reizte mich umso mehr. Allerdings kümmerte ich mich zunächst auch um die süßen Kugeln in seinem leicht behaarten Sack. Es gefiel ihm und ich schmiegte mich dabei an seine weichen Schenkel.
Nach einer Weile widmete ich mich seinem besten Stück. Es war so geil wie er zuckte, wenn ich daran leckte und dann nahm ich das ganze Ding in den Mund. Ich hatte so etwas vorher noch nie bei einem anderen Jungen gemacht aber was Norman vorher bei mir gemacht hatte, nahm meine Scheu und jetzt wusste ich was zu tun war, damit es schön ist. Die ersten Lusttropfen schmeckten salzig und bitter aber das störte mich nicht. Ich hatte nur etwas Mühe, das große Teil auch nur annähernd ganz in den Mund zu kriegen, ohne die Eichel gegen den empfindlichen Rachen zu stoßen.
Norman stöhnte laut, wenn meine Zunge seine Eichel umkreiste und deshalb tat ich es gerne. Langsam und mit Bedacht trieb ich ihn seinem Höhepunkt entgegen und je mehr er stöhnte und in seiner Lust badete, desto entschlossener wurde ich, auch seinen Liebessaft in mir aufzunehmen.
Als ich die Lippen fester zusammenpresste, seinen Schwanz massierte und zwischendurch mit der Zunge über seine Eichel fuhr, verkrampfte er sich kurz, bäumte sich unter einem warnenden Laut auf und dann schossen die heißen Fontänen in meinen Rachen. Ich musste aufpassen, dass ich mich nicht verschluckte, denn es waren mindestens fünf Fontänen salzig süßer glibberiger Flüssigkeit, die sich in meinen Mund ergossen. Ich schluckte alles so wie er es auch bei mir getan hatte.
Norman schien genauso erschöpft zu sein, wie ich es vorhin war. Ich löste mich von seinem edlen Teil und legte mich neben ihn. Er lächelte mich an, zog mich ganz nah an sich heran und gab mir einen Kuss.
Für uns war die Situation einfach zu schön, um etwas zu sagen. Irgendwie kriegten wir die Decke über uns und schliefen eng aneinandergeschmiegt und unsagbar glücklich ein.
Die Sonne schien durch das Fenster, als ich am Vormittag aufwachte. Es kam mir vor, als erwachte ich aus einem wunderschönen Traum. Langsam wurde mir bewusst, dass ich wirklich in Normans Bett lag und der vermeintliche Traum Wirklichkeit gewesen sein musste. Ich hätte Norman jetzt gerne gespürt, um ihm zu sagen wie glücklich ich war. Er befand sich aber vermutlich schon in Lubumbashi oder auf dem Weg dahin. Ich beschloss noch eine Weile in diesem Bett zu bleiben, zog die Decke über den Kopf und sah noch einmal die wunderschöne Aussicht, das Lagerfeuer und die wunderschönen Augen, mit denen mich Norman verzaubert hatte. Ich war noch keine halbe Stunde wach und vermisste ihn schon.
Schließlich raffte ich mich auf und ging zum Frühstück. Meine Gedanken kreisten wild durcheinander. Es konnte nicht anders sein, ich war verliebt. Das erste Mal richtig verliebt.
dass ich mich ausgerechnet in einen Mann verlieben würde, beunruhigte mich nicht. Es bestätigte nur, was ich mir in der Zeit von meinem 14. Lebensjahr bis heute nach vielen inneren Konflikten eingestehen musste. Ich hatte nur Angst davor, dass es für Norman ein einmaliger Ausrutscher gewesen sein könnte und er mir sagen würde: `Sorry, das war nicht so gemeint. ` Ich glaubte das nicht ertragen zu können. Wenn es ihm aber ähnlich ginge wie mir, wie käme ich damit zu Recht. Wir würden fast immer zusammen sein um den fliegerischen Job zu erfüllen und dabei war er immerhin mein Boss. Könnte ich dabei meine Gefühle immer unter Kontrolle halten?
Da ich auf all diese Fragen keine Antworten finden konnte, beschloss ich am Nachmittag zum Hangar zu gehen, um mich bei Sam ein wenig ablenken zu können.
Sam erklärte mir seine Wartungsarbeiten an den Flugzeugen. Er war bis vor acht Jahren Chefmechaniker bei der britischen Royal Airforce in der Nähe von Nairobi. Nach seiner Pensionierung kam er durch Zufall nach Kabunda.
Die Flugzeuge trugen Namen am Rumpf. Im hinteren Teil des Hangars stand die `Anny`. Sie war nach dem Weggang meines Vorgängers nicht mehr genutzt worden und sollte jetzt mein Flugzeug werden. Sam zeigte sie mir. Sie war in einem guten Zustand und was mich beeindruckte, war die umfangreiche Notausrüstung, die man brauchen würde, falls man irgendwo draußen mal eine Notlandung machen musste. Die Ausrüstung bestand aus einigen wichtigen Werkzeugen, einem Wassertank, Decken, Verbandzeug, speziellen Medikamenten und Notverpflegung.
Vorne stand die `Paula`. Sie war die Reservemaschine und bekam einen neuen oder reparierten Generator eingebaut. Steves Maschine war die `Doris` und im Augenblick unterwegs.
Ich half Sam ein wenig, in dem ich ihm Werkzeug anreichte. Sam arbeitete in aller Ruhe und entschloss sich recht bald eine Pause zu machen. In seinem kleinen Magazin kochte er Wasser auf einem Spirituskocher und brühte damit zwei Becher Malzkaffee auf.
Während wir in aller Ruhe Kaffee tranken, ließ er sich von meiner bisherigen Fliegerei erzählen.
Unsere Unterhaltung wurde gegen vier Uhr vom Funkgerät unterbrochen. „Kabunda, die Doris landet in fünf Minuten“, quäkte Steves Stimme aus dem kleinen Lautsprecher.
Ich ging langsam nach draußen, um die Landung beobachten zu können. Ich freute mich schon darauf Norman zu sehen.
Mit einem letzten Klacken kam der Propeller zum Stillstand. Als Norman ausstieg, sah er müde aus. Er entdeckte mich aber bald und lächelte mir zu. „Hey Micha. Schön, dass Du hier bist.“
Ich half ihm beim Ausladen.
„Ich bringe eben die Sachen zur Mine und bin gleich wieder da“, sagte er und stieg in den Geländewagen.
Wir hatten die ‚Doris gerade in den Hangar geschoben, da war Norman schon wieder zurück und ließ mich einsteigen.
„Wie geht’s Dir?“ wollte er wissen.
„Gut und Dir?“
Norman legte seine rechte Hand auf mein Knie und sagte: “Wenn ich Dich sehe geht es mir sehr gut.“
Während er sich in seinem Zimmer umzog, bat er mich die Sachen hereinzubringen, die noch im Wagen lagen. Es waren vier der dunkelblauen Overalls, ein Paar schwarze Pilotenstiefel, ein Jogginganzug und ein Paar Nike-Turnschuhe der gleichen Art, wie Norman sie hatte.
Zuerst musste ich einen der Overalls und die Stiefel anprobieren.
„Steht Dir gut“, fand Norman, der auf der Bettkante saß.
Ich war ein bisschen stolz auf diese Uniform und schälte mich aber gleich wieder heraus, um den Jogginganzug und die Turnschuhe anzuziehen. Alles passte optimal. Das Ausmessen am Tag zuvor hatte sich also gelohnt.
Ich ging zu Norman, beugte mich vor und gab ihm einen Kuss auf die Wange.
„Danke“, sagte ich.
Norman ergriff meine Hände und ließ sich mit dem Rücken auf das Bett fallen. Dabei zog er mich neben sich. „Die Sachen bezahlt die Firma.“
„Nicht nur für die Sachen“, ergänzte ich. „Auch und ganz besonders für gestern. Ich glaube es war der schönste und aufregendste Abend, den ich je erlebt habe.“
„Fein“, sagte er leise und strich mir mit der Hand über die Haare. „Es muss ja nicht der letzte gewesen sein.“
Bevor wir uns auf den Weg zum Training machten, hatte Norman noch etwas für mich. Er gab mir einen Firmenausweis, eine auf ein Jahr befristete Fluglizenz des Staates Zaire und einige gebrauchte Landkarten für meine Flugstrecken.
„Weißt Du eigentlich, dass wir noch gar nicht über Deine Bezahlung gesprochen haben?“
„Ja, stimmt“, stellte ich fest. Es war auch nicht das wichtigste für mich. Ich fand es schon toll, dass ich in dieser Zeit kein eigenes Geld ausgeben brauchte.
„Ich habe mit meinem Vater ausgehandelt, dass Du 120 Dollar für jeden Tag bekommst, an dem Du für uns fliegst. Ist das okay?“
„Hundertzwanzig Dollar – waao – das ist eine Menge Geld“, fand ich.
„Es ist auch ein harter Job“, stellte Norman richtigerweise fest.
Er streckte mir seine Hand entgegen und ich schlug ein.
„So, jetzt ist der andere Teil des Jobs dran“, sagte er lachend.
„Aye Sir, “ antwortete ich und trabte in meiner neuen Sportkleidung mit ihm los.
Nach einem halbstündigen Waldlauf erreichten wir den Kraftraum. Als sich unser Atem wieder beruhigt hatte, mühte sich Norman mit möglichst britischem Akzent zu sprechen, wie ich es in seinen Ohren offensichtlich tat: „Was bedeutet es, wenn Du `Aye Sir` zu mir sagst?“
Ich musste grinsen. „Das bedeutet, dass ich eigentlich etwas anderes lieber täte, es aber aus verschiedenen Gründen für klüger halte, Deinem Wunsch Folge zu leisten.“
Es dauerte einen Moment, bis er den von mir bewusst kompliziert formulierten Satz begriffen hatte. Dann lachte er und sagte: „Ausgezeichnet, das gefällt mir.“
Die Luft war klar und mild, als wir nach Training, Duschen und Abendessen die Kantine verlassen hatten. Mond und Sterne tauchten den Weg durch den Wald in ein fahles Licht und Grillen sowie andere Lebewesen sorgten für die dezente Geräuschkulisse dieses Abends. Norman hatte seinen Arm um meine Schulter gelegt. Weil er einen halben Kopf größer war als ich, war mir seine Schulter zu hoch, deshalb legte ich meinen Arm um seine Taille. Ganz langsam schlenderten wir zu unserer Unterkunft.
„Hast Du morgen etwas vor?“ erkundigte ich mich weil der Donnerstag laut Plan für uns beide frei war.
„Ich muss morgen Vormittag noch etwas Papierkram mit dem Vorarbeiter der Mine erledigen aber spätestens zum Mittag bin ich zurück. Wenn Du willst, haben wir den ganzen Nachmittag für uns alleine, “ antwortete Norman.
„Oh prima, “ freute ich mich. „Zeigst Du mir mal den Ort Kabunda und die Umgebung außerhalb des Camps?“
„Okay, wenn Du willst. Ich hoffe nur, Du bist dann nicht enttäuscht.“
Wir setzten uns wieder draußen auf die Bank. Während ich die Petroleumlampe anzündete, holte Norman eine Flasche und zwei Becher aus seinem Zimmer.
„Du musst ja morgen nicht fliegen“, sagte er und zeigte mir die Flasche. Ich erkannte nur, dass es Rotwein war.
„Er stammt aus meiner Heimat Kalifornien“, erklärte er und füllte die beiden Becher.
„Kennst Du deine Heimat?“
„Nicht besonders gut. Ich kann mich an die Zeit bevor wir hierher kamen kaum erinnern aber meine Großeltern leben dort. Die haben wir drei- oder viermal besucht.“
Er stieß mit mir an und der Wein schmeckte sehr fruchtig.
Vorsichtig tastete ich mich an eine sehr persönliche Frage heran: „Hattest Du vorher schon einmal Sex mit einem Jungen?“
Norman nickte und schmunzelte etwas dabei. „Ja im letzten Jahr im Internat. Irgendwie ergab sich das so und es war ein Junge, den ich noch nicht einmal besonders attraktiv fand. Es war vielleicht Neugier aber wir haben es ausprobiert und herausgefunden, dass es ein schönes Gefühl ist. Und Du? Hattest Du auch schon mal …?“
„Nein“, musste ich gestehen. „Ich wollte schon gerne und habe es mir immer vorgestellt aber ich habe mich nie getraut mich einem Jungen in dieser Weise zu nähern.“
„War es denn so, wie Du es dir vorgestellt hast?“
Ich drehte mich herum und legte meinen Kopf verträumt auf seinen Schoß. „Es war viel schöner und aufregender“, schwärmte ich.
Norman schaute mich mit seinen wunderschönen Augen an und berührte zärtlich mein Gesicht. Wir brauchten uns nichts mehr zu sagen, denn es war wie auf einer Wolke zu schweben.
Als ich am nächsten Morgen erwachte, lag ich in Normans Armen.
„Guten Morgen Du kleiner Langschläfer, “ hörte ich und brummelte ganz verschlafen vor mich hin.
Ich wollte noch nicht aufstehen und schmiegte mich an seine kräftige, fast unbehaarte Brust. So schmusten wir noch eine Weile bis Norman keine Ruhe mehr hatte und aufstand.
Nach dem Frühstück fuhr er wie angekündigt zur Mine.
Ich begab mich in mein Zimmer und schaute mir die Papiere an. Mich wunderte zunächst, dass die zairische Fluglizenz ohne Foto ausgestellt worden war. Das gleiche galt für den so genannten Dienstausweis. Darauf stand mein Name, als Funktion `Pilot der Transportgruppe im Camp Kabunda` und darunter ein Zusatz, `darf das Camp nur in Begleitung einer autorisierten Person verlassen`. Da ich ohnehin immer mit Norman zusammen flog, machte ich mir darüber keine Gedanken.
Ziemlich intensiv beschäftigte ich mich mit den Flugkarten. Es sah so aus, als stammten sie von meinem Vorgänger. Die planmäßigen Routen waren eingezeichnet und in Zeitabschnitte versehen. An einigen Stellen, waren nachträglich Schornsteine und Fördertürme mit Höhenangaben eingezeichnet. Was mir besonders auffiel, waren vereinzelte rote Punkte abseits der Flugroute. Daneben waren Zahlen vermerkt und es dauerte eine Weile, bis mir klar wurde, was das zu bedeuten hatte. Die Zahlen schienen Frequenzen und die Punkte Standorte von Rundfunksendern zu sein.
Mit den in den Flugzeugen eingebauten Radiokompaßgeräten kann man Frequenzen im Mittelwellen- und Langwellenbereich einstellen und abhören. Bei entsprechendem Empfang zeigt dann die Nadel des Radiokompass in die Richtung in der sich die Sendeanlage befindet. Man kann daher nicht nur Funkfeuer, von denen es nur jeweils eines in Lubumbashi und Ndola gab, sondern auch ganz normale Radiostationen für Peilungen nutzen wenn man weiß wo ihre Sendeantennen stehen.
Je mehr ich darüber nachdachte, desto klarer wurde mir wie sinnvoll diese Eintragungen für den Fall von schlechtem Wetter waren. Ich nahm mir vor, die Frequenzen und Peilungen bei den nächsten Flügen auszuprobieren und zu überprüfen.
Schließlich schrieb ich einen ausführlichen Brief an meine Eltern und Brüder, den ich Norman am nächsten Mittwoch nach Lubumbashi zur Post mitgeben wollte.
Nachdem Norman zurück war und wir zu Mittag gegessen hatten, nahmen wir den Geländewagen und verließen das Camp. Am Tor wurden wir wahrscheinlich nur deshalb nicht kontrolliert, weil Norman am Steuer saß.
Auf dem staubigen Weg, der mit leichtem Gefälle durch den Wald führte, rumkurvte Norman geschickt die zahlreichen Schlaglöcher. Nach einigen Kilometern mündete unser Weg in einen anderen. Es war jetzt freies Gelände und unser Wagen zog eine mächtige Staubfahne hinter sich her.
Nach einer Weile tauchte ein Gebäude neben dem Weg auf, dem man schon von weitem ansehen konnte, dass es schon bessere Zeiten erlebt hatte. Der Sockel war mit groben Steinen gemauert, der Rest bestand aus Holz.
„Das ist Kabunda“, erklärte mir Norman und fuhr auf den Vorplatz des Hauses, wo sich eine altertümliche Zapfsäule für Benzin befand.
„Das ist alles?“ fragte ich enttäuscht.
Norman grinste. „Nicht ganz. Etwas weiter, hinter den Bäumen stehen etwa zwanzig Hütten.“
Er öffnete dabei den Tankverschluss. Ein alter grauhaariger Schwarzer erschien an der Tür und als er Norman erkannte, rief er ihm etwas zu und verschwand wieder. Norman füllte mit einer Handpumpe einen Glaszylinder mit Sprit, öffnete dann ein Ventil und ließ den Sprit mit einem dünnen Schlauch in den Tank laufen. Dies wiederholte er zeitraubend fünfmal, bis der Tank voll war. Ich hatte mal so eine Zapfsäule in einem Heimatbuch gesehen. So müssen sie in Deutschland wohl vor dem zweiten Weltkrieg gewesen sein und man nannte sie damals ‚eiserne Jungfrauen‘.
Ich ließ es mir nicht entgehen, Norman beim Bezahlen zu begleiten. Drinnen saß der Alte auf einem Lehnstuhl umgeben von Holzkisten mit allem möglichen staubigen Kram.
Ein paar lappige Geldscheine wechselten den Besitzer bei einer geraumen Zeit mir völlig unverständlichem Palaver in der Bantusprache.
Später im Wagen sagte Norman: „Ganz egal was Du brauchst, hier bekommst Du es garantiert nicht.“
„Außer Benzin“, korrigierte ich ihn.
„Ja aber wahrscheinlich auch nur, weil er vom gleichen Tankwagen beliefert wird wie wir.“
„Wenn es das gleiche ist, warum tankst Du dann hier?“ wunderte ich mich.
„Damit der Alte nicht ganz umsonst in seinem Laden sitzt und außerdem erfahre ich dabei was es in der Gegend neues gibt.“
Als nächstes zeigte mir Norman den Grenzübergang nach Sambia. Da die Grenze in der Flussmitte des Luapula verläuft, endete der Weg am Flussufer. Von hier aus pendelte bei Bedarf eine kleine betagte Kettenfähre über den hier etwa 100 Meter breiten Fluss. Für die Grenzabfertigung gab es am Anlegeplatz der Fähre eine kleine Holzhütte, in der zwei Grenzsoldaten ihren Dienst versahen.
Wir konnten beobachten, wie sich die Fähre zwischen den Ketten von der sambischen Seite in unsere Richtung herüber hangelte. Sie hatte Platz für zwei PKW oder einen LKW. Diesmal waren aber nur drei Personen an Bord.
„Ich hatte gar nicht gedacht, dass der Fluss so breit ist.“
„Ist er eigentlich auch nicht“, erklärte mir Norman. „Er staut sich aber an manchen Stellen wie hier. Nachher kannst Du sehen wie schmal er normalerweise ist.“
Nachdem die Fähre angekommen war, fuhren wir weiter. Diesmal fuhr Norman querfeldein über das trockene Grasland. An einer etwas erhöhten Stelle hatten wir einen guten Ausblick auf eine Flussbiegung, die gerade von einer Gazellenherde als Tränke genutzt wurde. Es war ein schöner Anblick die etwa dreißig Tiere zu sehen.
„Hier kann man oft Tiere beobachten“, sagte Norman. „Manchmal hat man Glück und es sind Zebras und Giraffen dabei.“
Wir beobachteten die Gazellen eine ganze Weile bis sie weiter zogen. Dann packten wir den mitgebrachten Proviant aus und machten ein Picknick neben dem Auto.
„Warst Du in den Schulferien immer hier in Kabunda?“ fragte ich.
Norman nickte und erzählte mir, dass seine Eltern einen freundschaftlichen Kontakt zu einer belgischen Einwandererfamilie hatten, die eine große Farm etwa fünfzig Kilometer südlich von Kabunda betrieben und man sich gegenseitig besuchte. Diese Familie hatte einen Sohn in Normans Alter mit dem er sich gut verstand. In den Ferien verbrachte Norman die Hälfte der Zeit auf der Farm und für den Rest der Ferien war sein Freund hier in Kabunda zu Besuch.
„Was habt ihr da so alles gemacht?“
„Auf der Farm gab es immer was Interessantes. Wir sind viel geritten, haben ein bisschen bei der Arbeit geholfen und hier sind wir viel in der Gegend herum. Zuerst mit dem Fahrrad und ab zwölf Jahren mit dem Geländewagen, “ berichtete Norman.
„Mit zwölf Jahren schon mit dem Auto ?“ Ich schaute ihn ungläubig an.
Er grinste. „Klar, warum denn nicht. Jeff, der Vorgänger von Sam hat mir das Fahren schon mit zehn Jahren beigebracht und hier fragt keiner nach einem Führerschein.“
Es war im Laufe des Nachmittags ziemlich heiß geworden und mir klebte das Hemd am Körper. Als ich es ausziehen wollte, hielt mich Norman davon ab. „Du bist nicht daran gewöhnt und wenn dich hier Mücken stechen kann das sehr unangenehm sein.“
Ich sah das irgendwie ein und befolgte seinen Rat.
„Was hältst Du davon, wenn wir unser Training heute im Wasser verbringen und schwimmen gehen?“
„Das wäre super“, freute ich mich und war gespannt wo er nun hinfahren würde.
Zunächst ging es zurück bis auf den Weg, der zum Camp führte. Dann bog Norman nach rechts ab und folgte einer kaum sichtbaren Fahrspur, die in Richtung des Flusses führte. Je mehr wir uns dem Flussufer näherten, desto steiniger und schwieriger wurde das Gelände. Schließlich erreichten wir eine Stelle, an der Norman anhielt. Der Luapula war hier nur etwa zehn Meter breit und floss gemächlich durch das ausgewaschene Flussbett. An den großen Steinen an den Ufern konnte man erkennen, dass der Fluss zu anderen Zeiten viel mehr Wasser führte als zu diesem Zeitpunkt. Das Wasser war erstaunlich klar und an manchen Stellen tief genug zum Schwimmen.
„So da wären wir. Das ist unsere Badeanstalt.“
Ich schaute Norman an. „Und was machen die Krokodile und Piranhas?“
Er begann herzhaft zu lachen und sich auszuziehen. „An Dir ist doch nichts dran und mich scheinen sie auch nicht zu mögen.“
Ich beeilte mich, meine Sachen auszuziehen und zum Trocknen auszulegen. Norman packte mich und nahm mich quer auf seine Schulter. Trotz meiner lauten Proteste stieg er mit mir in den Fluss und warf mich an einer tieferen Stelle ins Wasser. Als ich prustend an die Oberfläche kam, schwamm er bereits neben mir. Wir schwammen um die Wette und balgten mit großem Vergnügen im Wasser herum. Es machte uns großen Spaß, wenn er mich einholte und über die Schulter hob. Es war enorm wie er dabei seine Kraft einsetzte, ohne mir weh zu tun.
Nach ungefähr einer Stunde hatte ich genug und krabbelte ans Ufer. Norman zeigte mir einen Stein, auf dem wir bequem liegen und uns von der Sonne trocknen lassen konnten.
„Na, wie fühlst Du dich?“ wollte er wissen.
„Prima. Das können wir ruhig öfter machen.“
„Okay, an mir soll es nicht liegen. Was hältst Du davon, wenn wir heute Abend noch einmal grillen bevor morgen die Fliegerei anfängt?“
Ich fand die Idee gut und freute mich darauf.
Es war wunderschön so nackt auf einem Stein zu liegen und sich von der Sonne trocknen zu lassen. Wir lagen so dicht beieinander, dass sich unsere Körper berührten. Wir schauten uns dabei in die Augen und legten die Arme gegenseitig über unsere Schultern.
„Ich bin so froh, dass Du hier bist“, sagte Norman und küsste mir auf die Stirn.
Ich schloss die Augen und genoss den leidenschaftlichen Kuss, der jetzt folgte. Nach einer Weile richtete sich Norman auf. „Ich würde ja gerne noch länger mit Dir hier liegen aber wenn wir uns jetzt nicht bald anziehen, bekommen wir einen Sonnenbrand.“
„Schade“, sagte ich aber ich sah ein, dass er recht hatte.
Im Camp zogen wir uns die leichten Jogginganzüge an und kletterten auf den Hügel. Als erstes blickten wir auf die Landschaft und Norman zeigte mir die Stelle am Fluss, wo wir eben gebadet hatten.
Ich half ihm beim Feuermachen und anschließend beim Reinigen der heißen Stahlplatte. Ich sagte ihm, dass ich diese Art des Grillens oder Bratens ganz interessant fände, weil ich aus Deutschland nur die Art mit Holzkohle und Rost kennen würde.
Norman war neugierig und gab zu, dass er zwar vieles über Europa gehört hätte aber im Grunde gar nichts von Deutschland wüsste außer über die Rolle Deutschlands im zweiten Weltkrieg.
Auf diese Weise konnte ich ihm ein wenig über mein Heimatland erzählen und ich ließ auch eine Folge des Krieges, nämlich die Teilung des Landes mit der Mauer nicht aus.
„Es muss schön sein in einem Land zu leben in dem man geboren ist und das man mag“, folgerte er aus meinen Schilderungen.
„Ja, “ sagte ich, „aber was denkst Du über Dich wenn Du das sagst?“
Er wiegte den Kopf. „Ich bin Amerikaner und bin stolz darauf obwohl ich dieses Land kaum kenne.“
Später, als wir gegessen hatten, saßen wir vor dem Feuer. Diesmal hatten wir eine Decke mitgebracht, die nun auf dem Boden lag. Norman hatte seinen Arm auf meine Schulter gelegt und ich meinen um seine Taille.
„Freust Du dich auf morgen?“ fragte er.
„Ja“, antwortete ich. „Ich will doch so gerne fliegen und außerdem kann ich endlich die neuen Sachen anziehen.“
Norman zog mich noch etwas näher zu sich. „Ist es eigentlich teuer eine Fluglizenz zu machen?“
„Es kostet schon eine Menge Geld aber auch Zeit und viel theoretischen Unterricht.“
„Dann kann sich das wohl nur ein Sohn von wohlhabenden Eltern leisten, oder?“
„Nein, das stimmt nicht. Meine Eltern sind nicht wohlhabend, “ erklärte ich ihm. „Ich habe drei jüngere Brüder und mein Vater und meine Mutter haben viel arbeiten müssen, um für unser Haus und unsere Familie zu sorgen. Das Geld für die Fluglizenz und für die Reise nach Afrika habe ich mir ganz alleine verdient.“
„Was hast Du gemacht?“
Ich erzählte ihm von meinen Jobs, die ich neben der Schule und in den Ferien gemacht hatte und dass ich meiner Mutter manchmal noch etwas zum Haushaltsgeld beigesteuert hatte, damit sie sich auch mal etwas leisten konnte.
„Magst Du deine Mutter sehr?“
Ich hatte nie so richtig darüber nachgedacht aber auf die direkte Frage kam für mich nur eine Antwort infrage. „Ja und in letzter Zeit verstehen wir uns immer besser.“
„Das ist gut“, meinte Norman und es klang ziemlich traurig.
Ich hielt es für klüger seine Mutter in diesem Moment nicht zu erwähnen und das war vielleicht richtig.
Nach einer Weile erkannte ich wieder ein Lächeln in seinem Gesicht. Die letzten Flammen erloschen und nur die Glut leuchtete noch ein wenig.
Wenn man den, den man liebt nicht mehr sieht und nur noch spürt, ist es ein besonders intensives Gefühl. Vielleicht ging es Norman auch so. Ich spürte wie seine Hände meinen Körper erforschten. Das machte mir Mut bei ihm das gleiche zu tun. Alles stand Kopf in mir und ein ungeahntes Glücksgefühl machte sich breit. Wir lagen mal nebeneinander und mal übereinander auf der Decke. Unsere Hände schoben sich unter den Trainingsanzug auf die nackte Haut und streiften die störenden Kleidungsstücke nach und nach ab. Wir gaben uns dem Verlangen hin unsere nackten, heißen Körper zu liebkosen. Ich konnte nicht genug von Normans samtweicher Haut spüren. Seine Lippen und seine Zunge arbeiteten sich langsam von der Schulter zum Bauchnabel voran. Das Kitzeln seiner winzigen Bartstoppeln ließ meinen Körper durch und durch kribbeln und beben. Als er die Innenseite meiner Oberschenkel erreicht hatte, konnte ich es kaum noch aushalten. Ich beugte mich vor und ertastete seine Arme, auf die er sich abstützte. Daran hielt ich mich fest und dreht mich so herum, dass ich auch an seine Oberschenkel herankam. Ich wollte, dass wir das irre Gefühl gleichzeitig hatten.
Meine Lippen ertasteten seine Eier und sogen sie vorsichtig in den Mund. Das hatte er sehr gerne, denn er stöhnte so ermunternd dabei. Währenddessen machte er das gleiche bei mir und fuhr mit einem Finger in die Ritze zwischen meine Pobacken. Das machte mich ganz kribbelig und ich versuchte ihn davon abzulenken, indem ich mich um seinen steifen Schwanz zu kümmern begann.
Das tat er nun bei mir auch aber sein Finger spielte weiter an meiner Rosette und überwand schließlich meinen Schließmuskel. Ich zuckte dabei zusammen.
„Tut Dir das weh?“ fragte Norman besorgt.
„Nein“, beruhigte ich ihn. „Es ist nur so – so ungewohnt.“
Sein Finger steckte noch in mir.
„Sag mir wenn Du es nicht magst“, flüsterte er.
„Ist schon okay“, gab ich zurück und nahm sein bestes Stück wieder zwischen meine Lippen.
Es war wieder eine neue Erfahrung, vorne geblasen und hinten von einem Finger gefickt zu werden. Als ich mich daran gewöhnt hatte, fand ich es sogar ziemlich geil.
Es dauerte nicht lange, bis wir mit bebenden Körpern beinahe gleichzeitig im Mund des anderen abspritzten.
Nach diesem unvergesslichen Höhepunkt unter freiem Himmel waren wir beide schweißgebadet und rangen nach Atem. Norman zog mich an sich und hielt mich ganz fest. Er küsste mein Gesicht ab und raunte: „Es ist wahnsinnig schön mit dir.“
Als Antwort schlang ich meine Arme um seinen Hals und gab ihm einen sehr ausdauernden Zungenkuss.
In unserer Unterkunft angekommen, stiegen wir gemeinsam unter die Dusche. Das war zwar ziemlich eng aber es machte Spaß sich gegenseitig einzuseifen, die Haare zu waschen und am Ende abzutrocknen.
Unter der kuscheligen Bettdecke schmiegten wir uns eng aneinander und schmusten eine Weile. Ich war sehr glücklich und Norman sicherlich auch.
Norman war vor mir eingeschlafen und ich dachte eine Weile über uns nach. Die Erfahrung von heute machte mir klar, dass er meinen Hintern und mein Loch wohl nur mit dem Finger erkundet hatte, um mich früher oder später richtig zu ficken. Einerseits fand ich den Gedanken daran ziemlich aufregend. Ich hatte schon viel darüber gelesen aber vor seinem ziemlich großen Schwanz hatte ich schon ein bisschen Angst.
Als Norman mich weckte, hatte ich die allmorgendliche Mühe, mich mit dem Wachsein zu Recht zu finden. Allmählich fiel mir ein, dass heute mein erster eigenverantwortlicher Flug in Afrika bevorstand. Deshalb beeilte ich mich im Bad und zog anschließend einen der nagelneuen Overalls und die Pilotenstiefel an.
„Sieht stark aus“, lobte Norman, dessen Overall etwas verwaschener war als meiner.
Gewöhnlich konnte ich zum ersten Frühstück nicht viel essen. Norman bestand aber auf einem kräftigen Frühstück, weil der Flug nach Cameia ziemlich lang war und ich erst in sechs bis sieben Stunden wieder etwas zu essen bekommen würde. Manchmal konnte er richtig autoritär sein und dann hielt ich es für besser, mich zu fügen.
Auf dem Weg zum Hangar schob sich die Sonne langsam am Horizont empor. Meine Maschine die `Anny` war bereits aus dem Hangar geschoben und Sam begrüßte uns, als wir aus dem Wagen stiegen.
„Na, mein Junge bist Du aufgeregt?“ fragte Sam.
„Ja ein bisschen“, gab ich zu.
Während ich die Maschine überprüfte, wuchtete Norman die Kiste mit der Fracht in den Laderaum und holte anschließend ein schweres Jagdgewehr aus dem Wagen. Ich schaute ihn überrascht an, als er es in den Laderaum legte.
„Für alle Fälle. Man kann ja nie wissen, ob man es braucht, “ erklärte er.
Ich schnallte mich an und legte mir die Karten zurecht.
„Toy toy toy“, rief Sam und ich schloss die Einstiegstür, nachdem ich mich bedankt hatte.
Nach dem Start fühlte ich mich richtig frei. Wir hatten die Sonne im Rücken und deshalb eine phantastische Sicht. Ich wählte eine Flughöhe von etwa fünfhundert Metern über Grund und hielt Ausschau nach Punkten, die ich mir bei meinem Einweisungsflug gemerkt hatte.
Ich war viel gelöster und nahm viel mehr von dem wahr, was ich am Boden sehen konnte.
„Freust Du dich?“ Norman hatte wie ich einen Kopfhörer mit Mikrofon aufgesetzt, womit man sich trotz des Motorenlärms gut verständigen konnte.
Ich schaute zu ihm herüber. „Klar freue ich mich. Bist Du eigentlich schon oft mitgeflogen?“
„Ja früher, wenn ich in den Ferien hier war. In letzter Zeit nur noch auf den Kurierflügen nach Lubumbashi.“
Unterwegs zeigte mir Norman einige Besonderheiten wie Wasserstellen an denen man Wild beobachten konnte wenn man genau hinsah oder beliebte Futterplätze und Safarihütten.
Es machte viel mehr Spaß als mit Steve zu fliegen und mit der Unterhaltung wurde die Zeit nicht so lang.
In Cameia fand ich den Landestreifen sofort wieder. Da niemand auf uns wartete, gingen wir in die Hütte, wo die Männer an einem Tisch saßen und Tee tranken. Sie erkannten mich vom letzten Flug und ich stellte ihnen Norman vor. „Das ist Norman, mein Boss, der mich auf den Flügen begleitet.“
Einer der Männer drehte sich um. „Ich denke der Pilot ist immer der Boss.“
„Ja im Flugzeug ist das auch so“, erklärte ich und warf Norman einen bedeutungsvollen Blick zu.
Wir setzten uns und bekamen zwei Becher und eine Kanne Tee hingestellt. dass der Tee gut schmeckte, kann ich nicht sagen aber ich trank zwei Becher hintereinander aus. Inzwischen waren die Männer draußen am Flugzeug. Die rundliche Frau brachte uns das Mittagessen, welches aus Reiskuchen und gebratenem Fleisch bestand.
„Hier ist es schön ruhig“, meinte Norman.
„Ja, viel schöner als in Cabora Bassa, “ pflichtete ich ihm bei.
„Da war ich auch schon lange nicht mehr.“ Norman streckte sich und schob seinen Teller beiseite.
Wir tranken noch einen Becher Tee und gingen zu unserem Flieger hinaus. Der Rückflug war abgesehen von der Hitze problemlos. Norman hatte nichts dagegen, wenn ich einige Meilen vom Kurs abwich, um mir das eine oder andere anzuschauen. Zwischendurch probierte ich den Radiokompass und die auf der Karte vermerkten Frequenzen. Es klappte und so konnte ich ein wenig damit üben und Norman erklären wie das mit den Peilungen funktionierte.
Am nächsten Tag ging es dann auf die Südostroute. Kurz vor dem Ziel schaute sich Norman interessiert die riesige Baustelle des Staudammes an, bevor ich landete. Ich mochte diese staubige Landepiste mit ihrem Barackendorf nicht besonders. Man musste höllisch aufpassen, dass nicht gerade vor der Landung ein Fahrzeug quer über die Piste fuhr. Und überall waren merkwürdige Typen unterwegs, von denen man nicht wissen konnte, was sie dort zu tun hatten.
Ich suchte die Baracke, in der ich mit Steve gewesen war und stellte die Maschine ab. Da ich keinen der Männer wieder erkannte, musste ich mich mühsam durchfragen, bis wir jemanden fanden, der uns weiterhalf. Es war sehr unpersönlich und Norman schüttelte mehrfach den Kopf über dieses Durcheinander. Während er sich darum kümmerte, etwas Essbares zu bekommen, achtete ich auf die Typen, die unser Flugzeug betankten.
Endlich war es soweit und wir konnten uns an einem Tisch niederlassen, um den pappigen Kantinenfraß zu versuchen. Wir mochten ihn beide nicht und machten uns bald wieder auf den Rückweg.
Das einzig schöne an der Südostroute war die andersartige und abwechslungsreichere Landschaft und die Tatsache, dass die Flugzeit pro Strecke nur etwa drei Stunden betrug. So waren wir bereits am frühen Nachmittag in Kabunda und hatten noch etwas Zeit bis zum Training und Abendessen. Manchmal konnte ich Norman an solchen Nachmittagen dafür begeistern, mit mir schwimmen zu gehen.
Eine Woche später waren wir aus Cabora Bassa zurück und trainierten im Kraftraum. Gegen Ende der Stunde machten wir noch einige gemeinsame Übungen auf der Bodenmatte und ich war schon ziemlich ausgepowert. Von den gegenseitigen Berührungen hatten wir beide eine ziemliche Beule in der Trainingshose und Norman beendete das Programm, indem er mich auf sich rollte und mir einen Kuss gab und meinen Nacken kraulte.
„Ich will Dich jetzt und hier“, raunte er.
„Ja Norman“, keuchte ich und ehe ich mich versah, hatte er mein T-Shirt über meinen Kopf gezogen und seine Hände in meiner Trainingshose versenkt. Während sich die Hände in meinen Slip vortasteten, zog ich sein T-Shirt aus und knabberte an seinen Brustwarzen. Das brachte ihn so richtig in Fahrt und mit einer schwungvollen Bewegung hatte er mir die Trainingshose samt Slip über die Turnschuhe gezogen und mich dabei so umgedreht, dass ich mit der Brust auf seinen Beinen und mit dem Kopf zwischen seinen Füßen lag. Er nahm meine Schenkel, spreizte sie, umfasste mit einer Hand vorsichtig meinen Sack und begann mit der anderen meine Pobacken zu massieren.
Als ich meine plötzliche Lage begriffen hatte, begann ich seine Turnschuhe und seine Socken auszuziehen. Als ich das geschafft hatte, hob mich Norman kurz an und schob mir seine Trainingshose und seinen Slip entgegen, die ich dann über seine Füße abstreifte. Ich spürte nun seinen harten Schwanz zwischen meinen Schenkeln und seine Hände auf meinem Hintern. Ich wollte auch etwas tun und so drehte ich meinen Kopf und begann Normans Füße zu lecken.
Nach dem Tag und dem Training waren sie zwar verschwitzt und schmeckten etwas salzig aber das machte mir nichts aus. Ich hörte, dass Norman wohlig stöhnte und spürte, wie sich sein Finger in meine Rosette bohrte. Nach einer Weile zog mich Norman ein Stück zurück in die so genannte 69er Position. Und wir begannen uns gegenseitig die Schwänze zu verwöhnen.
Lange dauerte es aber nicht. Norman hob meinen Kopf und keuchte: „Komm neben mich.“
Etwas enttäuscht ließ ich von seinem Schwanz ab und krabbelte auf der Matte an seine Seite. Normans Arm drückte mich an seinen Körper zu einem intensiven Kuss.
Ich spürte, dass Norman ganz heiß war.
Nach dem Kuss schaute er mich ganz erwartungsvoll an. „Lässt Du mir Dein geiles Hinterteil?“
Ich schluckte. Oh je, jetzt war es also soweit.
Ich schaute ihn an. „Bitte sei vorsichtig Norman. Du bist so groß.“
Er nickte. „Ich werde vorsichtig sein. Das verspreche ich Dir.“
Dann zeigte er mir die gewünschte Stellung und ich kniete mich mit gespreizten Beinen auf die Matte, beugte mich nach vorn und stützte mich auf die Ellenbogen. Norman holte eine Flasche Massageöl, verrieb eine Hand voll an meiner Rosette und massierte es mit einem Finger in meinem Loch. Anschließend rieb er eine Handvoll auf sein steifes Rohr und redete auf mich ein, ganz entspannt zu sein.
Als ich sein bestes Stück zwischen meinen Arschbacken spürte, schloss ich die Augen. Mit beiden Händen zog er mein Hinterteil auseinander und dann presste seine Eichel gegen meinen Schließmuskel.
Zuerst wollte es nicht klappen aber dann drang er ein Stück ein. Ein stechender Schmerz ließ mich aufstöhnen. Norman hielt an und streichelte mir beruhigend den Rücken. Dann begann er wieder ein Stück weiter einzudringen und ich biss die Zähne aufeinander.
Stück für Stück drang sein Schwanz tiefer in mich ein und ab einem bestimmten Punkt gesellte sich zu meinem Schmerz ein nie gekanntes Lustgefühl.
„Geschafft“, keuchte Norman und ich presste mein Gesicht auf die Matte.
Ich durfte gar nicht daran denken, dass sein mächtiges Teil jetzt ganz in mir steckte aber ich spürte es irgendwie.
Langsam und vorsichtig begann er ihn zurück und wieder vorzuschieben. Es war ein komisches Gefühl aber es verursachte keine zusätzlichen Schmerzen. Ich versuchte mich daran zu gewöhnen und ruhig zu atmen. Norman stöhnte leise und jedes Mal wenn er ganz drin war, küsste er mir den Nacken.
Langsam merkte ich, dass sein Schwanz bei seinen Bewegungen etwas in mir reizte, was auch mir ein Lustgefühl verschaffte und so entfuhr mir, als er wieder einmal eindrang, ein: „Ohh jaaa.“
Jetzt verlor Norman seine Hemmungen und stieß fester zu. Ich musste in den Ellenbogen mehr Kraft aufwenden, damit er mich nicht umwarf aber es war geil, wie er dabei stöhnte und immer schneller wurde.
Norman wurde immer wilder und ich konnte mich kaum noch halten. Dann mündete sein Stöhnen in einen lauten Schrei und seine Bewegungen stoppten. Ich fühlte wie sein Schwanz in mir zuckte und seine Ladung in mein tiefstes Inneres pumpte. Obwohl ich nass geschwitzt war, bekam ich eine Gänsehaut.
Norman verweilte noch einen Moment in mir, bis er wieder zu Atem gekommen war. Er säuberte sich und mein Hinterteil mit einem Handtuch, drehte mich auf den Rücken und beugte sich über mich.
„Oh Mann war das geil“, sagte er mit funkelnden Augen und gab mir einen Kuss.
Ich bemühte mich um ein mattes Lächeln. Jetzt kümmerte sich Norman um mich. Mein Lustspender wusste wohl offensichtlich nicht was er wollte. Während des Ficks war er mal schlaff geworden und jetzt drängte er wieder zu voller Größe.
Nach einem sehr zärtlichen Vorspiel blies mir Norman einen, dass mir Hören und Sehen verging. Er holte alles aus mir heraus und ich lag am Ende total k.o. auf der Matte. Ich wusste bisher noch nicht, dass Sex so anstrengend sein kann.
Beim Aufstehen spürte ich ein Ziehen im Hintern. Ich hatte immer das Gefühl, als steckte noch etwas drin. Meine Beine waren ganz zitterig.
Norman half mir beim Anziehen und fragte, ob alles in Ordnung sei.
„Na ja, es geht schon wieder, “ antwortete ich und deutete auf mein Hinterteil. „Gut, dass ich morgen nicht fliegen muss.“
Er war ziemlich besorgt und hatte wohl ein bisschen Angst, dass er beim ersten Mal zu heftig mit mir umgegangen sei. Ich versuchte ihm die Sorge zu nehmen. Es war zwar am Anfang ziemlich hart aber alles in allem hatte es mir doch noch Spaß gemacht.
Am Abend war Norman rührend lieb zu mir. Wir gingen früh ins Bett und kuschelten sehr zärtlich, bis ich in einen tiefen Schlaf fiel.
Die ersten drei Wochen vergingen sehr schnell. Das Wetter war gut, die Flüge verliefen reibungslos und das Fliegen machte mir großen Spaß.
Mit Norman kam ich sehr gut zurecht. Während unserer Flüge waren wir so etwas wie Kollegen und in unserer Freizeit waren wir ein Herz und eine Seele. Manchmal war er der große Bruder, der mich beschützte und vor Unüberlegtheiten bewahrte, manchmal der gute Freund, dem immer etwas einfiel, damit es uns nicht langweilig wurde. Ich liebte und bewunderte ihn. Norman wurde für mich der Inbegriff der Geborgenheit. Es war immer aufregend in seiner Nähe zu sein, mit ihm romantische Stunden zu verbringen und nicht zuletzt auch heißen Sex zu erleben. Mein Bett war seit der ersten Nacht mit ihm unbenutzt geblieben und mein Zimmer diente mir fast ausschließlich zum Aufbewahren meiner wenigen Sachen und meiner Kleidung. Besonders bequem war der Service mit der Wäsche. Alles was ich abends auszog, legte ich in einen Korb im Flur. Das wurde am nächsten Morgen abgeholt und lag zwei Tage später gewaschen und gebügelt wieder da.
Immer mittwochs, wenn Norman seinen Bruder in Lubumbashi besuchte, verbrachte ich den Tag bei Sam im Hangar. Ich half ihm bei den Wartungsarbeiten und genoss es, wenn wir in seinem Magazin saßen, Malzkaffee tranken und er mir von seiner Militärzeit erzählte.
Es war bereits der vierte Mittwoch. Der Kurierflug kam am späten Nachmittag aus Lubumbashi zurück. Norman hatte mir ein Buch mitgebracht. Es war ein Roman, der in Afrika spielte. Das Foto auf dem Einband sah sehr viel versprechend aus.
Nach dem Abendessen saßen wir draußen hinter unserer Unterkunft. Ich hatte mich quer auf die Bank und meinen Kopf auf seinen Schoß gelegt.
„Ich soll dich von Jason grüßen. Er hat übrigens das Buch für dich gekauft.“
Ich schaute zu Norman hoch. „Dein Bruder kennt mich doch gar nicht.“
„Doch. Ich habe ihm viel von dir erzählt.“
„Weiß er Bescheid?“
„Worüber?“
„Zum Beispiel, dass ich mit dir in einem Bett schlafe?“
Norman lachte. „Na klar. Wir können über alles miteinander reden.“
„Schön. Ich glaube nicht, dass ich mit meinen Brüdern darüber reden könnte.“
„Könntest Du denn mit deinen Eltern darüber reden?“
„Das muss ich wohl eines Tages.“
„Glaubst Du sie würden es nicht akzeptieren, dass Du schwul bist?“
Ich holte tief Luft. Die Frage war mir schon oft durch den Kopf gegangen. „Ich glaube nicht, dass sie mich deshalb verstoßen würden aber es wäre sicher ein harter Schlag für sie. Besonders für meinen Vater.“
„Ich glaube mein Vater ahnt es bei mir aber wir reden nicht darüber. Wir reden nie über Gefühle. Vielleicht ist das der Grund, warum Jason und ich es tun.“
„Ich habe mir manchmal einen großen Bruder gewünscht wie du.“
Norman lächelte. „Ich glaube ich weiß was Du meinst. Es ist nicht immer leicht der große Bruder zu sein, oder?“
„Ja, stimmt“, gab ich zu.
Norman spielte mit meinen Haaren, die inzwischen schon so lang waren, dass ich normalerweise schon längst zum Friseur gegangen wäre. Ich spürte, dass ihn etwas bewegte. „Micha, sag mal ehrlich. Gefällt es dir hier in Kabunda?“
Mich überraschte seine Frage. „Ja es gefällt mir. Als ich in Lubumbashi im Gefängnis war, hätte ich mir nicht träumen lassen, dass mir ein Job hier so gut gefallen könnte.“
„Willst Du nicht länger bleiben? Die vier Wochen sind schon bald vorbei.“
Daran hatte ich noch gar nicht gedacht. Die Zeit war so schnell vergangen und in Lubumbashi hatte ich gar keine konkreten Vorstellungen von einem Job.
„Möchtest Du, dass ich länger bleibe?“
Norman kniff mir in mein Ohrläppchen. „Da fragst Du noch? Klar möchte ich, dass Du bleibst. Wie viel Zeit hast Du noch?“
„Ich wollte noch nach Botswana, Namibia, Kenia und Tansania und Weihnachten wieder zuhause sein“, antwortete ich.
„Ja ich verstehe“, sagte Norman traurig.
Ich überlegte eine Weile. „Wenn ich länger bleibe verdiene ich genug Geld, dass ich nächstes Jahr noch einmal nach Afrika kommen kann.“
Normans Augen begannen zu leuchten. „Heißt das, du bleibst den Rest deiner Zeit hier?“
„Wenn Du mich so lange ertragen kannst?“
Norman stieß einen Freudenschrei aus und küsste mir auf die Stirn. „Das ist super“, rief er, fasste mir um die Taille, stand auf und wirbelte mich durch die Luft. Statt mich wieder herunterzulassen, trug er mich wie einen Teddybär in sein Zimmer und legte mich auf das Bett.
Ich kam gar nicht dazu, über meine Entscheidung nachzudenken und ich wollte es auch nicht. Der Rest dieses Abends war einfach zu schön.
Am nächsten Morgen weckte mich Norman schon ganz früh. Es war unser freier Tag und ich wollte noch schlafen.
„Komm, frag nicht viel und steh auf“, sagte er und zog mir die Bettdecke weg. Er mochte es gern, wenn ich keine Ahnung hatte und nur widerstrebend tat was er wollte. Entsprechend brummig war ich, als ich mich anzog.
Es war noch dunkel und ich dachte ich sei im falschen Film weil Norman nicht den Weg zur Kantine, sondern zu unserem Hügel einschlug.
„Ich mag so früh noch keine T-Bone-Steaks“, gab ich zu Bedenken.
Norman lachte nur und schob mich die steile Böschung hinauf. Oben angekommen, zeigte er in die Richtung, wo sich allmählich der Sonnenaufgang abzeichnete. Wir setzten uns auf ein Stück Holz und beobachteten von diesem Logenplatz, wie sich die Sonne erst glutrot und dann immer heller werdend, langsam am Horizont erhob. Es war ebenso aufregend zu beobachten wie ein Sonnenuntergang. Nur die Stimmung war anders, weil nun wieder ein Tag vor uns lag.
Das Schauspiel dauerte nur eine Viertelstunde. Dann stand Norman auf und deutete hinter sich. Ich rieb mir die Augen, denn dort lag eine Decke, auf der ein komplettes Frühstück ausgebreitet war.
„Waau, wann hast Du das denn gemacht?“ fragte ich total überrascht.
„Ich bin eine Stunde früher aufgestanden als Du und weil wir heute noch etwas vorhaben, musste ich mir etwas einfallen lassen, damit ich dich aus dem Bett kriege.“
„Du bist unmöglich“, sagte ich und konnte ein Gähnen nicht unterdrücken.
Norman quittierte meine Bemerkung mit einem breiten aber lieben Grinsen.
Ich nahm mir die Kanne und goss Kaffee in unsere Becher. „Darf ich auch wissen, was wir heute vorhaben?“
Norman nahm den Becher, den ich ihm reichte und nickte. „Heute ist der vierte Donnerstag im Monat. Da fahre ich immer zu den van de Waals. Das ist die Farm, von der ich dir schon erzählt habe.“
„Du meinst die, die einen Sohn haben, mit dem Du die Ferien verbracht hast?“
„Ja genau. Philippe ist aber nicht mehr da. Er studiert in Belgien.“
„Schade“, fand ich. „Was machen wir auf der Farm?“
„Wir holen frische Lebensmittel für unsere Kantine“, erklärte Norman.
Während des Frühstücks freute ich mich schon, denn jeder Ausflug war eine willkommene Abwechslung für mich.
Der Weg führte nicht nach Kabunda, sondern nach Süden. Ein Teil der Strecke führte durch dichten Wald. Unterwegs erzählte mir Norman von seinem Freund Philippe und was sie gemeinsam alles erlebt hatten. Sie waren oft mit Phillipes Vater oder einem seiner Leute unterwegs gewesen um Zäune zu kontrollieren, Rinder auf eine andere Weide zu bringen oder auch einmal Geburtshilfe zu leisten. Dabei hatte Norman auch gelernt, wie man mit einem Jagdgewehr umging und was zu beachten ist, wenn in freier Natur übernachtet werden muss.
Nach eineinhalb Stunden endete die Baumlandschaft. Kilometerweite Felder mit Mais, Soja, Getreide und Maniok waren zusehen.
„Das gehört alles schon zur Farm“, erklärte Norman und bog in einen schmaleren Weg ein.
Wir hatten noch eine halbe Stunde zu fahren, bis wir eine parkähnliche Anlage mit einem prächtigen weiß gestrichenen Haus erreichten. Ich staunte nicht schlecht, wie prachtvoll das Anwesen wirkte. Norman stellte den Wagen auf dem Vorhof ab. Nachdem wir ausgestiegen waren, kam ein großer Hund auf uns zu. Norman kannte den Hund sehr gut und entsprechend wurde er von „Claire“ begrüßt. Ich wurde nur flüchtig beschnuppert und dann trottete der Riesenschnauzer zum Haus.
Wir folgten einem mit Steinplatten ausgelegten Weg zwischen hohen Hecken und gelangten zum Haupteingang. An der linken Haushälfte rankten riesige Kletterrosen und dort entdeckten wir die Hausherrin. Frau van de Waal war eine große Frau, etwa Mitte Vierzig. Sie trug ein einfaches knielanges Kleid und eine Schürze darüber. Sie legte die Rosenschere beiseite und kam mit freundlicher Mine auf uns zu.
„Hallo Norman, mein Junge. Schön, dass Du wieder einmal hier bist.“
Norman begrüßte sie, wie ich es von Franzosen kannte. Ein Mal die linke Wange und einmal die rechte Wange. Dann stellte er mich vor. „Das ist Micha. Er ist Pilot und fliegt eine Weile für uns.“
Frau van de Waal reichte mir die Hand. „Sie sind noch sehr jung für diesen Job.“
Bisher sprach sie französisch. Nachdem Norman erklärte, dass ich nur englisch und deutsch verstehen konnte, sprach sie ohne Mühe englisch und wiederholte was sie gesagt hatte.
Sie führte uns um die Hausecke auf eine Veranda, rief ein Hausmädchen und bot uns an, auf einer Sitzgruppe Platz zu nehmen.
Es war inzwischen zehn Uhr am Vormittag. Frau van de Waal sagte, ihr Mann sei unterwegs und würde zum Mittag wieder zurück sein. Wir sollten erst einmal ein zweites Frühstück bekommen.
Nach einigen üblichen Fragen an Norman, wie es in Kabunda wäre und was es neues von seinem Vater und von Jason gäbe, kam ich auch ins Gespräch. Die Gastgeberin hatte ein gebräuntes schmales Gesicht, was auch dadurch betont wurde, dass sie ihre dunklen langen Haare nach hinten gekämmt trug, wo ein lockerer Knoten von einem schmalen dunkelroten Tuch gehalten wurde.
Sie war überrascht, dass ich als junger Deutscher allein in Afrika war und hier als Pilot arbeitete. Nachdem ich ihr erklärt hatte, dass es sich nur zufällig ergeben hatte und ich eigentlich eine Reise vor meinem Studium machte, schien es ihr nicht mehr ganz so sonderbar.
Sie erzählte, dass ihr Sohn Philippe in Antwerpen studiere und die nächsten Semesterferien hier auf der Farm verbringen wolle.
Das Dienstmädchen servierte Tee und Sandwichs, die ganz köstlich schmeckten. Im Laufe der Unterhaltung erfuhr ich, dass die Eltern ihres Mannes in den zwanziger Jahren hier her gekommen waren, nachdem die belgische Regierung Anreize und Land für Farmen ausgelobt hatte. Sie selbst hatte ihren Mann während des Studiums in Lüttich kennen gelernt und sich schließlich entschlossen zu heiraten und mit ihrem Mann auf dieser Farm zu leben und zu arbeiten. Noch in diesem Jahr würden sie ihre silberne Hochzeit feiern. Sie beugte sich ein wenig zu uns herüber und sagte leise: „Ich habe meinen Mann inzwischen überredet, dass wir unsere Silberhochzeit in meiner Heimatstadt Antwerpen feiern aber das soll für Philippe und meine Mutter eine Überraschung werden.“
Norman grinste. „Keine Sorge, von uns erfährt es keiner.“
Die Zeit verging bei der angenehmen Unterhaltung wie im Fluge. Bald war es Mittag und Herr van de Waal kam mit einem schweren Geländewagen vorgefahren. Es war ein drahtiger großer Mann so um die fünfzig. Sein kurzes leicht lockiges Haar war schon leicht angegraut aber das passte zu seinem gegerbten Gesicht. Während mich Norman vorstellte, bekam ich den Eindruck, dass er zwar nicht sehr redselig aber freundlich war.
Nach dem Mittagessen auf der Veranda fuhr der Farmer mit uns zu den Stallungen und Scheunen, die sich etwas abseits des Hauses befanden. In den Ställen war Platz für etwa zwanzig Pferde, die bei der Bewirtschaftung dieser 5000 Hektar großen Farm trotz Geländewagen als Fortbewegungsmittel unverzichtbar waren. Die Scheunen dienten zur Abstellung und Wartung riesiger Traktoren und Mähdrescher. In einem separaten kleinen Gebäude brummte ein Generator für die gesamte Stromversorgung.
In diesem Land musste eine Farm so organisiert sein, dass sie in jeder Situation unabhängig ist und für die Lebensgrundlage von Mensch, Tier und Maschinen sorgen kann. Entsprechend stolz zeigte uns der Farmer den dritten und neuen Brunnen. Er wurde erst von wenigen Wochen neunzig Meter tief in die Erde gebohrt und lieferte fast genauso viel Wasser wie die beiden alten Brunnen zusammen.
Herrn van de Waal schien es zu gefallen, dass ich ihm viele Fragen zu den landwirtschaftlichen Bedingungen stellte. Schließlich hatte ich in meiner Kindheit einiges gelernt, als es in meinem Heimatdorf noch zahlreiche Bauernhöfe gab.
Einer heimatlichen Tradition folgend, baute er hier auch Kartoffeln in kleineren Mengen an. Seine Frau unterhielt einen großen Garten in dem sie Kräuter und Gemüse anbaute, welche eher in Mitteleuropa als in Afrika heimisch waren.
Am Nachmittag hatte uns die Gastgeberin einen frischen Erdbeerkuchen angekündigt und uns angeboten, bis dahin den kleinen Swimmingpool an der anderen Seite des Hauses zu benutzen. Das war bei der Hitze ein tolles Angebot und ich zerrte Norman augenblicklich dorthin.
Da der Pool von schützenden Büschen umgeben war, zogen wir uns wie sonst am Luapula ganz aus und sprangen nackt in das kühle Wasser. Norman tauchte unter mir, fasste meine Schenkel und nahm meinen nur leicht erregten Schwanz in den Mund. Uhh, das war ein irres Gefühl. Als er prustend auftauchte, schüttelte ich mit dem Kopf. „Was ist, wenn uns jemand dabei sieht?“
Norman grinste. „Dann wird derjenige denken, dass mich der hübsche Micha mit seinem nackten Körper verführt hat und ganz neidisch sein.“
Mich ehrte sein Kompliment aber bevor er sich etwas Neues ausdenken konnte, schwamm ich zum Beckenrand. Norman holte mich kurz vor dem Ziel ein und gab mir einen Kuss.
Am späten Nachmittag, als die Sonne schon tief stand und die Temperaturen etwas zurück gingen, war es dann soweit die Lebensmittel aufzuladen.
Herr van de Waal hatte alles schon vorbereiten lassen. Wir bekamen Mehl, Mais, einige Säcke Kartoffeln und Maniok. Zum Schluss noch zwei Wannen in denen Plastiksäcke mit Rindfleisch auf Eis gelagert waren.
Unser Geländewagen war gut beladen, als wir uns verabschiedeten und für die Gastfreundschaft bedankten.
Auf der Rückfahrt beugte sich Norman zu mir hinüber. „Na, bist Du noch sauer, weil ich dich so früh aus dem Bett geschmissen habe?“
Ich schüttelte den Kopf. „Ich wäre auch gar nicht sauer gewesen, wenn Du mir vorher gesagt hättest was Du vor hast.“
Norman grinste. „Du bist doch so süß, wenn Du sauer bist.“
Dafür verpasste ich ihm einen nicht zu starken Hieb in die Seite.
Er lachte nur und sagte fröhlich: „Na warte bis wir zuhause sind.“
Die nächsten Tage bescherten uns unbeschwertes Fliegen und ich genoss jede Stunde, in der ich bei unserer Freizeit mit Norman zusammen war. Und egal wie kaputt ich mich manchmal fühlte, wenn ich nach einem langen Flug aus der Maschine kletterte, ich nahm es hin, dass er mit mir joggte und anschließend im Kraftraum mit mir trainierte. Wenn ich bei unseren Unterhaltungen nicht die richtigen Worte fand oder etwas falsch aussprach, lachte Norman und amüsierte sich köstlich. Dafür musste er mir aber das Richtige beibringen und so lernte ich immer mehr, die englische oder um genau zu sein die amerikanische Umgangssprache zu beherrschen.
An einem der nächsten freien Tage hatte Norman einen Mitarbeiter aus der Mine geholt, der mal irgendwann Friseur gewesen war. Er schnitt hier anscheinend jedem die Haare wenn es notwendig war und heute war ich an der Reihe.
Es war ein kräftiger Typ, den ich auf etwa fünfzig Jahre schätzte. Ich vermutete, dass er auch Amerikaner war. Als ich seine schwieligen Hände sah, war ich von seinen Fähigkeiten als Friseur nicht besonders überzeugt. Ich saß draußen auf einem Stuhl und versuchte zu erklären, wie ich die Haare geschnitten haben wollte aber er reagierte gar nicht darauf. Norman grinste nur. Der Typ kramte Kamm, Schere und ein Rasiermesser aus seiner Tasche und machte sich sofort über meinen Haarschopf her. Er redete so gut wie nichts.
Ich muss wohl ein sehr sorgenvolles Gesicht gemacht haben, als die ersten dicken Haarbüschel auf den Boden fielen, denn Norman machte eine beruhigende Geste.
Nach etwa zwanzig Minuten wetzte er sein Rasiermesser und rasierte mir den Nacken aus. Mit einem knappen: „das war’s“, verabschiedete er sich und Norman fuhr ihn zurück. Ich war auf alles gefasst als ich ins Bad stürmte, um mich im Spiegel zu betrachten. Im ersten Moment erschrak ich trotzdem. So kurz waren meine Haare noch nie aber um ehrlich zu sein, sah es so schlecht nicht aus. Je länger ich mich betrachtete und den Kopf drehte, desto mehr wurde mir bewusst, dass ich nun den gleichen Haarschnitt trug, den Norman, Steve und offensichtlich jeder hier im Camp irgendwann einmal verpasst bekam.
Kapitel 2
So sehr ich die Flüge von und nach Cabora Bassa auch mochte, der Aufenthalt dort war mir immer ein Gräuel. Inzwischen hatten wir die Männer ein wenig näher kennen gelernt, mit denen wir dort zu tun hatten. Sie sorgten eigentlich nur dafür, dass unsere Fracht an ihr Ziel kam. Wohin, das wusste ich nicht und ich war mir auch nicht sicher, ob Norman das wusste.
Eines Tages saßen wir in der Baracke und mussten etwas länger als üblich auf unser Essen warten. Die Maschine war bereits aufgetankt und weil Norman das Essen nicht mochte oder keinen Appetit hatte, ging er vor mir nach draußen, um die leere Kiste zu verzurren.
Einige Minuten später folgte ich ihm und als ich um eine Ecke bog, sah ich einen der komischen Typen vor Norman stehen. Er stand mit dem Rücken zu mir und hielt etwas vor sich. Norman hatte die Hände halb erhoben und sagte etwas zu ihm. Ich bewegte mich vorsichtig, da mir die Sache nicht geheuer war. Etwas von der Seite konnte ich sehen, dass der Typ eine Pistole vor sich hielt. Ich wusste, dass Norman mich gesehen hatte aber sein Blick verriet mir, dass mich der Typ besser nicht bemerken sollte. Ich überlegte einen Augenblick was ich tun könnte und schaute mich um. Mein Blick blieb kurz an einer Schaufel hängen, die an eine der Baracken gelehnt war. Ich schlich mich hin, nahm sie fest in die Hände und prüfte das Gewicht. Dann holte ich tief Luft, lief lautlos von hinten an den Typ heran und holte dabei mit der Schaufel weit aus. Mit ganzer Kraft schlug ich ihm seitlich in die Beine. Ich schlug sie ihm buchstäblich unter dem Körper weg und er krachte mit einem hohlen Schrei auf den Boden. Die Pistole ließ er dabei fallen und ich zog sie mit der Schaufel zu mir. Norman warf mir einen dankbaren Blick zu und bedeutete mir, mich jetzt zurückzuhalten.
Der Typ rappelte sich langsam auf und machte Anstalten auf Norman loszugehen. Mir schien, als hätte der nur darauf gewartet. Einem ersten Schlag wich Norman elegant aus und ging dann zum Angriff über. Normans erster Schlag traf den Angreifer an die Brust und der nächste folgte mit der Rechten voll aufs Kinn. Der Typ torkelte zurück und ging dann fast zu Boden. Norman wartete, bis er sich wieder aufrichtete und die Fäuste ballte. Diesmal kam ihm Norman zuvor. Es hagelte einen linken und einen rechten Haken und bevor der Typ fallen konnte, hatte er sich noch zwei weitere Schläge links und rechts am Kopf eingefangen. Er fiel um wie ein nasser Sack. Normans Kopf war rot angelaufen. Ich hatte ihn noch nie so wütend gesehen.
Als der Typ noch einmal vergebliche Anstalten machte, sich zu erheben, verpasste ihm Norman einen kräftigen Tritt in die Seite.
„Norman hör auf!“ schrie ich. „Du bringst ihn ja um.“
Er schaute mich an, atmete ganz tief durch und ließ von ihm ab. Ich war heilfroh, dass sich bei meiner Aktion kein Schuss gelöst hatte aber jetzt wusste ich auch, dass selbst ein großer und kräftiger Mann kaum eine Chance hatte, wenn Norman mit seiner Kraft und seiner Technik in Wut geriet.
Norman kam langsam zu mir, nahm die Pistole, sicherte sie und steckte sie ein. „Komm, Lass uns gehen“, sagte er und legte seinen Arm auf meine Schulter. Auf dem Weg zum Flugzeug regte er sich langsam ab. Ein paar Arbeiter, die zwischenzeitlich in die Nähe gekommen waren, kümmerten sich um den Typen.
Bevor ich den Motor startete, klopfte mir Norman auf die Schulter und sagte: „Gut gemacht Kleiner.“
Normalerweise hasste ich es wenn er `Kleiner` zu mir sagte aber diesmal protestierte ich nicht dagegen.
Erst am Abend in der Kantine sprachen wir wieder über den Vorfall.
„Was wollte der Typ von Dir?“ fragte ich.
Norman zog eine verächtliche Mine. „Geld wollte der. Dollars oder Peseten.“ Dann fing er an zu lachen. „Ich dachte erst, Du haust ihm mit der Schaufel an den Kopf oder an den Arm aber gegen die Beine, das war irre. Du hattest auch einen guten Schlag drauf.“
„Das hättest Du mir wohl nicht zugetraut aber ich hatte einfach Angst um Dich“, gab ich zu.
Ich war ein bisschen stolz auf meine Tat und an diesem Abend hatten wir beide das Gefühl, ein unschlagbares Team zu sein und das bewiesen wir uns dann auch im Bett.
Einer unserer nächsten Flüge ging nach Cameia. Ich flog mit der `Paula`, da meine Maschine für einen Ölwechsel fällig war. Auf dem Rückflug, kurz nachdem wir die Grenze von Angola nach Zaire überflogen hatten, spürte ich einen Leistungsabfall des Motors. Ich gab mehr Gas und die Drehzahl stieg wieder an, um bald danach wieder abzufallen. Ich schaltete die elektrische Benzinpumpe zu und war erleichtert, dass sich die Drehzahl wieder stabilisierte. Deshalb nahm ich an, dass die mechanische Pumpe nicht mehr richtig arbeitete und flog normal weiter. Es dauerte aber keine fünf Minuten, bis sich der Leistungsabfall wiederholte. Ich schimpfte vor mich hin, während ich den Tankwahlschalter überprüfte und den Drehzahlmesser im Auge behielt.
„Was ist los?“ wollte Norman wissen.
„Der Motor hat nicht mehr genug Leistung“, sagte ich und tippte an den Drehzahlmesser.
„Hast Du eine Ahnung woran das liegen kann?“
Ich ging noch einmal alles durch aber dann bekam ich eine Ahnung.
„Ich glaube der Kraftstofffilter vor dem Vergaser ist verstopft. Wahrscheinlich Rostablagerungen aus den alten Benzinfässern.“
„Kommen wir damit bis nach Hause?“
Ich schaute mich schon nach einem geeigneten Gelände für eine Notlandung um.
„Nein“, sagte ich. „Ich muss landen. Es dauert wahrscheinlich nicht mehr lange bis der Motor ganz ausfällt.“
Jetzt begann Norman auch zu fluchen.
Etwa fünf Meilen halb rechts voraus fand ich ein freies Gelände. Es war eben und lang genug, um wieder starten zu können. Bei dem hohen Steppengras weiß man natürlich nie, ob sich Löcher oder große Steine am Boden befinden, die für das Fahrwerk gefährlich werden könnten aber das musste ich nun riskieren.
Ich teilte mir den Anflug ein und ließ den Gashebel unverändert bis ich sicher war, die anvisierte Stelle auch ohne Motorleistung zu erreichen. Ich sagte Norman, dass er seine Gurte festziehen und sich bei der Landung vorsichtshalber festhalten solle. Nun tat ich, was ich in der Theorie für solche Fälle gelernt hatte. Ich nahm das Gas zurück, unterbrach die Benzinzufuhr zwischen Tank und Vergaser, schaltete Zündung und Stromversorgung aus und ließ das Flugzeug mit voll ausgefahrenen Landeklappen auf das ausgesuchte Gelände schweben. Ich achtete darauf, die Maschine möglichst lange auf Grashalmhöhe zu halten, um dann mit absoluter Mindestgeschwindigkeit aufzusetzen. Der Untergrund war zwar holperig aber ich brachte die `Paula` nach zweihundert Metern unbeschadet zum Stehen.
Ich atmete erleichtert auf.
Norman seufzte, nachdem wir die Kopfhörer abgenommen hatten.
„Meinst Du, du kriegst sie wieder zum Laufen?“
„Wenn es das ist, was ich glaube müsste es klappen aber Lass mich doch erst einmal nachsehen“, versuchte ich ihn zu beruhigen.
Wir kletterten aus dem Flugzeug und ich nahm das Bordwerkzeug aus dem Laderaum. Zuerst montierte ich die Motorverkleidung ab, wobei mich Norman auf die Schulter nehmen musste, damit ich bei der Höhe des Triebwerks an alle Verschlüsse herankam. Als er mir die Verkleidungsteile abgenommen und neben sich auf das Gras gelegt hatte, bat ich ihn, mich wieder abzusetzen. Der Motor war noch zu heiß, um daran zu arbeiten.
Während der Stunde, in der wir den Motor abkühlen ließen, saß ich auf dem Rad und Norman in der Ladeluke. Wir tranken eine Flasche Wasser und ich erklärte ihm, dass ich den Kraftstoffilter abschrauben, mit Benzin auswaschen und wieder einbauen würde. Das klang sehr einfach und machte Norman zufrieden.
Um besser arbeiten zu können, stellten wir die Kiste mit der Notverpflegung und die leere Frachtkiste neben dem Motor übereinander und ich stieg hinauf. Der Filter war an einer Seite mit einer festen Zuleitung verschraubt, die aus einem Aluminiumrohr bestand. Auf der anderen Seite war er mit einem flexiblen Schlauch verschraubt, welcher zum Vergaser führte.
Zum Glück fand ich zwei gleiche Schraubenschlüssel, denn man musste eine Seite festhalten und die andere Seite losdrehen, um die Zuleitung nicht abzureißen. Ganz vorsichtig begann ich die Verschraubung zu lösen aber es bewegte sich nichts. Ich versuchte es mehrmals und gab dann je einen Tropfen Öl an die Gewindeansätze. Norman wurde schon ungeduldig und als es mir wieder nicht gelang, wollte er es versuchen. Ich zeigte ihm welche Verschraubung gelöst werden musste und warnte ihn, dass er mit seiner Kraft nicht die dünne Zuleitung abdrehen oder abknicken dürfe. Jetzt stand er oben und ich sah, wie er sich anstrengte. Er schaffte es auch nicht und jedes Mal wenn er einen neuen Versuch machte, hatte ich Angst um die Zuleitung.
Nach zwei Stunden mussten wir entnervt und nassgeschwitzt aufgeben. Wir tranken Wasser und Norman schaute auf die Uhr. Es war halb fünf. In eineinhalb Stunden würde es dunkel werden und wir wussten beide, dass wir bis dahin nicht mehr in die Luft kommen würden.
Norman schaute sich um. „Es wird Zeit, dass wir uns einen Platz zum Übernachten suchen.“
Ich spürte, dass er sauer war, obwohl er sich bemühte es sich nicht anmerken zu lassen.
Er ging voraus zu einer Baumgruppe. Hier fanden wir genug abgestorbenes Holz und einen Lagerplatz. Zuerst sammelten wir einen Haufen Holz und zerbrachen die Äste in Stücke. Als Norman meinte, dass es genug sei, holten wir die Kiste mit dem Notproviant, für jeden zwei Decken und das Gewehr aus dem Flugzeug. Rund um die geplante Feuerstelle entfernten wir das trockene Gras. Dann breiteten wir unsere Decken aus und warteten auf den Sonnenuntergang. Wir waren beide sehr niedergeschlagen und hatten noch keine Idee was wir morgen tun sollten.
Norman versuchte mich etwas aufzumuntern.
„Es ist das erste Mal, dass Du in der Wildnis übernachten musst oder?“
„Ja“, gab ich zu. „Du hast das sicher schon öfter erlebt.“
Norman nickte. „Mit Philippe und seinem Vater, wenn wir in den Ferien auf der Farm waren. Manchmal waren wir drei oder vier Tage unterwegs, um die Zäune zu reparieren und die Rinder zu kontrollieren. Da hätte es zu viel Zeit gekostet, jeden Abend zum Haus zurück zu reiten.“
Als es dunkel wurde, zündete Norman ein kleines Feuer an. Er erklärte mir, dass es bis zum Sonnenaufgang brennen müsse, um wilde Tiere fernzuhalten und um in der nächsten Umgebung wenigstens etwas sehen zu können.
Aus der Proviantkiste nahm er drei Eisenstangen, die er als Dreibeingestell zusammensteckte und über das Feuer stellte. Dann füllte er einen Blechtopf mit Wasser und hing ihn an dem Gestell über die Flammen. Mit dem kochenden Wasser brühten wir in einer großen Blechkanne Tee auf. Später öffnete Norman zwei Fleischkonserven und wärmte den Inhalt im Topf über dem Feuer. Als das Fleisch heiß war, stellte Norman den Topf zwischen unsere ausgebreiteten Decken. Auf dem Bauch liegend und mit den Ellenbogen abgestützt löffelten wir gemeinsam aus dem Topf und genehmigten uns anschließend je einen Becher Tee. Norman erklärte mir, dass wir abwechselnd zwei Stunden schlafen und zwei Stunden Wache halten müssen. „Wenn Du wach bist, achte auf Schlangen. Wenn Du eine bemerkst dann wecke mich, okay?“
„Aye, aye Sir“, bestätigte ich und fühlte mich nicht besonders wohl bei dem Gedanken an giftige oder sonstige Schlangen.
„Lege dich jetzt hin. Ich übernehme die erste Wache.“
Ich versuchte es und sagte ihm nach einer Weile, dass ich noch nicht schlafen könne.
„Das solltest Du aber“, meinte Norman. „Na ja okay, dann schlafe ich jetzt und Du weckst mich in zwei Stunden.“
Norman konnte offenbar auf Kommando schlafen. Es dauerte nur Minuten, bis er auf der Seite liegend eingeschlafen war. Das Gewehr lag griffbereit neben ihm. Ich hockte vor dem Feuer und legte in Abständen einzelne Holzstücke nach. Dabei achtete ich sorgfältig darauf, ob sich in unserer Nähe irgendetwas bewegte. Ich gönnte mir nur wenige kurze Blicke zu dem schönen klaren Sternenhimmel. Es war völlig windstill und angenehm kühl. Mich ließ der Gedanke nicht los, warum sich der Filter nicht abschrauben ließ. Sam reinigte sie doch regelmäßig. Deshalb konnten die Schrauben unmöglich festgerostet sein. Sam machte das immer selbst. Ich hatte ihm dabei nur manchmal zugeschaut und da ging es immer sehr einfach.
Nach zwei Stunden spürte ich auch Müdigkeit und hoffte endlich schlafen zu können, als ich Norman weckte. Ich rollte mich ein, fand aber keinen richtigen Schlaf, sondern döste nur vor mich hin.
Irgendwann hörte ich etwas rascheln und richtete mich auf. Im Feuerschein sah ich Norman. Er hatte ein Aststück in der Hand und stieß es auf den Boden. Dann griff er mit der anderen Hand zu und hatte kurz darauf eine kleine Schlange am Hinterkopf gepackt. Da er bemerkt hatte, dass ich wach war, zeigte er mir die Schlange und wie man sie packen musste, damit sie keine Chance hatte zu beißen. Es war eine kleine Viper. Norman drehte sich um die eigene Achse und schleuderte die Schlange weit weg in das Steppengras.
„Die belästigt uns nicht mehr“, erklärte er zu meiner Beruhigung.
Ich übernahm nun die nächste Wache und musste mir Mühe geben wachsam zu sein. Immer wieder dachte ich an den missglückten Filterwechsel.
Ich versuchte mir vorzustellen, wie Sam das immer machte. Plötzlich fiel mir etwas ein, was Sam gesagt hatte, als er mir erklärte, warum er regelmäßig die Filter reinigte. Es war das Wort `Linksgewinde`. Allmählich wurde mir klar was damit gemeint war. Die Schrauben hatten also Linksgewinde. Wir hatten in die falsche Richtung zu drehen versucht und es nicht bemerkt. Als mir das so richtig bewusst wurde, hätte ich mir am liebsten selbst in den Hintern getreten. Ich kam mir total blöd vor und überlegte, wie ich Norman das schonend beibringen konnte. Es war also meine Schuld, dass wir die Nacht hier draußen verbringen mussten. Jedenfalls kam es mir so vor. Wenn ich besser aufgepasst oder nachgedacht hätte, wären wir jetzt im Camp in Normans weichem Bett. Ich war so sauer auf mich, dass ich beinahe vergessen hätte auf das Feuer zu achten.
Als ich Norman beim nächsten Wechsel weckte, sagte ich nichts davon. Ich konnte aber auch nicht richtig schlafen.
Als endlich die Sonne aufging, kochte Norman auf dem letzten Feuer Pulverkaffee. Dazu gab es harte Kekse aus der Notverpflegung. Ich fühlte mich müde und ziemlich mies. Ich hatte Herzklopfen, als ich mich endlich aufraffte, es ihm zu sagen.
„Ich weiß jetzt warum die Schraube nicht aufging.“
Norman schaute sofort auf. „Na sag schon, warum?“
„Mir ist in der Nacht eingefallen, dass sie ein Linksgewinde hat.“
Norman schlug mit der Faust auf die Decke. „Oh Mann, ich glaub’s einfach nicht.“
Ich konnte ihm seinen Ärger ansehen. „Ich kann verstehen, dass Du jetzt sauer auf mich bist aber ich habe es nicht mehr gewusst. Es tut mir leid.“
Norman holte tief Luft und schaute mich an. „Ja, schon gut. Du bist Pilot und kein Mechaniker. Hauptsache wir wissen jetzt wie wir weiterkommen.“
Nach dem spärlichen Frühstück beeilten wir uns das Lager aufzuräumen und zum Flugzeug zu kommen. Es erforderte ziemliche Kraft die festgezogene Schraube in anderer Richtung zu lösen aber es klappte. Ich zeigte Norman die Rostpartikel, die den Filter verstopft hatten, bevor ich ihn mit Benzin auswusch, welches ich aus einem Tankventil abgelassen hatte.
Nach einer Stunde hatte ich den nun sauberen Filter wieder eingebaut und mit Normans Hilfe die Triebwerksverkleidung hoch gewuchtet und befestigt. Vorsichtshalber gingen wir die Startstrecke ab, fanden aber keine Hindernisse. Um acht Uhr war der Probelauf erfolgreich beendet und ich startete in der Spur, die wir bei der Landung am Vortag hinterlassen hatten. Der dreieinhalbstündige Flug nach Kabunda war ziemlich anstrengend. Ich war sehr müde und kaputt. Ich hatte auch Kopfschmerzen und konnte es kaum erwarten, mich bald hinlegen zu können. Norman war auch nicht gut gelaunt. Ich wusste aber nicht ob er auch so müde oder eher sauer war.
Kurz vor Mittag konnte ich endlich über Funk unsere Landung ankündigen. Sam war in Sorge gewesen und deshalb berichtete ich ihm bereits per Funk warum wir notlanden mussten.
Nachdem wir ausgestiegen waren, sagte Norman zu mir: „Ich fahre schnell zur Mine und bringe auf dem Rückweg etwas für unterwegs zum Essen mit. Mach schon mal die `Anny` startklar.“
Oh nein, dachte ich. Das kann er doch nicht verlangen. Bevor er weiterging bat ich: „Kannst Du den Flug nicht auf Donnerstag verschieben?“
Norman starrte mich an. Er bekam einen roten Kopf und brüllte mich an: „Glaubst Du etwa mir macht es Spaß jetzt noch mal zu fliegen!!!? Wir haben Termin und zwar heute! Also los, beeil dich!“
Als er sich umdrehte und zum Wagen ging stand ich da und hätte am liebsten geheult. Das hatte mich wie einen Faustschlag in den Magen getroffen. So hatte ich Norman noch nie erlebt und das hätte ich ihm auch nicht zugetraut. Mir war hundeelend als ich zum Hangar ging. Sam klopfte mir auf die Schulter. „Komm mein Junge. Geh rein zu mir, da steht frischer Kaffee. Ich mache das hier schon.“
Ich war Sam sehr dankbar und als ich an dem Kaffee nippte, tropfte eine Träne hinein. Ich zwang mich nicht zu heulen obwohl es sehr weh tat, wie mich Norman gerade behandelt hatte. Ich war mir ziemlich sicher, dass er mir allein die Schuld für die Übernachtung in der Wildnis gab.
Als ich kurze Zeit ins Flugzeug kletterte, hatte ich außer meinen Kopfschmerzen auch noch Bauchweh. Das eisige Schweigen während des Fluges war sehr belastend aber mir brummte der Schädel und jedes Mal wenn das Flugzeug in thermischen Aufwind geriet, schmerzte der Kopf besonders schlimm. Norman hatte mir wortlos ein eingepacktes Sandwich herübergereicht und ich hatte es ebenso wortlos in die Seitentasche gesteckt.
In Cabora Bassa verzog ich mich in die Toilette. Mir war als müsste ich mich übergeben aber mein Magen war leer. Ich trank zwei Becher Tee, dann ließ der Brechreiz nach.
Der Rückflug war ebenso schrecklich. Ich hatte mich noch nie so sehr danach gesehnt endlich aussteigen und mich ins Bett legen zu können wie bei diesem Flug. Zu allem Unglück waren wir so spät dran, dass ich das letzte Drittel der Strecke bei Dunkelheit fliegen musste. Ich weiß nicht mehr wie ich das letzte Stück geschafft habe aber irgendwann hatte ich vor dem Hangar wieder Boden unter den Füßen. Während Norman noch einmal zur Mine fuhr, brachte mich Sam zur Unterkunft. Er sah, dass es mir schlecht ging und ermahnte mich morgen richtig auszuschlafen.
Ich wankte in mein Zimmer und warf mich mit voller Montur auf mein Bett. Ich weiß auch nicht mehr ob ich nur so dagelegen oder dabei geheult habe. Nach einer Weile hörte ich Normans Wagen ankommen. Er muss mich wohl eine Zeit lang beobachtet haben, denn ich hörte wie er die Tür zu meinem Zimmer öffnete und erst später fragte, ob er hereinkommen dürfe. Ich hatte mein Gesicht im Kopfkissen vergraben und nicht geantwortet. Als seine Hand meine Schulter berührte, zuckte ich abwehrend zusammen.
„Hey, was ist los?“ fragte er als wenn nichts gewesen wäre.
„Ich hab tierische Kopfschmerzen“, antwortete ich ohne mich umzudrehen.
„Hast Du eine Tablette genommen?“
„Ich habe keine.“
„Warte, ich hole eine. Sie sind im Bad im Medizinschrank.“
Als er zurück war, drehte er mich einfach um. Ich muss wohl verheulte Augen gehabt haben, denn er machte ein ziemlich besorgtes Gesicht. Er steckte mir die Tablette in den Mund und reichte mir ein Glas Wasser.
„Wenn es in einer halben Stunde nicht besser ist, nimmst Du noch eine“, sagte er und nahm mir das Glas wieder ab.
Norman stand aus der Hocke vor meinem Bett wieder auf. „Ich lasse Dir noch ein bisschen Ruhe und hole uns etwas zu essen.“
Ich blieb währenddessen so liegen und dachte an gar nichts.
Norman kam zurück und hockte bald darauf wieder vor meinem Bett. „Geht es Dir besser oder soll ich noch eine Tablette holen?“
„Nein Lass nur. Es geht schon besser, “ konnte ich jetzt antworten.
„Ich – ich habe Dir heute Mittag sehr weh getan, stimmt’s?“
„Ja, das hast Du“, bestätigte ich.
„Das tut mir sehr leid und das habe ich eigentlich nicht gewollt. Warum hast Du mir nichts von Deinen Kopfschmerzen gesagt?“
Ich holte tief Luft. „Nachdem ich dich ganz vorsichtig gefragt habe und Du mich so angebrüllt hast, was hättest Du gesagt, wenn ich über Kopfschmerzen geklagt hätte?“
Norman zuckte die Schultern. „Ich weiß es nicht. Ich bin ausgeflippt. Mir ging es auch nicht gut und heute ist der Todestag meiner Mutter. Ich wollte zu der Unglücksstelle wie jedes Jahr, ein paar Blumen hinlegen und ein Gebet sprechen aber das konnte ich nicht mehr schaffen.“
„Weil ich gestern zu blöd war den Kraftstoffilter abzuschrauben“, ergänzte ich.
Norman schüttelte den Kopf. „Nein, verdammt. Das war nicht Deine Schuld. Ich sagte doch schon, du bist Pilot und kein Mechaniker. Es ist nicht Dein Job jede Schraube persönlich zu kennen. Ich war ja froh, dass Du die Sache mit dem Linksgewinde zufällig mal mitgekriegt hast und Dir wieder eingefallen ist woran es lag. Ich war egoistisch, ungerecht und gemein zu dir. Ich bitte Dich deshalb um Verzeihung und will es wieder gutmachen. Sag mir was Du dir wünschst, damit ich es Dir morgen aus Lubumbashi mitbringen kann.“
Es klang ehrlich und ich dachte nach was ich antworten kann. „Okay, ich verzeihe Dir und es tut mir leid wegen dem Todestag Deiner Mutter aber ich brauche nichts. Das einzige was ich mir wünsche ist, dass wir uns wieder vertragen.“
Norman schüttelte den Kopf. „Du bist ein Supertyp, weißt Du das? So einer wie Du ist selten oder sogar einmalig.“
„Du willst wohl, dass ich heule, “ sagte ich gerührt, „aber wenn wir jetzt noch weiterreden schaffe ich es nicht mehr aus den Klamotten.“
Jetzt lachte Norman wieder. „Lass mich das machen und dich in unser Bett bringen, okay?“
Ich muss dann sofort eingeschlafen sein und als ich aufwachte war es schon spät. Norman war bereits lange unterwegs. Es war bewundernswert, dass er heute schon wieder ein volles Programm abwickelte, wo ich die letzten beiden Tage noch in den Knochen spürte.
Als ich am Nachmittag Sam im Hangar besuchte, war er ganz froh zu sehen, dass es mir wieder gut ging. Beim obligatorischen Malzkaffee konnte ich auch berichten, dass ich mich mit Norman wieder versöhnt hatte. Ansonsten verabschiedete ich mich früher als gewöhnlich. Ich wusste inzwischen eine Stelle im Camp, an der wilde aber recht schöne Blumen zu finden waren. Ich pflückte einen Strauß und brachte ihn in Normans Zimmer. Bis er zurück kam, setzte ich mich nach draußen und Lass in dem Buch, das er mir von seinem Bruder mitgebracht hatte.
Am späten Nachmittag stellte er den Geländewagen vor unserer Unterkunft ab und begrüßte mich mit einem Kuss auf die Stirn. Er sah müde aus und wollte gleich unter die Dusche. Aus seinem Zimmer hörte ich: „Hey, wo hast Du denn die schönen Blumen her?“
Ich verriet ihm die Stelle wo ich sie gefunden hatte und fügte hinzu: „Ich dachte Du möchtest vielleicht heute – na Du weißt schon.“
Er hatte sich schon ausgezogen und kam nur mit dem Handtuch in der Hand an die Tür.
„Das ist sehr lieb von Dir.“
Im Trainingsanzug mit noch nassen Haaren sah er etwas frischer aus. Norman wollte, dass ich ihn begleite und fuhr den Weg vom Camp in Richtung Kabunda. In einer Rechtskurve, etwa zwei Kilometer vom Haupttor entfernt hielt er an. Am linken Rand des Weges fiel das Gelände auf einige Meter steil ab. Norman ging zu einem der mächtigen Bäume. Knapp über der Erde konnte man eine kleine Narbe in der Rinde erkennen. Das war offensichtlich die Stelle, an der damals das Auto zerschellt war. Außer den Blumen legte Norman einen schwarzen rund geschliffenen Stein vor den Baum. Auf der Oberfläche war etwas eingeritzt. Der Stein war ein Gruß von Jason. Ich wollte mich jetzt diskret zum Wagen zurückziehen aber Norman fasste meine Hand. Was er hier sagte möchte ich nicht wiedergeben. Es war zu persönlich. Nach zwei oder drei ergreifenden Minuten stiegen wir die Böschung hinauf. Ich empfand es als große Ehre, dass er mich mitgenommen hatte.
Bis zur Ankunft in der Kantine sprachen wir nicht aber beim Essen lockerte sich die Stimmung wieder. Wir überlegten, was wir mit dem freien Donnerstag anstellen konnten. Leider fiel uns außer ein bisschen Faulenzen, ein bisschen Safari und anschließend Schwimmen gehen nichts ein.
Bereits in der kommenden Woche trat das ein, was ich im Stillen schon befürchtet hatte und ehrlich gesagt auch fürchtete. Schlechtes Wetter. Beim Start nach Cameia kündigte es sich schon an. Zwar hatte ich mit dem Wettergeschehen hier in Afrika, von wenigen Gewitterfronten einmal abgesehen, keine Erfahrung aber was ich da an hoher Bewölkung sah, deutete auf eine Warmfront hin, die von Südosten heranzog. Mir wäre es lieber gewesen, der Front entgegen zu fliegen aber mein Job nahm darauf keine Rücksicht. So flogen wir der Front zunächst davon, um sie beim Rückflug dann voll zu erwischen.
Keine Turbulenzen bis Cameia, da hätte ich ein Buch lesen können. Norman gefiel die ruhige Luft. Er wusste nicht was ich ahnte und ich sagte es ihm erst als wir in Cameia köstliches Geflügelfleisch verzehrten.
Ich hatte mich im Laufe der Zeit schon gut auf Wetterprobleme und Nachtflüge vorbereitet und alle Verfahren trainiert, die ich mit meiner bescheidenen Ausrüstung nutzen konnte. Dabei hatte ich mich oft an meinen Fluglehrer erinnert. Der war Hubschrauberpilot beim Such- und Rettungsdienst und da wir uns gut verstanden, hatte er mir viele Tricks und gute Ratschläge mitgegeben, die über den üblichen Ausbildungsrahmen hinausgingen.
Ich verkürzte die Pause so weit wie möglich, um wenigstens einen Teil des Rückwegs bei noch guter Sicht zu schaffen. Es dauerte aber nicht lange. Bereits bei Mwinilungwa begann die Wolkenuntergrenze zu sinken. Der Horizont war schmutzig grau. Bei meiner Fliegerei in Deutschland wäre ich hier gelandet und hätte die Schlechtwetterfront über mich hinweg ziehen lassen. Hier wurde aber erwartet, dass man flog und sich irgendwie durchkämpfte.
Auf den nächsten fünfzig Kilometern zwangen mich die Wolken immer tiefer zu gehen. Mit dem Radiokompass peilte ich abwechselnd zwei Radiosender an und übertrug meine Position im so genannten Kreuzpeilverfahren jeweils auf meine Karte. So wusste ich in etwa wo ich war und vor allem welche Mindesthöhe ich nicht unterschreiten durfte. Die Sicht nach vorne betrug noch zwei Kilometer. Besonders unangenehm war ein Nieselregen, der im Propellerwind nur sehr langsam von der Frontscheibe abperlte und meine Sicht weiter verschlechterte. Ich musste so sehr auf meine Höhe, den Kurs und die Beibehaltung von Sicht zum Boden achten, dass ich die Peilungen kaum noch schaffte. Eine Weile ging es noch, in dem Norman die Frequenzen einstellte, die ich ihm sagte und er mir die Peilwerte gab. Dann konnte ich aber nicht mehr lange genug auf die Karte schauen, das Kursdreieck anlegen und die Peilungen eintragen ohne Gefahr zu laufen, währenddessen unbemerkt die Bodensicht zu verlieren.
Es war so eine Situation, wo man als Pilot entweder in Panik gerät oder entschlossen genug ist, sie niederzukämpfen. Ich entschied mich für Letzteres und änderte meinen Kurs nach Norden, um dort irgendwo die Eisenbahn und die Straße von Angola in Richtung Lubumbashi zu finden. Mit ziemlicher Mühe gelang mir noch eine Peilung und dann drückte ich die Stoppuhr. Mit dem Daumen schätzte ich die Entfernung bis zu meiner Auffanglinie und rechnete im Kopf eine Zeit von etwa 50 Minuten bis dorthin. Zum Glück hatte ich auf dem neuen Kurs keine Hindernisse zu erwarten, denn es war schon schwierig genug, in nur dreißig bis fünfzig Metern Höhe über die Baumwipfel zu fliegen und nicht zu sehen, was dahinter kommt.
Man verliert dabei das Zeitgefühl und kann gar nicht fassen, wie lange es dauert, bis die Stoppuhr eine Minute nach vorne rückt. Norman schaute mir aufmerksam zu und fragte: “Kann ich irgendetwas tun?“
Ich schaute für den Bruchteil einer Sekunde zu ihm herüber und antwortete: „Ja. Du kannst mir versprechen, dass Du mir einen weichen Radiergummi besorgst, damit ich die Karte wieder sauber kriege.“
Darauf fragte er: „Einen weißen oder einen roten?“
Mit solchen oder ähnlichen Sprüchen bauten wir den Stress ein wenig ab.
Mein rechter Zeigefinger wanderte auf der Karte in Abstimmung mit der Stoppuhr langsam nach Norden und überquerte viel früher als bei normalem Kurs die Grenze zwischen Sambia und Zaire. Der Regen nahm ein wenig zu und es waren noch dreißig Minuten bis zur Eisenbahn.
Man fühlt sich verdammt einsam wenn man auf mehr als hundert Kilometer kein Haus, keine Straße keinen Fluss und noch nicht einmal den Horizont sehen kann. Entsprechend froh war ich, als ich die Eisenbahnstrecke unter mir sah. Um sie nicht zu verlieren, musste ich steil nach rechts drehen. Ich atmete erleichtert auf und ließ mir von Norman die Wasserflasche reichen. Ein kräftiger Schluck war gut gegen den trockenen Hals. Ich reichte sie Norman zurück. „Noch dreißig Meilen bis Kolwezi. Willst Du von dort mit dem Zug weiterfahren?“
Er lachte. „Glaube bloß nicht, dass Du mich los wirst.“
Da die Wolken noch immer sehr tief hingen, donnerte ich im Tiefflug an der Eisenbahn entlang und beachtete die alte Fliegerregel: linkes Rad, rechte Schiene. Kurz vor Kolwezi kam uns ein langer Güterzug entgegen, der von einer mächtigen Garret-Dampflokomotive gezogen und von einer zweiten geschoben wurde. Ich konnte den Rauch riechen, den die Lokomotiven aus ihren mächtigen Schornsteinen ausstießen. Bei Kolwezi musste ich mich am südlichen Stadtrand vorbei mogeln, um den zahlreichen Schonsteinen und Fördertürmen der Kupferminen auszuweichen. Es war wieder einmal gut, dass ich vorher Gelegenheit hatte, die Strecke bei gutem Wetter zu erkunden. Von jetzt an ging es in einem leichten Rechtsbogen allmählich nach Südosten. Ich brauchte nur der Eisenbahn und der von nun an asphaltierten Straße zu folgen, auf Fördertürme bei Likasi zu achten, um nach Lubumbashi zu gelangen. Ein Blick auf die Uhr und die Karte bereitete mir die nächste Sorge. Wir hatten durch den Umweg schon mehr als eine Stunde Verspätung. Irgendwo zwischen Lubumbashi und Kabunda würde es dunkel werden. Mir war auch klar, dass ich bei der Bewölkung kein Sternen- oder Mondlicht zu erwarten hatte.
Nicht einmal das saftigste Steak der Welt konnte mir einen Tiefflug bei stockfinsterer Nacht bis Kabunda schmackhaft machen. Es war also absoluter Präzisionsflug angesagt. Ich entschied mich nicht den direkten Kurs von Lubumbashi nach Kabunda zu fliegen, sondern der Eisenbahn bis Chililabombwe zu folgen und dort den gewohnten normalen Kurs nach Hause zu fliegen, der mir viel besser vertraut war. Das bedeutete zwar einen weiteren Umweg von zwanzig Minuten und würde meine Spritreserve weiter verringern aber das schien mir das kleinere Übel. Wenn ich Kabunda verfehlen würde, war es so oder so vorbei.
Während ich Lubumbashi erreichte, die Hindernisse und den Anflugsektor des Flughafens umflog, ging ich im Geist immer wieder die selbst gestrickten und trainierten Navigationsverfahren durch, um die winzigen Petroleumlampen an der Piste von Kabunda zu finden.
Die Nacht begann zum Glück erst, als ich den gewohnten Kurs östlich von Tshinsenda aufgenommen hatte. Die Wolkenuntergrenze erlaubte mir jetzt eine Flughöhe von 150 Metern über Grund und schien leicht anzusteigen. Ein wenig Licht vom Dorf Mokambo erlaubte mir noch einmal meinen Kurs zu überprüfen. Danach war nur noch schwarze Nacht. Mein Radiokompass empfing einen Sender der in der Stadt Ndola, südlich von Lubumbashi stand. Mit dieser Peilung konnte ich bei einem Winkel der Peilnadel von fünfunddreißig Grad meine Position kurz vor Kabunda mit einer Genauigkeit von plus/minus drei Meilen bestimmen. Besser ging es nur, wenn auch der Peilsender von East Seven, einem kleinen militärisch genutzten Flugfeld nur etwa zehn Kilometer nordöstlich von Kabunda auf sambischer Seite in Betrieb war, um eine Kreuzpeilung zu ermöglichen. Da die Briten, die dieses Flugfeld nutzten, den Sender aber nur einschalteten, wenn sie ein Flugzeug erwarteten, konnte ich auf diese komfortable Lösung nicht hoffen. Wenn ich also mit dem einzigen nutzbaren Peilsender keinen Anhaltspunkt fand, blieb nur noch eine Chance. Ich musste Sam per Funk bitten eine weiße oder rote Leuchtkugel in den Himmel zu schießen, um die Piste von Kabunda zu finden. Ab Mokambo hatte ich die Stoppuhr gedrückt. Die Flugzeit sollte bis Kabunda 45 Minuten betragen. Es war anstrengend aber lebenswichtig den Kurs absolut genau einzuhalten. Ich spürte, dass Norman nervös auf seinem Sitz herum rutschte und immer wieder einen Blick auf die Benzinanzeige warf. Er sagte nichts, weil ich so konzentriert war. Ich wusste, dass der Tankinhalt den Motor noch eine Stunde am Leben erhalten würde und die Angst, Kabunda verfehlen zu können, hatte ich inzwischen unterdrücken gelernt. Sie war aber im Unterbewusstsein da und sie würde sich später melden wie nach anderen kritischen Situationen. Sie bahnte sich dann in der Nacht nach dem Flug ihren Weg. Ließ mich das Ganze im Traum noch einmal erleben, bis ich schweißgebadet aufwachte. Dann hatte sich Norman inzwischen über mich gebeugt, um mich zu beruhigen.
Wie so oft, wenn ich absolut konzentriert fliegen musste, spielte sich in meinen Gedanken etwas völlig anderes ab, an was ich mich gerne erinnerte. In diesem Fall war es zuhause und ich war damals vierzehn oder fünfzehn Jahre alt. Wie an jedem Wochentag kam mein Vater um fünf Uhr nachmittags von der Arbeit. Das war die Zeit, wo die ganze Familie in der Küche saß und Kaffee trank und es war die Zeit, wo wir über alles redeten, was den einzelnen oder die Familie betraf. Ich hatte vorher frisches Brot beim Bäcker geholt und meine Mutter hatte Pflaumenmus gekocht. Ich liebte Pflaumenmus mit einer Prise Zucker und während ich eine Scheibe Brot nach der anderen bestrich und verdrückte, verhandelte ich mit meinen Eltern wie lange ich am Samstag mit meinem Freund Patrick auf einer Geburtstagsparty bleiben durfte. Wir handelten wie auf einem orientalischen Basar. Im Grunde waren meine Eltern sehr großzügig aber ich sorgte auch immer dafür, dass sie sich auf mich verlassen konnten.
Als die Stoppuhr 40 Minuten anzeigte, waren meine Erinnerungen genauso schnell verflogen wie sie gekommen waren. Der Radiokompass war dem vorgegebenen Winkel schon sehr nahe. Die schemenhaften Konturen am Boden waren so schwach, dass ich nichts Markantes erkennen konnte. Per Funk meldete ich mich in Kabunda an und war beruhigt die Stimme von Sam zu hören, der mir bestätigte, dass die Petroleumlampen an der Piste brannten. Ich wollte ihn gerade bitten, eine Leuchtkugel abzuschießen, als es mir so vorkam, als läge der Luapula links von uns. Ich konnte ihn nicht genau erkennen aber ich war mir ziemlich sicher. Wenn es stimmte, was ich glaubte, dann musste ich jetzt nach rechts drehen. Ich gehorchte meinem Instinkt, flog eine Minute Südkurs und schaute nach links. Ich muss zugeben, dass ich Herzklopfen hatte, denn die Minute war schon knapp überschritten. Ich wollte mir gerade eingestehen, dass ich mich geirrt hatte, da entdeckte ich halb links einen winzigen leuchtenden Punkt. Die Entfernung und der Winkel irritierte mich ziemlich aber je länger ich den Kurs beibehielt, desto mehr leuchtende Punkte gab der Wald neben der Piste meinem Blickwinkel frei.
Da lag sie also. Meine Piste in dunkelster Nacht. Ich war eine Idee zu früh abgebogen aber ich hatte sie trotzdem ohne fremde Hilfe gefunden. Mir rieselte in diesem Moment ein Schauer der Erleichterung über den Rücken. Ich war aber nie der Typ, der seine Emotionen herausschreien konnte. Stattdessen sagte ich Norman über die Kopfhöreranlage: „Der Kapitän erlaubt sich bekannt zu geben, dass wir in Kürze landen.“
Der Landeanflug kostete noch einmal Überwindung. Es war schwer Entfernung und Höhe abzuschätzen, die Maschine in blindem Vertrauen auf eine Piste zu setzen, die man nicht sehen, sondern nur erahnen kann. dass wir unten waren, merkte ich erst als die Räder über den Rasen rumpelten. Vor dem Hangar musste ich einen Augenblick sitzen bleiben und durchatmen, bevor ich aussteigen konnte.
„Ich habe nicht geglaubt, dass man Kabunda jetzt auf Anhieb finden kann“, sagte Norman und klopfte mir auf die Schulter.
„Ist auch nicht einfach“, gab ich zu und kletterte langsam aus dem Cockpit.
An diesem Abend war ich total aufgedreht. Ich war stolz auf mich und verblüffte sogar Norman beim Training, obwohl ich innerlich ziemlich müde und kaputt war.
„Du freust dich wohl weil Du das bei dem miesen Wetter und der Dunkelheit so gut hingekriegt hast?“ meinte Norman beim Abendessen.
„Ja“, bestätigte ich. „Lief doch ganz gut, oder?“
Er nickte. „Ich hatte den Eindruck, dass Du immer genau wusstest was du tust.“
„Das muss man auch“, sagte ich ziemlich cool und genoss es einmal bewundert zu werden.
Ich war noch ganz high, als ich im Bett lag. Irgendwann nachdem ich eingeschlafen war meldete sich die verdrängte Angst. Sie ließ sich nicht vertreiben oder betrügen.
Ich erlebte den Flug noch einmal. In diesem Traum aber anders. Diesmal war ich kurz nach Mwinilungwa so tief geflogen, dass ich die Krone eine Baumes streifte, den ich zu spät bemerkt hatte. Ich fand es cool, dass der Baum meinem Flugzeug keinen Schaden zugefügt hatte und flog weiter. Dann kam der Nachtflug. Ich musste bei Kabunda sein und fand es nicht. Ich bat Sam eine Leuchtkugel abzuschießen aber ich sah sie nicht, weil ich wahrscheinlich schon über mein Ziel hinaus war und die Leuchtkugel hinter mir hochging. Ich kämpfte gegen den künstlichen Horizont und bekam Panik weil die Warnlampe der Spritanzeige unerbittlich leuchtete. Die `Anny` schrie mich mit dieser Lampe an und fragte: „Was machst Du mit mir?“
Im Kopfhörer ertönte dann die Stimme meines Fluglehrers: „Du musst Respekt haben. Vor Deinem Flugzeug, vor dem Wetter und vor allem vor Dir selbst. Solange Du von dem überzeugt bist was Du tust, hast Du wenigstens eine Chance. Wenn Du den Respekt verlierst, hast Du vielleicht nur noch Glück.“
Genau das hatte er mir einmal gesagt, als ich mich überschätzt hatte und seine Kritik nicht besonders ernst genommen hatte.
Der Flug in meinem Traum wurde ein Desaster. Ich wusste nicht mehr was ich tat. Es war alles ohne Sinn und ohne Plan. Dann begann der Motor zu stottern weil die Tanks leer waren. Ich wollte das Flugzeug mit Gewalt in der Luft halten aber der Fahrtmesser ging zurück, bis die Überziehwarnung ertönte und das Flugzeug zur Seite abkippte.
Ich muss furchtbar geschrien haben.
Als ich erwachte, war Norman über mir und schlug mir mit den Handflächen auf die Wangen. Ich schaute ihn an und keuchte. Mir liefen Schweißperlen von der Stirn.
„Micha wach auf. Was ist passiert?“ hörte ich ihn. Er schien total erschrocken und ich musste erst einmal begreifen, dass das ein Alptraum war.
Es dauerte eine ganze Weile, bis sich mein Puls und meine Atemfrequenz wieder beruhigt hatten.
„Du hast wieder geträumt, nicht wahr?“
Ich nickte und war ziemlich niedergeschlagen. Norman legte sich wieder hin und drückte mich fest an sich. Ich holte tief Luft.
„Ich muss Dir was sagen.“
„Was musst Du mir sagen?“
„Der Traum vorhin. Der Traum war die Angst für die ich bei dem Flug keine Zeit hatte.“
„Wenn wir niemals Angst hätten, könnten wir nicht überleben.“
„Ja, das hat mir der Traum auch gesagt.“
„Hat er Dir sonst noch etwas gesagt?“
„Ich habe mich beim Abendessen ziemlich blöd benommen. Ich habe geglaubt, das miese Wetter und den letzten Teil in der Dunkelheit habe ich geschafft weil ich ein toller Pilot bin aber das stimmt nicht.“
„Ich verstehe ja nicht viel davon aber ich fand es schon immer toll, dass Du von Anfang an alles Mögliche probiert und trainiert hast. Deshalb hatte ich heute auch keine Angst. Ich habe gespürt, dass Du kämpfst und nicht unsicher warst. Wenn Du kein guter Pilot wärst, wären wir jetzt nicht hier.“
„Vielleicht werde ich einmal ein guter Pilot. So was wie heute war das erste Mal für mich, ich weiß, dass ich noch lernen muss und das will ich auch.“
„Es ist doch gut wenn Du das so siehst und kein Mensch verlangt, dass Du mit neunzehn schon alles kannst. Dann macht doch der Rest Deines Lebens keinen Spaß mehr.“
Ich musste seufzen. „Morgen werden wir wieder müde sein. Danke, dass Du mir zugehört hast.“
„Danke, dass Du so ehrlich bist“, sagte Norman und gab mir einen Kuss. „Gute Nacht und schlafe jetzt gut.“
„Du auch, gute Nacht.“
Beim Flug nach Cabora Bassa am nächsten Morgen war es noch immer bewölkt aber trocken. Die Sicht betrug zwischen fünf und acht Kilometer. Das war zwar nicht gut aber eine Wohltat gegenüber gestern. Ich befürchtete, dass sich die Wolken auf der anderen Seite des Höhenrückens bei Petauke stauen und mir den Weg versperren würden aber es war nicht so schlimm. Erstaunlicherweise war das Wetter auf dieser Route immer etwas unproblematischer aber das konnte mir nur recht sein.
In Cabora Bassa hatte sich die sonst staubige Piste in eine Schlammwüste verwandelt. Als die Räder aufsetzten, hörte ich schon wie der rotbraune Schlamm unter die Tragflächen und von dort gegen den Rumpf spritzte. Deshalb war ich schon sauer, als ich den Motor abstellte. Als ich dann beim Aussteigen auch mit meinen Pilotenstiefeln im Morast versank, schimpfte ich wie ein Rohrspatz. Norman nahm es gelassen und grinste. Er fand es ja süß, wenn ich sauer war.
Ich hingegen fand es gar nicht lustig, wenn ich den morgigen freien Tag damit verbringen musste, den bis dahin angetrockneten Lehm vom ganzen Flugzeug und von meinen Stiefeln zu waschen. Damit sank Cabora Bassa in meiner Beliebtheitsskala in ungeahnte Tiefen.
Nach unserer Rückkehr in Kabunda mochte ich gar nicht hinsehen. Beim Start war der Dreck auch noch auf das gesamte Leitwerk gespritzt und auf dem Cockpitboden hatte er sich von unseren Stiefeln verteilt.
Zu allem Unglück lief mir mitten in meiner Wut Steve über den Weg, der kurz vorher aus Lubumbashi gelandet war. Er schaute erst meine `Anny` und dann mich von oben bis unten an. Mit krauser Stirn und gerümpfter Nase meinte er geringschätzig: „So was nennt man wohl einen Dreckspatz“, und lachte hämisch dabei.
„Ach Lass mich doch in Ruhe, “ fauchte ich ihn an.
Als ich weitergehen wollte, fasste er mich unter dem Kinn am Overall.
„Habe heute Morgen gesehen, dass Du gestern sieben Stunden von Cameia bis hier gebraucht hast. Da hatte der Kleine wohl ganz schön die Hosen voll, was?“
Ich versuchte mich loszureißen aber das gelang mir nicht.
„Du Mistkerl. Das geht dich gar nichts an. Lass mich los verdammt noch mal!“
Er lachte verächtlich und blies mir den Rauch seiner Zigarette ins Gesicht. „Blas dich bloß nicht so auf und sehe lieber zu, dass Du mit deinem Flieger in die Wanne kommst.“ Dann ließ er mich ruckartig los und ging zu seinem Wagen.
Ich war nahe daran auszurasten. Am liebsten wäre ich hinterher, um ihm kräftig in den Hintern zu treten.
Später im Kraftraum begann ich meine Wut und meinen Zorn an Normans Boxbirne auszulassen, die ich sonst nie benutzte. Norman schaute eine Weile zu, wie ich mit bloßen Fäusten auf den gefüllten Ledersack einschlug.
„Bist Du so wütend wegen dem Dreck?“
„Ja“, keuchte ich.
Er hielt mir seine Boxhandschuhe hin. „Nimm die, dann tun Dir nachher die Finger nicht so weh.“
Von meiner unfreiwilligen Begegnung mit Steve sagte ich nichts. Ich wollte ihn in dieses gespannte Verhältnis nicht mit hineinziehen. Ich wusste nicht einmal warum mich Steve bei jeder Gelegenheit so niedermachte.
In den nächsten Wochen war das Wetter wieder normal, also sonnig und heiß. Der Alltag lief planmäßig und ohne Besonderheiten ab, bis mir Norman an einem Dienstagabend sagte, dass er am nächsten Tag nicht nach Lubumbashi fliegen würde.
„Warum? Was ist los?“ wollte ich wissen.
„Weil mein Bruder Ferien hat“, erklärte er.
„Ist er nach Amerika geflogen?“ Ich musste ihm alles aus der Nase ziehen.
„Nein, er ist bei den van de Waals und wir werden ihn morgen und übermorgen besuchen.“
Ich hatte mich inzwischen daran gewöhnt, dass ich seine Pläne immer erst im letzten Moment erfuhr aber das war eine tolle Überraschung.
Gut gelaunt packten wir am nächsten Morgen ein paar Sachen für die Übernachtung zusammen und machten uns auf den Weg.
Als wir nach zwei Stunden das Haus auf dem Farmgelände erreichten, wurden wir schon von Jason und Claire, dem schwarzen Riesenschnauzer erwartet. Die Brüder umarmten sich zur Begrüßung. Norman brauchte uns gar nicht vorzustellen. Jason war ebenso hübsch wie Norman. Sein Gesicht und seine dunklen Haare ähnelten seiner Mutter, deren Foto ich in Normans Zimmer gesehen hatte. Er war etwa so groß wie ich aber etwas kräftiger und hatte eine ähnlich sportliche Figur wie Norman.
Er streckte mir die Hand entgegen.
„Hey, ich bin Jason. Hab schon viel von Dir gehört.“
„Ich auch von Dir“, entgegnete ich. Er hatte einen festen Händedruck und strahlte viel Selbstvertrauen aus.
„Ich glaube es gibt ein zweites Frühstück“, sagte er und ging voraus auf die Veranda.
Dort begrüßte uns Frau van de Waal und bat uns zu Tisch. Nach einer Tasse Tee und einigen freundlichen Worten verabschiedete sie sich taktvoll und ließ uns allein.
Norman lehnte sich zurück und überließ seinem Bruder und mir das Feld.
„Bist Du schon länger hier?“ wollte ich wissen.
„Seit Samstag“, antwortete Jason. „Hat Dir mein Bruder nichts erzählt?“
Ich schüttelte den Kopf. „Immerhin habe ich schon gestern Abend erfahren, dass wir heute hierher fahren würden.“
Jason lachte. „Typisch Norman. Das hat er mit mir früher auch immer so gemacht.“
„Das erspart manche Diskussionen“, mischte sich Norman ein.
Jason grinste viel sagend. „Machst Du viel Sport?“
Ich schaute kurz zu Norman hinüber. „In der Schule habe ich Basketball gespielt und jetzt zerrt mich Dein Bruder jeden Abend in seine Folterkammer.“
Der jüngere Bruder schmunzelte verständnisvoll. „Ich spiele Baseball in der Schulmannschaft. Kennst Du Baseball?“
„Tut mir leid aber in Deutschland ist das ziemlich unbekannt.“
„Schade“, fand Jason. Es war wahrscheinlich sein Lieblingsthema und musste sich etwas anderes einfallen lassen. Er fragte mich eine Weile über Deutschland, meine Familie und wie ich Pilot geworden war.
Nach einer guten Stunde schlug Norman vor unser Zimmer zu beziehen. Jason begleitete uns in das Gästezimmer und erzählte, dass er im Zimmer von Philippe schlief.
Eine Viertelstunde später trafen wir uns vor dem Hauseingang und fuhren zu den Wirtschaftsgebäuden, um Herrn van de Waal zu begrüßen. Er war gerade dabei, einen Mähdrescher für die Ernte vorzubereiten. Norman bot ihm unsere Hilfe an. Allerdings eher meine und Jasons Hilfe, weil er technisch nicht sonderlich begabt war und nur im Weg stand.
Nach dem Mittagessen wollte Norman etwas Geschäftliches wegen der Lieferungen mit Herrn van de Waal erledigen.
„Kann ich Euch so lange allein lassen“, fragte er Jason und mich.
Nach dem wir großzügig zugestimmt hatten, blieben wir allein auf der Terrasse zurück.
„Komm mit, ich weiß ein schattiges Plätzchen, wo ich mittags immer lese“, forderte mich Jason auf. Ich folgte ihm auf die Rückseite des Hauses. Dort standen drei Bäume dicht beieinander, die von Sträuchern umgeben waren. Unter diesen Bäumen ließen wir uns auf dem Boden nieder. Er hatte recht, es war hier angenehm kühl.
„Liest Du viel?“ wollte ich wissen.
„Ja. Ich habe ja auch viel Zeit dazu, “ antwortete er. „Hast Du das Buch schon gelesen, das Norman Dir mitgebracht hat?“
„Ich bin noch dabei. Es gefällt mir sehr gut aber ich habe es rationiert und lese jeden Mittwoch nach dem Frühstück zehn bis zwölf Seiten, damit es reicht, solange ich noch hier bin.“
Jason schaute mich mit großen Augen an. „Du musst es nicht rationieren. Ich schicke Dir gern noch andere gute Bücher über Afrika mit.“
„Darüber würde ich mich freuen.“
„Wie gefällt Dir denn dein Job?“ erkundigte er sich.
„In den ersten Wochen war das Fliegen ganz aufregend und spannend aber jetzt habe ich gemerkt wie hart der Job ist. Die Flüge sind verdammt lang und man ist im Camp so isoliert, “ gab ich zu.
„Hast Du manchmal Heimweh?“
„Ja ich vermisse manchmal meine Familie und meine Freunde. Vor allem auch die Freiheit mal etwas zu unternehmen und Leute zu treffen aber sage Norman bitte nichts davon. Ich will nicht, dass er wegen mir ein schlechtes Gewissen haben muss.“
Jason legte sich auf dem Bauch und stützte sich auf die Ellenbogen. „Darf ich Dich mal etwas ganz privates fragen?“
Ich nickte.
„Bist Du in meinen Bruder verliebt?“
Ich brauchte einen Augenblick um zu überlegen, wie ich ihm antworten sollte. „Ja. Er war mir sofort sympathisch, als ich ihn in Lubumbashi am Flughafen zum ersten Mal sah. Er war sehr nett zu mir. Zuerst habe ich ihn bewundert, weil er so groß und stark ist. Ich mochte seine wunderschönen Augen, sein Lachen und dann wurde mir klar, dass ich mich total in ihn verliebt habe.“
„Norman hat mir damals erzählt, dass Du nur vier Wochen bleiben wolltest. Hast Du deshalb verlängert?“
Ich schaute im in seine braunen Augen aber ich sah nichts Feindseliges darin. „Ohne Norman würde ich den Job und das Leben im Camp nicht aushalten. Als er mich fragte, ob ich länger bleiben wollte, habe ich ja gesagt weil ich ihn nicht so schnell wieder verlieren wollte. Ich hoffe, dass Du nicht eifersüchtig bist.“
Jason lächelte. „Keine Sorge. Ich freue mich sogar darüber. Seit Du hier bist, ist er wieder so wie in der Zeit, als er noch in der Schule war.“
„Wie meinst Du das?“ hakte ich nach.
„Er hat es nie zugegeben aber er war sehr einsam im Camp. Ich habe das gemerkt, weil er so ernst und innerlich sehr traurig war.“
„Warum ist er nach der Schule nicht in die Staaten gegangen um zu studieren? Wie er mir erzählt hat, leben doch Eure Großeltern da.“
Jason bekam einen skeptischen Blick. „Das habe ich ihm ja auch geraten aber er sagte immer, dass er mich hier nicht alleine lassen und so lange warten will, bis ich mit der Schule fertig bin aber es gibt noch einen anderen Grund.“
„Willst Du ihn mir verraten?“
Jason holte tief Luft. „Sein, äh, unser Vater will, dass er eines Tages das Geschäft mit der Mine übernimmt und deshalb soll Norman schon mal ein paar Erfahrungen sammeln, bevor er studiert. Außerdem scheint es das Gewissen meines Vaters zu beruhigen, dass Norman noch da ist und er sich nicht um mich zu kümmern braucht.“
„Du scheinst keine gute Meinung von Deinem Vater zu haben, oder?“
Jason lachte bitter. „Das einzige, was ich ihm nicht vorwerfe ist, dass er mein Schulgeld und mein Taschengeld bezahlt. Er hat unsere Familie zerstört weil er nichts anderes kennt als seine Geschäfte. Wir waren ihm immer egal und jetzt versucht er Norman auszunutzen. Das will ich nicht und dafür hasse ich ihn. Kannst Du das verstehen?“
„Ich glaube schon. Du hängst sehr an Norman und er auch an Dir. Ich finde das ist das Wichtigste.“
Jason drehte sich auf den Rücken. „Ja, stimmt. Ich hoffe nur, dass er später nicht wieder nach Kabunda oder Lubumbashi geht.“
Eine Weile lagen wir noch unter den Bäumen. Ich hatte den Eindruck, dass es Jason sehr viel bedeutete mit jemandem darüber zu reden und war ganz stolz, dass er genug Vertrauen zu mir hatte.
„Wir sollten mal nachsehen, ob Norman wieder zurück ist“, meinte er plötzlich und stand auf. Als wir zur Veranda kamen, saß Norman mit den van de Waals bereits beim Tee.
Norman deutete mir, mich neben ihn zu setzen. „Wir hatten schon Sorge, was ihr miteinander angestellt habt.“
„Wir haben unter Jasons Lesebaum gelegen und geredet. Dabei haben wir die Zeit vergessen. Tut mir Leid, “ erklärte ich.
Er lachte und schaute uns beide an. „Macht doch nichts. Es sieht ja so aus, als wenn ihr Euch gut versteht.“
Frau van de Waal hatte kleine Kekse mit Mangomus gebacken. Sie schmeckten köstlich und nach der Kaffeetafel beschlossen wir uns im Pool abzukühlen. Wir waren ziemlich ausgelassen, tobten im Wasser herum und hatten unseren Spaß, wenn Norman versuchte uns zu bändigen. Wir waren richtig glücklich. Auch nachher, als unsere Haut in der Sonne getrocknet war und wir auf dem Rasen unter den Bäumen herumtobten. Frau van de Waal schaute einmal von der Veranda zu uns hinüber und schüttelte lachend den Kopf. Ich glaube sie genoss es, dass an ihrem Haus wieder Leben herrschte, nachdem ihr Sohn Philippe nun in Belgien war.
Nach dem Abendessen blieben wir am Tisch sitzen. Drei Öllampen tauchten die Veranda ein weiches Licht. Herr van de Waal holte eine Flasche französischen Rotwein aus dem Keller. Es war ein Bordeaux Jahrgang Siebenundsechzig. Er war ganz stolz darauf und kostete ihn bedächtig, bevor er die Gläser einschenkte. Nur Jason trank etwas, was er selbst zubereitete. Es war kalter Bananentee. Er erklärte mir, dass er mit getrockneten Blüten von Bananenstauden aufgesetzt wurde.
„Darf ich mal probieren?“ fragte ich ihn.
Er reichte mir das Glas und Norman schaute mich gespannt an. Es schmeckte so säuerlich und bitter, dass ich mich schüttelte. Norman lachte, als ich Jason das Glas mit fragendem Blick zurück reichte.
„Wie kann man so was mögen?“ fragte ich.
„Er mag es, weil es sonst keiner mag“, erklärte mir Norman.
Jason grinste. „Es ist gut fürs Gehirn.“
Herr van de Waal fragte mich eine ganze Menge über Flugzeuge und das Fliegen. Er interessierte sich dafür und überlegte, ob er ein Teil seiner Felder mit einem Sprühflugzeug gegen Schädlinge behandeln lassen sollte. Ich war im Verlaufe unserer Unterhaltung erstaunt, wie viel Jason über Pflanzen und Landwirtschaft wusste. Es war ein sehr interessanter Abend, den ich sehr genoss, weil ich so etwas in größerem Kreise schon lange vermisst hatte. Zu schade, dass es Zeit wurde ins Bett zu gehen.
Das Gästezimmer befand sich am anderen Ende des Hauses als die übrigen Schlafräume. Die Tür war kaum geschlossen, als Norman seine Arme um meine Schultern schlang und mich leidenschaftlich küsste. Ich spürte ein aufregendes Prickeln im Bauch, das sich im ganzen Körper ausbreitete, als er mich auf das Bett legte und langsam mein Hemd aufknöpfte. Norman war wieder einmal ein leidenschaftlicher Liebhaber und es wurde spät, bis wir ganz nah beieinander einschliefen.
Beim Frühstück, morgens um sieben, waren alle schon gut gelaunt. Nur ich konnte nicht verbergen, dass ich noch etwas müde war. Als mich Frau van de Waal fragte, ob ich nicht gut geschlafen hätte, warf mir Jason grinsend einen viel sagenden oder wissenden Blick zu.
Norman, der neben mir saß, klopfte mir auf die Schulter. „Micha braucht morgens immer ein bisschen länger bis er wach ist, nicht wahr?“
„Ja, stimmt“, gab ich zu und Frau van de Waal war fest davon überzeugt, dass ich zu niedrigen Blutdruck haben müsse.
Jason verschluckte sich fast, als sie das sagte und weil er sich nur mühsam das Lachen verkneifen konnte, meinte er: „Ich kenne das. Einige meiner Mitschüler haben auch manchmal zu niedrigen Blutdruck.“
Norman wechselte schnell das Thema und erkundigte sich nach Philippes Pferd. Herr van de Waal bot ihm an, er könne es gern reiten. Auch ich hätte ein Pferd bekommen können aber ich hatte seit meiner Kindheit nicht mehr in einem Sattel gesessen und wollte mich nicht blamieren. Jason hatte auch keine Lust zu reiten und wollte mir stattdessen zeigen wie Baseball gespielt wird.
„Okay, dann fahre ich jetzt zum Stall raus und reite eine Stunde allein, “ meinte Norman und machte sich auf den Weg.
Als ich mit Jason allein war, schaute er mich an und sagte: „Entschuldige wegen vorhin aber meine Vermutung war doch richtig, oder?“
„Welche Vermutung?“ wollte ich wissen.
Sein Blick wurde etwas verlegen. „Na ja, Ihr habt im Bett doch sicher noch was anderes gemacht als sofort zu schlafen.“
Der Kleine wusste also Bescheid und ich gab schließlich zu, dass Norman und ich Sex miteinander hatten, ohne jedoch auf Einzelheiten einzugehen.
Er nahm es gelassen und voller Verständnis, bevor er das Thema wechselte.
Nachdem mich Jason eine halbe Stunde lang in die Geheimnisse des Baseball eingeweiht hatte, sprachen wir über unsere beruflichen Pläne. Jason wollte gerne Arzt oder Jurist werden und war ganz überrascht, dass ich nicht Flugkapitän werden wollte. Ich hatte mir in letzter Zeit immer wieder vorgestellt einmal als Forscher in vielen Ländern der Welt tätig zu sein. Ich wollte also zunächst ein naturwissenschaftliches Studium absolvieren. Biologie, Geologie, Archäologie waren die Fächer, die ich mir so vorstellte.
Während wir uns mit viel Phantasie unser späteres Leben vorstellten, kam plötzlich ein Stalljunge angelaufen und rief uns aufgeregt etwas in französischer Sprache zu.
Jason sprang auf.
„Komm schnell, das Pferd ist alleine zum Stall zurückgekommen. Dann muss Norman etwas passiert sein.“
Wir rannten dem Stalljungen hinterher. Den Kilometer bis zu den Pferdeställen schafften wir in wenigen Minuten. Das Pferd war unverletzt aber ziemlich unruhig.
Statt erst Herrn van de Waal zu suchen, schlug Jason vor, die Suche auf eigene Faust zu starten. Wir nahmen Normans Wagen. Der Schlüssel steckte wie immer im Zündschloss und so fuhr ich kurz entschlossen los.
Jason stand auf dem Beifahrersitz und dirigierte mich durch das offene Schiebedach in die Richtung, aus der der Stalljunge das Pferd zurückkommen sah. Da ich den Geländewagen zum ersten Mal selbst fuhr, musste ich mich erst an die Schwergängigkeit der Lenkung und der Schaltung gewöhnen. Es ging quer durch das Gelände und über Weiden. Gelegentlich musste ich an einem Gatter anhalten, was Norman mit dem Pferd leicht übersprungen haben könnte. Jason stieg jeweils aus, öffnete das Gatter und schloss es wieder, nachdem ich es passiert hatte. Leider waren auf dem trockenen und harten Boden keine Spuren zusehen. Es blieb uns daher nichts anderes übrig, als großflächig zu suchen. Ich machte mir Sorgen und wünschte, ich wäre doch mit ihm geritten.
Wir waren nun schon über eine Stunde unterwegs und fuhren einen kleinen Hügel hinauf. Jason nutzte den Überblick. „Halt mal an!“ rief er. Nach einer Weile hatte er etwas entdeckt. „Schau mal da drüben. Siehst Du den weißen Fleck?“
Ich zwängte mich neben ihm durch das Schiebedach und er deutete zu einer Baumgruppe, die auf der anderen Seite einer Senke stand.
„Ja“, sagte ich. „Da ist etwas. Ich versuche hinzukommen.“
Eilig rutschte ich wieder auf den Fahrersitz und gab Gas.
„Das ist ein alter Trick“, rief Jason. „Er hat sein Hemd ausgezogen und an einen Ast gesteckt.“
Ich hoffte, dass er Recht hatte und steuerte den Wagen in die Senke hinab. Leider musste ich hier eine Gruppe Springböcke an der Tränke stören aber es war der einzige fahrbare Weg und die einzige Stelle, wo ich mit dem Rover den seichten Bachlauf durchqueren konnte.
Als wir nach einer holprigen Strecke wieder freie Sicht bekamen, konnte man den weißen Fleck tatsächlich als ein Hemd identifizieren. Es dauerte noch fünf Minuten, bis wir die Stelle erreichten.
Dort saß Norman an einen Baumstamm gelehnt und zwang sich zu einem Lächeln. Jason und ich sprangen aus dem Wagen.
„Hey Jungs“, sagte er. „Ich bin nicht mehr in Übung.“
Ich war erleichtert, dass er sich nicht das Genick gebrochen hatte. Was ich sehen konnte, war eine Abschürfung am Oberarm.
Ich hockte mich neben ihn. „Was ist passiert?“
„Ich bin durch die Baumgruppe geritten und habe nicht bemerkt, dass vor uns eine Schlange an einem Ast hing. Da hat das Pferd gescheut und mich abgeworfen, “ berichtete er.
„Hast Du dich sonst noch verletzt?“ fragte ich ihn.
Er deutete auf seinen rechten Fuß.
„Der Knöchel tut ziemlich weh, sonst wäre ich selbst zurückgekommen.“
Jason und ich kamen zu dem gleichen Ergebnis. Wir mussten ihm so schnell wie möglich den Stiefel ausziehen und hofften, dass der Fuß noch nicht zu sehr angeschwollen war. Ich öffnete den Reißverschluss und hob das Bein mit dem Stiefel leicht an. Norman biss die Zähne zusammen, als ich den Absatz mit der einen und die Spitze mit der anderen Hand fasste. Vorsichtig und ohne den Fuß zu verdrehen, zog ich. Der Stiefel saß so fest, dass ich Norman fast vom Baum wegzog.
„Das kommt davon, wenn man seine Riesentreter in viel zu kleine Stiefel zwängt“, urteilte Jason.
Norman keuchte. „dass kleine Brüder immer so schlau sind?“
Der konterte mit einem Wort: „Bananentee!“
Ich musste grinsen und bat Jason seinen Bruder am Knie festzuhalten, damit ich es noch einmal versuchen konnte. Wir stemmten unsere Füße gegeneinander damit ich genug Halt hatte und dann versuchte ich es mit einem kräftigen Zug. Als der Stiefel widerwillig nachgab, zog ich weiter und dann fiel ich mit samt dem Stiefel auf den Rücken. Es war geschafft. Norman standen Schweißperlen im Gesicht und rang nach Luft. Ich konnte mir vorstellen wie schmerzhaft die Aktion für ihn war aber je länger man dabei wartet, desto schlimmer wird es.
„Ist der Fuß noch dran oder habt ihr ihn abgerissen?“ erkundigte sich der Unglückliche keuchend.
Jason erhob sich.
„Wir konnten von einer Amputation gerade noch einmal absehen“, erklärte er.
Vorsichtig zog ich die Socke aus und konnte schon eine Schwellung des Gelenkes feststellen. Ich schob mein Knie unter seine Wade.
„Probiere mal wie Du den Fuß bewegen kannst.“
Er tat es ganz vorsichtig und ich hatte den Eindruck, dass nichts gebrochen war. Gemeinsam mit Jason half ich ihm auf. Er versuchte mit dem Fuß aufzutreten, ließ es dann aber, weil es zu schmerzhaft war. Auf unsere Schultern gestützt hüpfte Norman zum Wagen und ließ sich auf dem Beifahrersitz nieder. Jason hockte sich auf die Ladefläche und ich fuhr los. Als wir an der Wasserstelle vorbeikamen, hielt ich an und reichte Jason das Hemd nach hinten, welches ich kurz vor unserer Abfahrt von dem Ast genommen hatte.
„Mach das mal nass bitte.“
Jason sprang vom Wagen und zog das gute Stück durchs Wasser. Leicht ausgewrungen gab er es mir zurück. Ich beugte mich auf Normans Knie und wickelte das nasse Hemd um seinen Knöchel.
„Gute Idee“, fand Norman und lächelte dankbar.
„Toller Service“, rief Jason von der Ladefläche durchs Schiebedach.
„Ich dachte DU willst Arzt werden“, gab ich zurück, legte den Gang ein und fuhr los. Dank Normans Beschreibung war der Weg zum Haus gar nicht so weit wie ich dachte.
Frau van de Waal sah vom Garten aus wie wir Norman auf die Veranda in einen Liegestuhl verfrachteten und verfiel in helle Aufregung. Es dauerte eine Weile bis wir ihr erklärt hatten was passiert war. Sie rief das Dienstmädchen nach Tüchern und holte eine Flasche mit medizinischem Alkohol aus dem Haus.
„Ich mache das schon“, sagte ich, als sie mit der Flasche zurück kam.
Norman entschuldigte sich bei ihr wegen der Umstände, die er ihr machen würde aber sie wollte davon nichts wissen und nahm mir das nasse Hemd ab, das ich nun gegen alkoholgetränkte Tücher tauschte. Jason schickte ich zwischenzeitlich zum Wagen, um eine elastische Binde aus dem Verbandskasten zu holen. Bald war der Verband fertig und ich begann seinen anderen Stiefel auszuziehen. „Woher hast Du die?“ fragte ich ihn.
„Sie gehören Philippe und standen in der Sattelkammer.“
Wie ich an der Sohle erkennen konnte, waren sie Größe 11 1/2. Kein Wunder also, dass ich ihn auch vom gesunden Fuß nur sehr schwer herunter bekam. Seine Turnschuhe hatten immerhin Größe 13.
„Soll ich die Stiefel zurückbringen und Deine Turnschuhe holen?“
„Ja das wäre lieb von Dir und frage mal nach, ob sich das Pferd wieder beruhigt hat“, bat Norman.
Jason begleitete mich.
„Könnt ihr nicht bis zum Wochenende bleiben?“ fragte er unterwegs.
„Das musst Du deinen Bruder fragen.“
„Und wenn Du ihn darum bittest?“
Ich schüttelte den Kopf. „Das kann ich nicht.“
Offensichtlich wusste er wie ich das meinte. „Er bestimmt immer alles, nicht wahr?“
Ich schaute Jason kurz an. „Er ist schließlich mein Boss.“
„Und Du tust alles für ihn, stimmt’s?“
Die einzige Antwort, die mir dazu einfiel war: „Ich will nicht, dass er deswegen mit mir streiten muss. Dafür mag ich ihn viel zu sehr.“
Den Nachmittag verbrachten wir auf der Veranda. Norman versuchte ein paar Schritte aber das Auftreten tat ihm noch zu weh. Jede halbe Stunde wechselte ich den Verband und tränkte das Tuch erneut mit dem kühlenden Alkohol. Nach dem Kaffeetrinken drängte Norman zum Aufbruch. Er bat mich mit Herrn van de Waal die Lebensmittel in den Wagen zu laden und blieb so lange mit Jason zurück. Eine Stunde später hatte ich den Wagen vollgepackt vor dem Haus. Ich wollte noch einmal den Verband wechseln aber das hatte Jason schon getan. Ich bedankte mich bei den van de Waals und verabschiedete mich von Jason, nachdem wir Norman gemeinsam zum Wagen gebracht hatten.
Ich gab ihm die Hand und fasste mit der anderen seine Schulter.
„War super, dass ich Dich kennen gelernt habe. Hoffentlich sehen wir uns mal wieder.“
„Ja das hoffe ich auch“, sagte Jason und umarmte mich kurz. Bevor wir uns trennten, sagte er leise: „Du bist zu gut für Kabunda. Genau wie Norman. Vergiss das bitte nicht.“
Als ich in den Wagen stieg, war ich sehr traurig. Ich wäre so gerne noch länger geblieben. Es war so schön aber als ich Norman neben mir hatte dachte ich, dass es ihm vielleicht genauso ging und versuchte mir nichts anmerken zu lassen.
Wir kamen im Dunklen in Kabunda an. Ich parkte direkt vor der Kantine und bat Kitty mir jemanden zu schicken, der mir beim Ausladen der Lebensmittel half. Damit Norman nicht aussteigen musste, nahm ich unser Abendessen mit in die Unterkunft.
Als wir dort angekommen waren, wechselte ich zuerst seinen Verband. Bevor ich aufstehen konnte, drückte er mich an sich.
„Danke Micha. Ich wüsste nicht was ich ohne Dich tun sollte.“
Ich war etwas verlegen. „Nichts zu danken. Du kümmerst Dich ja auch um mich und ich bin Dir sehr dankbar für den schönen Ausflug.“
„Ich glaube Jason mag Dich.“
„Ich mag ihn auch. Du kannst stolz auf Deinen Bruder sein.“
Norman nickte zustimmend und dann machten wir uns über das Abendessen her.
An den nächsten beiden Tagen fiel es mir sehr schwer, mich wieder an den Alltag in Kabunda zu gewöhnen. Norman war kein leidiger Patient. Er nahm meine Hilfe nur in Anspruch, wenn es unbedingt nötig war. Er war allerdings sehr ungeduldig und das war eine Sache, die mich ziemlich nervte. Die andere war, dass ich nach den zwei Tagen bei den van de Waals wieder große Sehnsucht nach Abwechslung und anderen Menschen bekommen hatte.
Es war der 22. September. Ein Blick auf den Kalender verriet mir, dass ich gerade die Hälfte der Zeit hinter mir hatte. Bis Mitte Dezember war es noch knapp ein Vierteljahr. Ich musste wieder an die letzten Worte von Jason denken. „Du bist zu gut für Kabunda.“
Ich glaube er wollte damit sagen: „Bleibe nicht zu lange da, sonst bist Du nicht mehr der, der Du warst.“
In dieser innerlichen Krise musste ich mich zu allem zwingen was ich tat und über allem lag ein dumpfes, bedrückendes Gefühl. Am Sonntag hielt ich es nicht mehr aus. Ich konnte meine Stimmung vor Norman nicht mehr verbergen und musste irgendwie mit mir ins Reine kommen. Zum Glück fragte er nicht warum ich eine Weile allein sein wollte aber er ahnte wohl, dass ich auf den Abraumhügel steigen würde.
Da oben über den Baumwipfeln legte ich mich mit dem Bauch auf den abgestorbenen Baumstamm und ritzte Figuren in den staubigen Boden.
Mir gingen viele Dinge aus meiner Kindheit durch den Kopf. Er gab nichts, was ich zu bereuen oder zu beklagen hatte. Bisher war ich mit allem klargekommen. Ich war stolz darauf, dass ich mir alles was über den üblichen Rahmen hinausging selbst erarbeitet hatte und dass ich jetzt hier war, war ganz alleine meine Entscheidung.
Es war doch auch schön und aufregend den Job als Pilot bekommen zu haben. Ich erinnerte mich an den Moment, als ich Norman kennen lernte. Wie toll ich mich fühlte, als ich neu eingekleidet wurde und meinen ersten Flug mit ihm machte. Vor allem aber an den Abend, der hier oben begann und so unbeschreiblich war. Das alles war ja nicht vorüber. Es hatte nur seinen Preis. Als Norman mich fragte, ob ich bleiben wolle, wusste ich wie hart das Fliegen und wie einsam es im Camp war. Trotzdem hatte ich ohne zu zögern ja gesagt und deshalb war ich noch hier.
Ich dachte auch an meinen Freund Patrick. Er musste jetzt mitten in der Grundausbildung bei der Luftwaffe stecken und hatte seine Pilotenausbildung noch vor sich. Ich war mir sicher, dass ihm nun auch ein hartes Leben bevorstand. Es ist eben nicht leicht erwachsen zu werden und ich wollte aufhören, mir selbst leid zu tun.
Als ich mich nach fast drei Stunden erhob, stand die Sonne schon ganz tief. Ich fühlte mich wieder freier und schaute mir die Landschaft an. Mit ausgebreiteten Armen schrie ich hinaus: „Zaire, Sambia, Angola und Mozambique, ab morgen habt ihr mich wieder. Ich, Kapitän Micha von Kabunda-Transafrican-Airways!“
Den Namen hatte ich spontan erfunden und er gefiel mir irgendwie.
Bevor ich zu Norman zurückkehren wollte, wartete ich den Sonnenuntergang ab. Mir fielen dabei zwei Songs von Elvis Presley ein, den ich stimmlich einigermaßen gut imitieren konnte und so sang ich LOVE ME TENDER und ARE YOU LONESAM TONIGHT, bis die Sonne langsam am Horizont verschwand.
Halb rutschend, halb laufend, bewegte ich mich nun den Abhang hinunter. Norman saß im Schein einer Öllampe auf der Bank hinter der Unterkunft. Als ich um die Ecke bog, strahlte er mich an und breitete die Arme aus.
„Schön, dass Du wieder da bist. Geht es Dir wieder besser?“
„Woher weißt Du, dass es mir nicht gut ging?“
Er legte seinen Arm um mich und seinen Kopf auf meine Schulter. „Ich habe es gespürt und an Deinen Augen gesehen.“
„Es ist wieder okay“, sagte ich.
„Du warst oben, nicht wahr?“
Ich nickte.
„Sollen wir nachher ein Glas Rotwein trinken?“ fragte er und drehte sein Gesicht zu mir.
Ich schaute in seine Augen. „Erst zum Training dann zum Essen und dann alles was Du willst.“
Norman schlug sich auf die Schenkel und lachte. „Ach Micha, wenn Du wüsstest wie süß Du manchmal bist.“
In den nächsten zweieinhalb Wochen lief alles nach Plan und es ging mir gut. Ich hatte wie jeden Mittwoch den Nachmittag bei Sam im Hangar verbracht und die `Paula` frischem Öl versorgt. Als Norman mit Steve aus Lubumbashi zurückkam, war er gut gelaunt zur Mine gefahren. Auf dem Weg zur Unterkunft machte er ein besorgtes Gesicht.
„Was ist los?“ fragte ich.
„Wir haben ein Problem mit einem der Bohrer. Ein Rohr ist leckgeschlagen und wir haben kein passendes hier, “ erklärte er mir.
„Wir haben morgen frei“, stellte ich fest. „Können wir irgendwo eins holen?“
Norman schüttelte den Kopf. „In Kamina haben wir welche aber die sind acht Meter lang und haben an den Enden Spezialgewinde. Man kann sie also nicht einfach durchschneiden. Außerdem würde es mit einem Auto viel zu lange dauern. “
Ich ließ mir das Rohr erklären. Es handelte sich um eine Zuleitung von einer Hochdruckpumpe zu einem Bohrgestänge und diente der Zuführung von Kühl- oder Bohrflüssigkeit unter hohem Druck. Es hatte einen Außendurchmesser von einem Zoll und eine Wandstärke von etwa drei Millimetern. Ich dachte an ein besseres Wasserrohr und schätzte das Gewicht auf zwei bis drei Kilo pro Meter, also maximal vierundzwanzig Kilo.
„Warum willst Du das so genau wissen?“ fragte Norman erstaunt.
„Kannst Du etwa einhundert Meter Seil besorgen, das etwa fingerdick ist?“ hakte ich nach.
„Ja, vielleicht nicht an einem Stück aber warum fragst Du?“
„Weil ich das Rohr holen werde, wenn Du willst.“
Norman hielt vor der Unterkunft und schaute mich an, als wollte ich ihn auf den Arm nehmen.
„Ach komm Micha. Willst Du das Ding etwa auf die Tragfläche binden?“
Ich schaute ihn etwas beleidigt an. „Nein, natürlich nicht. Warum vertraust Du mir nicht. Ich weiß wie das geht und wenn es so wichtig ist, Lass mich doch einfach mal machen.“
Norman hob die Hände. „Okay, okay. Ich kann es mir zwar nicht vorstellen aber bitte.“
Es klang eher genervt aber das störte mich diesmal nicht. Ich hatte einen Plan und die Sache begann mir Spaß zu machen.
„Dann bringe mich zu Sam zurück, besorge mir das Seil und was zu essen, ich habe nämlich Hunger.“
„Und was ist mit dem Training?“
Ich schaute ihn wieder an. „Training oder Rohr? Was willst Du?“
„Okay, Du hast gewonnen“, meinte er und wendete den Wagen.
Die Vorbereitungen bedeuteten ein paar Stunden Arbeit aber das war zu schaffen, wenn Sam mitmachte. Mein Plan war relativ einfach. Ich war Segelflieger und hatte gelernt wie man Seile spleißen kann. Außerdem hatte ich nicht nur das Schleppen von Segelflugzeugen, sondern auch von Werbebannern mit Motorflugzeugen gelernt, was in keiner Weise das Gleiche war. Ich würde das Rohr auf die gleiche Weise befördern wie ich in Deutschland die Banner geschleppt hatte und dafür brauchte ich nur das richtige Werkzeug.
Als ich Sam meinen Plan erklärt hatte, nickte er bedächtig.
„Ich habe So was noch nie gesehen aber es klingt nicht schlecht. Was brauchst Du mein Junge?“
Ich brauchte einen Stahlring, der in die Schleppkupplung der `Paula` passte. Sie war das einzige Flugzeug, das mit einer solchen Kupplung ausgerüstet war und ich wusste, dass sie funktionierte. Außerdem brauchte ich einen Fanganker, den ich Sam beschrieb und auf einem Zettel aufzeichnete.
Sam nickte und ging auf die Suche nach geeignetem Material. Nach einer Weile hatte er ein paar Eisenstangen und verschiedene Stahlringe auf der Werkbank. Ich suchte mir einen Ring aus, der in die Kupplung passte. Sam schnitt drei Eisenstangen auf die nötige Länge, spannte die erste in den Schraubstock und warf den Schweißbrenner an.
Bis Norman kam suchte ich mir zwei Holzlatten von etwa zwei Metern Länge, spitzte sie an einem Ende an und kerbte das andere Ende ein.
Norman brachte nicht nur das Abendessen, sondern auch eine Trommel mit nagelneuem Hanfseil. Die Stärke war okay und es waren einhundert Meter auf der Trommel. Ich war mehr als zufrieden aber erst einmal hatte ich Hunger.
Nach dem Essen schaute ich mir an, wie weit Sam mit dem Anker war. Die drei Stangen hatte er bereits mit Hilfe des Schweißbrenners wie ein Schmied in die richtige Form gebogen. Jetzt mussten sie nur noch sternförmig zusammengeschweißt und oben mit einem Stahlring versehen werden.
Ich suchte nach etwas, womit ich die Seile spleißen konnte. Zu meinem Erstaunen kramte Sam aus seinem Werkzeugschrank eine Spleißahle hervor.
Ich ließ Norman die Seiltrommel halten und rollte zunächst einmal zwölf Meter ab. Das wurde mein Ankerseil. Auf dem Boden sitzend spleißte ich eine kleine Schlinge um den Stahlring für die Kupplung. Auf eine Kausche und eine Sollbruchstelle musste ich leider verzichten. Dafür fehlte mir das Material und es musste ja auch nur diese eine Aktion überstehen. Sam schaute sich meinen ersten Spleiß an und nickte anerkennend. Um diesen ineinander gehäkelten Seilverschluss noch besser zu sichern, gab er mir Klebeband zum Umwickeln.
Als nächstes spulte ich draußen die restlichen achtundachtzig Meter von der Trommel und legte ein Seilende in eine Schlaufe, die groß genug war, um sie auf den beiden Holzlatten im Abstand von vier Metern wie eine Wäscheleine aufspannen zu können. Dort wo die Schlaufe in das restliche Seil übergehen sollte, spleißte ich das Endstück ein. So blieb mir ein sechzig Meter langes Seil plus der Schlaufe. Norman konnte sich noch immer nicht vorstellen was ich damit vorhatte aber ich genoss es, ihn auch einmal vor vollendete Tatsachen zu stellen.
Der letzte Akt war das Einspleißen des Fangankers an das andere Ende des Ankerseils. Sam hatte die drei vorbereiteten Teile bereits zusammengeschweißt und schweißte jetzt nur noch den Stahlring an das obere Ende. Das Ding sah gut aus. Die drei Zacken waren sauber nach innen gebogen, damit sich der Anker nicht im Boden festkrallen konnte, wenn ich damit eine Idee zu tief anfliegen sollte.
Als ich das Ankerseil fertig hatte, klinkte ich es mit der Öse in die Schleppkupplung und bat Sam es auf Zugspannung zu halten. Im Cockpit zog ich den Ausklinkhebel und der Stahlring löste sich wie gewünscht aus der Kupplung.
Nach gut zwei Stunden Arbeit waren wir fertig und fuhren in die Unterkunft. Ich merkte, dass Norman gespannt war aber er blieb fair und vertraute mir ohne weiter zu fragen.
Zur gleichen Zeit wie jeden Morgen flogen wir los. Das Zubehör lag im Laderaum und ich steuerte mein neues Ziel Kamina an, wo die Gesellschaft ihre zweite Mine betrieb. Unser Ziel lag etwa vierhundert Kilometer nordwestlich von Lubumbashi, also 630 Kilometer von Kabunda entfernt. Die Flugzeit würde etwa dreieinhalb Stunden betragen.
Eine ganze Weile konnte ich dem Luapula folgen, bis er endgültig seinen Weg nach Norden nahm. Danach folgte eine lange Strecke über bewaldetes Gebiet, nordöstlich an Lubumbashi vorbei. Dann überflogen wir einen großen See, dessen Name mir auf der Karte schon fast Augenschmerzen verursachte. Er hieß ‚Lac de Retenue de la Lufira‘. Er war für afrikanische Verhältnisse nicht groß aber mir kam er für meine Verhältnisse riesig vor. An den Uferbereichen konnte ich Eingeborene mit kleinen Kanus erkennen, die wahrscheinlich mit Fischfang beschäftigt waren. Ich genoss jede Meile, die ich neu entdecken konnte. Nach einem weiteren Waldgebiet musste ich einen Gebirgszug überfliegen, dessen kahle Erhebungen zum Teil mehr als 2000 Meter hoch waren. Dies war der schönste Teil des Fluges. Bei Lubudi überquerte ich die Eisenbahnlinie, die sich durch Schluchten ihren Weg durch das Gebirge in Richtung Kamina bahnte. Dann führte der Kurs fast eine Stunde über einsames Waldgebiet.
Am südlichen Rand der kleinen Industriestadt befand sich der kleine zivile Flugplatz. Er verfügte sogar über eine betonierte Start- und Landebahn mit einfacher Nachtflugbeleuchtung. Außer einem kleinen Holzgebäude gab es nichts. Außer uns stand abseits nur eine betagte DC 4 Frachtmaschine herum. Ob sie noch flugfähig war, konnte ich nicht erkennen.
Ich parkte vor dem kleinen Gebäude, wo wir offensichtlich schon erwartet wurden. Norman erkannte den noch jungen Einheimischen und begrüßte ihn sehr herzlich und wortreich. Leider konnte ich nichts verstehen, da sie französisch sprachen. Norman stellte mich aber vor. Sein Bekannter war bis vor einigen Jahren in Kabunda gewesen und hatte es nun in Kamina zum Vorarbeiter gebracht.
Hinter dem Flugplatzgebäude stand ein kleiner LKW. Hinten ragte das begehrte Rohr weit über die Ladefläche hinaus. Ich zog es heraus und es war schwer in der Hand. Allerdings nicht schwerer als die von mir geschätzten vierundzwanzig Kilo.
Ich bat Norman hundert Liter Sprit zu ordern. Ich wollte nicht mehr Last mitnehmen als nötig. Nach einer anschließenden Pause mit Tee und Fladenbrot, begann ich den Transport vorzubereiten. Diesmal erklärte ich Norman genau was ich tat. Wir brachten das Rohr, das Seil mit der Schlaufe und die beiden Holzlatten auf die Grasfläche neben der Mitte der Startbahn. Auf dem trockenen Gras würde dem Außengewinde am hinteren Ende des Rohrs nichts passieren wenn es bei der Aufnahme einige Meter über den Boden schleifen würde. Trotzdem umwickelte ich es mit einem Putzlappen und sicherte ihn mit Klebeband. Einige Meter vor dem vorderen Ende des Rohrs versuchte ich das Kunststück, die beiden Holzlatten im Abstand von ungefähr vier Metern in den harten Boden zu spießen. Zum Glück hatte ich daran gedacht, einen Meißel und einen Hammer mitzunehmen, womit ich ein keilförmiges Loch in den harten Boden meißelte. Nachdem die Holzlatten darin aufrecht standen, legte ich die große Seilschlaufe darüber. Das freie Ende des langen Seils schob ich innen durch das Rohr und sicherte es mit einem dicken, mehrfachen Knoten. Zur Sicherheit quetschte ich noch einen Lappen zwischen Rohrinnenwand und Seil, damit der Knoten bei der enormen Beschleunigung nicht so leicht von den Rohrwandungen abgeschert werden konnte.
Jetzt hatte Norman begriffen was ich vorhatte. Er schüttelte den Kopf.
„Das Stück Seil zwischen den beiden Latten willst Du mit dem Anker am Flugzeug treffen?“
„Ja klar“, gab ich mich zuversichtlich. Ich wusste, dass es schwer ist aber mit den Werbebannern ging es genauso und das hatte ich schon oft gemacht. Meine einzige Sorge war, dass das Rohr beim Aufnehmen oder Abwerfen eine Biegung bekommen könnte und das hoffte ich mit spezieller Flugtechnik zu vermeiden.
Ich schaute noch einmal nach, ob alles richtig lag und marschierte mit Norman zum Flugzeug.
Hier befestigte ich das Ankerseil mit der Öse an der Schleppkupplung am Heck und nahm den Anker mit in das Cockpit. Das Seil zog ich durch das Klappfenster.
Nach dem Start auf der Betonbahn, warf ich den Anker aus dem Fenster. Durch sein Eigengewicht musste er nun drei bis vier Meter unter der dem Niveau des Fahrwerkes hängen. In einem großen Bogen flog ich zum Flugplatz zurück, setzte halbe Klappen und ging mit genau vorgegebener Geschwindigkeit in den Sinkflug neben der Betonbahn. Ich wusste, dass ich das aufgespannte Seil erst im letzten Moment sehen würde aber ich hatte mir die Position vorher eingeprägt. Jetzt kam es darauf an, in ziemlich genau vier Metern Höhe mit der richtigen Geschwindigkeit über das Tor zu fliegen. Etwa vierhundert Meter vorher sah ich es und hielt genau auf die linke Latte zu. Es gab etwas Seitenwind von links und deshalb vermutete ich den Anker ein wenig rechts von mir. Als ich das Tor überflogen hatte, gab ich augenblicklich Vollgas und zog die Maschine steil hoch.
„Wenn es jetzt einen Ruck gibt, dann haben wir es“, sagte ich schnell zu Norman.
Ich hatte es kaum ausgesprochen, da kam auch schon der Ruck. Er war heftiger als ich erwartet hatte aber ich konnte mit einem leichten Nachdrücken die Geschwindigkeit gut stabilisieren. Die Hand, die ich vorsichtshalber am Ausklinkhebel hatte, konnte ich nun zurückziehen.
Norman war ganz aus dem Häuschen.
„Das ist ja irre“, rief er ins Mikrofon. Ich flog eine enge Kurve, um unsere Fracht hinter und unter uns hängen zu sehen. Mir schien, als sei das Rohr noch gerade und freute mich diebisch.
Die `Paula` hatte ganz schön zu ziehen und schaffte nur fünfundsiebzig statt normalerweise hundert Knoten.
Gegen vier Uhr nachmittags erreichten wir Kabunda. Ich bemühte mich das Rohr möglichst schonend abzulegen. Sam wusste Bescheid. Ich flog langsam an, um mit dem hinteren Ende des Rohrs auf der ersten Hälfte der Landebahn den Boden zu berühren. Sam sagte mir über Funk wenn es soweit war und dann klinkte ich das komplette Seilzeug aus der Kupplung aus.
Nach der Landung liefen wir auf die Piste und schauten uns das Rohr an. Es war unbeschädigt. Norman und Sam erdrückten mich fast und ich glaubte, dass es nicht wegen des Rohrs, sondern wegen meiner verrückten Idee war.
„Ja mein Junge, da kann selbst ich auf meine alten Tage noch etwas lernen, “ meinte Sam und grinste sich in den Bart.
„Den Einbau sollen aber andere machen“, stellte ich zur allgemeinen Erheiterung klar.
Am Abend schaute ich mir die Flugstrecke noch einmal auf der Karte an.
„Warum hast Du das gemacht?“ fragte Norman und schaute mir über die Schulter.
„Es hat mir Spaß gemacht. Ich habe ein neues Stück Afrika entdeckt und das war es mir wert, “ antwortete ich.
„Du hast mir einigen Ärger erspart“, stellte Norman fest.
„Ärger mit Deinem Vater?“
Er nickte. „Ein längerer Produktionsausfall hätte ihn nicht gerade erfreut.“
„So was Ähnliches habe ich mir gedacht und er hätte die Verantwortung auf Dich abgeladen, stimmt’s?“
„Wie kommst Du darauf?“ fragte er hastig.
„Habe ich so im Gefühl. Es ist doch ziemlich einfach sich im Hintergrund zu halten und anderen die Verantwortung zu geben wenn mal etwas schief geht, “ sagte ich.
Normans Blick funkelte etwas unangenehm.
„Hat Dich mein kleiner Bruder damit geimpft?“
Ich hatte wohl einen wunden Punkt getroffen und spürte, dass es angebracht war, die Wogen zu glätten.
„Bitte Lass Jason aus dem Spiel. Ich habe Dir meine ehrliche Meinung gesagt aber es steht mir nicht zu, mich in Deine Angelegenheiten einzumischen.“
Norman holte tief Luft. „Okay, lassen wir das Thema, das bringt nichts.“
Ich fand es schade, dass er hier abblockte aber mir blieb nichts anderes übrig, als es so hinzunehmen.
Die nächste Woche verlief sehr schön. Norman war sehr liebesbedürftig. Wir gingen abends früher als üblich ins Bett, um später als üblich einzuschlafen. Ich genoss diese Zeit und die gute Laune, die sich tagsüber ausbreitete. Das änderte sich für mich am nächsten Mittwoch.
Ich half Sam die ´Doris´ fertig zu bekommen. Steves Flugzeug war schon drei Tage wegen einer großen Inspektion außer Betrieb und sollte heute fertig werden. Als die `Paula` am späten Nachmittag mit Steve und Norman aus Lubumbashi landete, waren Sam und ich fast fertig. Norman hatte Ersatzteile dabei und brachte sie mit Sam zur Mine. Ich füllte zum Abschluss frisches Öl in den Motor der `Doris` und nach jedem Liter, den ich aus dem Fass in die Kanne gepumpt hatte, stieg ich auf eine kleine Stehleiter, um an den Einfüllstutzen heranzukommen.
Da das Einfüllen sehr langsam ging und ich in Gedanken schon bei Norman war, bemerkte ich gar nicht, dass Steve plötzlich neben mir stand. Er fasste mich am Hosenbein. Ich war so erschrocken, dass mir beinahe die Kanne aus der Hand gefallen wäre.
„Was machst Du an meinem Flugzeug?“ fragte Steve ziemlich laut.
„Siehst Du doch. Ich fülle Öl auf und dann ist sie fertig, “ antwortete ich.
Seine Hand drehte den Stoff so sehr, dass er mir die Wade einschnürte.
„Du kleine Ratte hast an meinem Flugzeug nichts zu suchen“, sagte er drohend.
„Rege Dich nicht auf. Ich habe Sam doch nur geholfen, damit Du sie morgen wieder fliegen kannst, “ versuchte ich ihn zu beruhigen.
Er zog mich von der Leiter herunter und packte mich unterhalb des Kinns am Overall.
„Wenn ich sage, dass Du an meinem Flugzeug nichts zu suchen hast, dann meine ich das auch so.“
Sein Gesichtsausdruck war bedrohlich cool. Ich bekam Angst und das wusste er. Sein fester Griff ließ mir keinen Bewegungsspielraum und dann schlug er mir mit der anderen Faust in den Magen. Ich wollte mich vor Schmerz nach unten krümmen aber er hielt mich fest und verpasste mir einen weiteren Fausthieb ins Gesicht, wobei er mich losließ und ich rückwärts durch die halbe Halle flog und an einem Stützpfeiler liegen blieb.
Ich sah regelrecht Sternchen vor meinen Augen und rollte mich instinktiv zusammen. Irgendwie nahm ich Steves Stiefelspitzen war, die nun vor mir standen. Meine Angst, dass er weiter zuschlagen oder treten würde war so groß, dass ich am ganzen Körper zitterte. Es geschah eine Weile nichts und dann hörte ich ihn sagen: „Wenn Du mein Flugzeug noch mal anfasst, breche ich Dir sämtliche Knochen.“
Es war deutlich zu hören, dass er sich umdrehte und langsam aus der Halle schlurfte. Am deutlichsten spürte ich einen brennenden Schmerz im Gesicht und einen dumpfen Schmerz im Bauch. Mir war richtig schlecht und ich hatte Mühe aufzustehen. Ich tastete vorsichtig an mein Gesicht und bemerkte Blut an meinen Fingern. Durch den Schlag in die Magengegend konnte ich nicht gerade stehen. Ich wollte nur weg von hier und schleppte mich in die Unterkunft.
Im Spiegel erkannte ich, dass meine Oberlippe und meine rechte Augenbraue aufgeplatzt waren. Mit einem angefeuchteten Handtuch wischte ich das Blut ab und legte mich vorsichtig auf mein Bett.
Warum? Was habe ich ihm getan, dachte ich verzweifelt. War es wegen dem Flug mit dem Stahlrohr, den er mir nicht gönnte? Mir fiel keine andere Erklärung ein, bis ich Normans Wagen scharf abbremsen und ihn hereinstürmen hörte. Sein erster Weg war in mein Zimmer.
„Was ist passiert?“ fragte er und kniete sich vor mein Bett.
Es war mir unangenehm. Ich wollte ihn nicht in den einseitigen Streit zwischen Steve und mir hineinziehen und zögerte.
Norman drehte mein Gesicht zur Seite.
„Mann, wie siehst Du denn aus? Hat dich Steve etwa so zugerichtet?“
„Ja“, antwortete ich und jetzt war es heraus. Jetzt war Norman in die Sache hineingezogen. Es ließ sich nicht vermeiden.
„Dieser Mistkerl“, schimpfte er, „wenn ich den in die Finger kriege, sieht er mindestens genauso aus.“
Nachdem er mir die Stiefel und den Overall ausgezogen hatte, holte er ein nasses Handtuch und reinigte die Wunden an meinem Gesicht sehr gründlich, bevor er sie mit Jod behandelte. Ich hasste Jod schon seit meiner Kindheit. Wenn die Verletzung auch weh tat, mit Jod tat es erst richtig weh. So war es auch jetzt wieder.
„Habt ihr gestritten?“ wollte Norman wissen und gab keine Ruhe, bis ich ihm alles genau erzählte, was sich in dem Hangar abgespielt hatte.
Norman war wütend, das sah ich ihm an.
„dass ihr beiden keine Freunde seid, war mir schon klar aber dass er Dich verprügelt weil Du Sam an seinem Flugzeug geholfen hast, das ist der Gipfel.“
„Bitte fang Du nicht auch noch an mit der Prügelei“, bat ich ihn.
„Soll ich etwa so tun als ob nichts gewesen wäre? Dann denkt er doch ich fände es gut was er mit Dir gemacht hat.“
Ich war mir unsicher.
„Aber wenn Du ihn verprügelst, dann kriege ich es doch erst recht bei nächster Gelegenheit wieder.“
„Nein. Ich werde dafür sorgen, dass das aufhört.“
Damit war für Norman die Diskussion zunächst einmal beendet. Bevor er mit mir in den Kraftraum fuhr, machte er einen Umweg zur Hangar. Mit Sam hatte er die Ölkanne neben einer Öllache und an der anderen Seite des Hangars meine Blutspuren entdeckt. Sam hatte deshalb ein Recht darauf zu erfahren, was passiert war.
Mir war nicht nach Training und Norman akzeptierte das. Ich setzte mich in der Ecke auf den Boden, hielt mir den Bauch und schaute Norman zu. Er machte es ähnlich wie ich, wenn ich Wut im Bauch hatte. Er zog sich die Boxhandschuhe an und schlug wie besessen auf die Boxbirne ein.
Zwei Tage später erfuhr ich von Sam, dass Norman und Steve eine lautstarke Auseinandersetzung gehabt hatten, bei der es darum ging, mich künftig in Ruhe zu lassen. Ich verließ mich allerdings nicht darauf und passte meinerseits auf, Steve möglichst nicht zu begegnen.
In der kommenden Woche gab es zwei Tage mit Gewittern. Ich hatte allerdings Glück, denn es waren der Mittwoch und der Donnerstag. Da die monatliche Fahrt zu den van de Waals anstand, lernte ich kennen, wie sich die sonst staubige Straße in einen Morast verwandeln konnte. An manchen Stellen versank unser Geländewagen bis zu den Achsen im Morast. Nur dem Allradantrieb und Normans Geschick war es zu verdanken, dass wir unser Ziel nach drei Stunden erreichten.
Beim Mittagessen wandte sich Herr van de Waal an mich und fragte, ob ich bei gutem Wetter auf einer Weide neben den Stallgebäuden landen könnte.
„Ja klar“, sagte ich. „Ich wünschte, ich hätte immer so gute Landemöglichkeiten.“
Frau van de Waal, die soeben noch mit Norman sprach, schaltete sich ein und lachte.
„Damit liegt er mir nun schon seit Tagen in den Ohren. Er hat Probleme mit dem Rücken und kann nicht reiten, um die Viehzählung zu machen.“
„Kann man das mit dem Flugzeug machen?“ hakte Herr van de Waal nach.
Ich nickte. „In den Nationalparks werden auf diese Weise die Wildbestände kontrolliert. Da dürfte es bei ihren Rindern relativ einfach sein.“
„Was würde so eine Aktion kosten?“
Ich zuckte mit den Achseln. „Da müssen Sie Norman fragen. Ich würde es zwar gerne machen aber das muss er entscheiden.“
Norman war inzwischen hellhörig geworden.
„Was muss ich entscheiden?“
Ich erklärte ihm worum es ging und Frau van de Waal, der dieses Ansinnen etwas peinlich war, erklärte gleich, dass ihr Mann nur so unleidlich sei, weil er Probleme mit dem Rücken habe.
Norman überlegte einen Augenblick und stimmte dann zu.
„Was wird So was kosten?“ fragte Herr van de Waal.
Norman schüttelte den Kopf. „Das kostet nichts. Sie waren immer so gastfreundlich zu mir, zu meinem Bruder und jetzt auch zu Micha. Da machen wir einfach mal einen Testflug hierher.“
Ich fand das ganz in Ordnung und freute mich schon auf diese neue Aufgabe. Nach einigem Hin und Her einigten wir uns auf den nächsten Donnerstag.
Herr van de Waal ließ es sich nicht nehmen, uns neben den üblichen Lebensmitteln ein Rinderfilet mitzugeben und riet uns diesen Leckerbissen bei Gelegenheit zu genießen.
Auf der Rückfahrt kamen wir auf dem schlammigen Weg wieder nur langsam voran.
„Hast Du ihn auf die Idee mit dem Flugzeug gebracht?“ fragte Norman.
„Nein“, beteuerte ich, „er hat mich gefragt ob eine Viehzählung mit dem Flugzeug möglich ist. Da konnte ich doch nicht einfach nein sagen, oder?“
Norman lachte. „Ist schon okay. Aber dafür kriegst Du keine Dollars. Ist Dir das klar?“
Ich machte ein beleidigtes Gesicht. „Damit habe ich auch gar nicht gerechnet. Wofür hältst Du mich eigentlich?“
„Für meinen gutmütigen kleinen Prinzen“, sagte er.
Als ich ihm einen Stoß in die Rippen gab, hielt er abrupt an und gab mir einen leidenschaftlichen Kuss.
Das Rinderfilet gab Norman Kitty in Verwahrung. Wir grillten es am Samstagabend auf dem Hügel und es war wirklich ein Leckerbissen, zu dem Norman eine Flasche Rotwein beisteuerte.
In diesen Tagen ging es mir wirklich gut. Wir hatten eine Menge Spaß im Bett und trieben es so oft miteinander, bis die Tanks unserer Samenspender absolut leer waren. Außerdem ließ mich Norman am Sonntag richtig lange schlafen. Auch für den Rest des Tages ließ er keine Gelegenheit aus, um mit mir herumzualbern und zu schmusen.
Kapitel 3
Am Montag hieß es dann wieder früh aufstehen. Da Cameia auf dem Programm stand, war das kurz vor fünf Uhr. Ich hatte mich inzwischen daran gewöhnt, dass Norman mir jedes Mal rücksichtslos die Bettdecke wegnahm. Er konnte es nämlich nicht leiden, wenn ich mich noch einmal umdrehte. Wenn ich dann nicht sofort aufstand, hob er mich an Händen und Beinen aus dem Bett und legte mich auf den harten Holzboden davor. Spätestens dann wankte ich noch halb schlafend ins Bad. Da ich nach vier Monaten immer noch ein Morgenmuffel war, empfand ich das Antreiben von Norman als ziemliche nervige Hetze. Immer wenn es auf die lange Strecke nach Cameia ging, war er so ehrgeizig, noch vor sechs Uhr in der Luft zu sein.
Im Grunde hatte er recht, denn nur so konnten wir rechtzeitig vor Sonnenuntergang wieder hier sein und hatten noch ein wenig Reserve aber so früh am Morgen war mir das noch ziemlich egal.
Sam hatte meine `Anny` heute für einen Ölwechsel aus dem Verkehr gezogen und die `Paula` nach vorne gestellt.
Das erste Tageslicht versprach wieder einen wolkenlosen Himmel und hohe Temperaturen. Der Hinweg war meist sehr angenehm, weil man die Sonne im Rücken hat und Turbulenzen durch stärker erwärmte aufsteigende Luft erst gegen zehn Uhr einsetzen. Für mich war das immer eine gute Gelegenheit nach Tieren Ausschau zu halten, die auf der Steppe weideten oder Wasserstellen aufsuchten. Wenn ich fünfhundert Meter über Grund oder höher flog, konnte ich sie zwar nicht so gut erkennen, flog ich aber tiefer, ergriffen sie meist die Flucht und das wollte ich nicht.
An diesem Morgen entdeckte ich einige Giraffen. Das kam sehr selten vor und ich genoss es, weil mich diese Riesen so faszinierten. Gnus und Antilopen sah ich fast bei jedem Flug. In dieser Jahreszeit kreuzten aber auch immer wieder Zugvögel meinen Kurs von Nord nach Süd. Heute war es eine lange Reihe Weißstörche, von denen ich respektvoll Abstand hielt.
Bei der Landung in Cameia war ich gut gelaunt. Es war so ruhig und friedlich an der Safarihütte, neben der sich unser Landestreifen befand. Die Safarigäste waren tagsüber im Cameia Nationalpark unterwegs und so hatten wir sie ganz für uns alleine. Was uns die schwarze Köchin mittags servierte, schmeckte meistens gut und war trotzdem anders als das Essen in unserer Kantine.
Draußen hatten die beiden Angolaner das Flugzeug aufgetankt und den klapprigen LKW beiseite gefahren. Norman hatte auf dem Weg zum Flugzeug seine Hand auf meine Schulter gelegt. Routinemäßig schaute und kontrollierte ich den Flieger rundherum und musste feststellen, dass sich unter dem Rumpf ein Ölfilm befand, der an der Motorverkleidung begann.
Ich zeigte Norman was ich entdeckt hatte und musste dem nachgehen. Um die Motorverkleidung abzunehmen, setzte mich Norman auf seine Schulter und nahm mir kurz darauf den oberen Teil der Verkleidung ab.
Ich konnte nichts Auffälliges entdecken und baute deshalb auch die untere Verkleidung ab, die innen ganz verölt war und das begann ziemlich weit vorne.
Zuerst prüfte ich den Ölstand mit dem Peilstab. Es fehlten zwei Liter. Ein Liter war nach unserer Flugstrecke normal, also hatten wir einen Liter zusätzlich verloren und ich wusste nicht weshalb.
Ich entschloss mich einen Standlauf zu machen und bat Norman zu schauen, ob es irgendwo zu tropfen beginnen würde.
Nachdem ich den Motor zweimal auf hohe Drehzahl gebracht hatte, kreuzte Norman die Arme und gab mir damit das Zeichen, den Motor abzustellen.
Er zeigte vorne auf den Ölkühler.
„Da war etwas aber der Propellerwind hat es nach hinten gewirbelt“, beschrieb er mir.
Ich holte mir die leere Holzkiste aus dem Laderaum, um den Ölkühler besser untersuchen zu können.
„Ich habe es gefunden, “ rief ich und zeigte Norman einen der beiden Ölschläuche, von dem ich nicht wusste, ob es die Hin- oder Rückleitung war. Der Schlauch war porös und an einer Stelle undicht geworden.
„Haben wir einen Ersatzschlauch dabei?“ wollte Norman wissen.
Ich schüttelte den Kopf. „Ich weiß auch nicht wie ich den flicken kann. Der wird heiß und das Öl hat hier einen ziemlichen Druck.“
Norman machte ein saures Gesicht, als ich mir das Öl mit einem Lappen von den Händen wischte.
„Hast Du eine Idee wie wir hier wieder weg kommen?“ fragte er mit genervtem Blick.
Ich überlegte und stellte mir vor, dass LKW, die von Europa hier im Einsatz waren, ähnlich wie unser Flugzeug einen zusätzlichen Ölkühler eingebaut haben müssten, um nicht zu heiß zu werden.
„Lass uns mal bei der alten Klapperkiste nachsehen“, schlug ich vor und wir gingen zur Hütte, wo die sich beiden Angolaner aufhielten. Norman konnte sich einigermaßen mit ihnen verständigen und ich kurz darauf den LKW untersuchen. Er hatte tatsächlich einen Ölkühler aber keiner der Schläuche war dick genug für uns.
Ich fragte, ob es irgendwo in der Nähe eine Werkstatt gäbe. Norman übersetzte und einer der beiden nickte heftig mit dem Kopf.
Ich schaute Norman fragend an. „Wollen wir es versuchen? Dann baue ich den kaputten Schlauch aus und wir nehmen ihn mit.“
Er zuckte die Schultern. „Was bleibt uns anderes übrig.“
Also nahm ich mir Werkzeug und eine leere Öldose aus dem Laderaum, stieg auf die Kiste und schraubte die Befestigungsschellen auf. Mit der Öldose fing ich das Öl auf, was sich noch in dem Kühler befand und zog den Schlauch schließlich ganz ab.
Ich schwitzte dabei so sehr, dass mir Schweißperlen in die Augen liefen und meine Klamotten klebten am ganzen Körper. Meine Hände waren schwarz wie die Nacht und so sehr ich sie auch abwischte, viel besser wurde es nicht. Immerhin hatte ich den Schlauch als Muster und die beiden Angolaner kletterten in den LKW. Norman und ich setzten uns auf einer Decke auf den Laderaum zwischen Führerhaus und den Benzinfässern.
Es war ein ungewöhnlicher Ausflug, bei dem wir kräftig durchgeschüttelt wurden. Die Fahrt ging in westliche Richtung und dauerte eine Stunde. Kurz vor dem Ort Lumeje bog der LKW rechts ab und erreichte einen Schrottplatz wie ich ihn noch nie gesehen hatte. Alle möglichen verrosteten Autowracks lagen kreuz und quer nebeneinander. An allen fehlte etwas und das war offensichtlich das angolanische Ersatzteillager dieser Region.
Norman und ich sahen uns etwas ratlos an, während die Angolaner zu einer Blechhütte gingen und einen Landsmann herausholten.
Laut redend und gestikulierend kamen sie auf uns zu. Ich zeigte den kaputten Schlauch und der Wächter des Schrottplatzes bedeutete uns, wir sollten uns umsehen und etwas Passendes suchen.
Ich wischte mir seufzend den Schweiß von der Stirn und holte mir Werkzeug. Bei den LKW-Wracks fing ich an. Die Fabrikate kannte ich nicht. Sie mussten wohl aus Portugal oder Spanien stammen. Es erforderte viel Kraft, die verrosteten Motorhauben zu öffnen und bei den ersten beiden war ausgerechnet der Ölkühler schon ausgebaut worden. Beim dritten und vierten waren die Schläuche zu klein. Ich wollte schon aufgeben aber da entdeckte ich das Wrack eines Busses, dem auf einer Seite die Räder fehlten und der deshalb halb lag und halb stand. Als ich die Motorabdeckung endlich abgeschraubt hatte, wurde ich fündig. Da war tatsächlich ein Schlauch mit einem gleichen Durchmesser. Zwar etwas länger als unserer aber besser als zu kurz. Natürlich waren die Schrauben der Schellen festgerostet. Da ich sie nicht los bekam, ließ ich Norman ran. Der schaffte es schließlich die Schrauben abzureißen.
Wie ich ihn doch manchmal um seine Kraft beneidete.
Jetzt hatten wir einen Schlauch und ich sah aus als käme ich aus einer Kohlengrube. Bevor wir mit unserer Beute den LKW bestiegen, mussten wir bei dem Schrottplatzwächter vorbei, der von Norman fünfzig Dollar verlangte.
„Der spinnt wohl“, schimpfte Norman und bot zehn Dollar.
Jetzt begann ein lautes Palaver von dem ich nichts verstand. Ich merkte nur, dass Norman ungeduldig wurde. Er drückte dem Mann zwanzig Dollar in die Hand und gab mir ein Zeichen aufzusteigen. Das hatte wohl funktioniert, denn plötzlich waren alle zufrieden.
Mir war so heiß und ich fühlte mich so schmutzig, dass ich gar nicht mitbekam, warum wir beim Abbiegen auf die Straße nach Cameia anhielten.
„Bleibe ganz ruhig und nimm die Hände hoch“, sagte Norman zu mir.
Als ich mich umdrehte, stand ein offener Geländewagen quer vor dem LKW und drei Soldaten richteten Gewehre auf uns. Ich bekam Herzklopfen und tat was die anderen taten. Wir mussten uns mit erhobenen Händen gegen den LKW stellen und wurden von einem Soldaten nach Waffen untersucht. Da wir keine hatten, entspannte sich die Lage ein wenig. Ich verstand kein Wort von dem, was aufgeregt gesprochen wurde. Ein anderer Soldat schaute nun in das Führerhaus und auf die Ladefläche. Norman sagte etwas, zog Papiere aus der Tasche seines Overalls und reichte sie einem von denen. Die Papiere wurden genau studiert und weitergereicht. Dann zeigte einer auf mich.
„Hast Du deinen Firmenausweis dabei?“ wollte Norman wissen.
„Ja in der gleichen Tasche wie Du.“
Ich zeigte ihm meine schmutzigen Hände und Norman zog den Zettel aus meinem Overall. Nachdem sie den auch herumgereicht hatten, gaben sie ihn zurück, salutierten und machten uns den Weg frei.
„Steig auf“, sagte Norman.
„Was war los?“ fragte ich, als wir wieder auf der Ladefläche saßen und mein Herz klopfte immer noch bis zum Hals.
„Sie haben geglaubt, wir gehören zu den Rebellen, die hier gegen die Regierung kämpfen“, erklärte Norman.
„Und warum haben sie Dir so schnell geglaubt?“
Norman grinste und zog das Schreiben aus seiner Tasche. „Das ist ein Schreiben der angolanischen Regierung an meinen Vater und das erlaubt, dass wir hier Geschäfte machen.“
Gegen vier Uhr nachmittags waren wir wieder an unserem Flieger. Ich machte mich gleich daran, den neuen alten Schlauch einzubauen. Um ihn nicht zu stark biegen zu müssen, kürzte ich ihn mit einem scharfen Messer um einige Zentimeter. Die Schlauchschellen hatte ich bald wieder fest und bevor ich die Verkleidung wieder anbaute, füllte ich Öl nach und machte einen Probelauf. Es sah so aus, als wäre alles in Ordnung. Ich schaute mir den Schlauch noch einmal an und wandte mich dann an Norman.
„Es scheint zu gehen aber verlange bitte nicht, dass ich damit in der Nacht nach Hause fliege.“
Er schaute mich fragend an. „Warum denn nicht?“
Ich deutete auf den Schlauch. „Das Ding ist wahrscheinlich älter als Du und ich zusammen und ich weiß nicht wie lange es schon auf dem Schrottplatz war und keine sonst üblichen Temperaturunterschiede und keinen Druck mehr erlebt hat. Ich hoffe, dass der Schlauch fünf Stunden hält aber wenn nicht, dann habe ich in der Dunkelheit keine Chance um eine heile Notlandung zu machen.“
Er machte ein nachdenkliches Gesicht und bevor er etwas sagen konnte, fügte ich hinzu: „Wenn wir bei Sonnenaufgang starten, schaffen wir auch noch den Flug nach Cabora. Das verspreche ich Dir.“
Er lächelte. „Das ist lieb von Dir. Also gut, vielleicht haben die hier noch ein Zimmer für uns.“
Ich war erleichtert nicht mit ihm streiten zu müssen und bevor ich mit dem Anbau der Motorverkleidung beginnen konnte, kamen zwei Fahrzeuge mit den Safarigästen an. Es waren vier Männer, die sofort neugierig zu unserem Flugzeug kamen. Es stellte sich heraus, dass es Australier waren, die unsere `Paula` bewunderten.
Wir kamen ins Gespräch und sie boten uns Bier an. Mir lief das Wasser im Mund zusammen aber ich sagte: „Danke. Ich würde sehr gern ein kühles Bier trinken aber ich muss noch einen Probeflug machen.“
Jetzt schaute mich Norman wieder fragend an.
„Ja, mir wäre lieber, wenn wir nach der Reparatur einen kurzen Flug machen könnten.“
Norman rollte vielsagend mit den Augen, was nicht gerade Begeisterung verriet. Die Australier fanden es toll, noch einen Start und eine Landung zu sehen zu bekommen. Sie versprachen uns ein Bier für später und einer lieh mir sogar eine kurze Sporthose und ein T-Shirt, damit ich aus meinen schmutzigen Sachen kam, in denen ich mich gar nicht mehr wohl fühlte.
Ich besorgte mir ein Stück Seife und eine Wurzelbürste, um mich am Brunnen einigermaßen wieder sauber zu kriegen. Danach stieg ich mit Norman ins Flugzeug. Ich zeigte ihm die Karte und deutete auf einen kleinen See, an dessen Ufer ein Landeplatz mit dem Namen FORTE DA CAMEIA SOUTHWEST eingetragen war. Ich schaute ihn ganz unschuldig an.
„Zehn Minuten hin, ein bisschen schwimmen und zehn Minuten zurück, okay?“
Norman lachte. „Du bist ganz schön gerissen, weißt Du das?“
„Warum?“ fragte ich ebenso unschuldig.
„Na ja, erst überrumpelst Du mich mit der Übernachtung, dem Testflug, dann schaffst Du es, dass Dir einer was zum anziehen leiht, dass Du heute Abend Bier kriegst und jetzt noch einen Badeausflug mit Flugzeug.“
„Du gönnst mir aber auch gar nichts. Ich habe immerhin beinhart gearbeitet und wäre beinahe wieder verhaftet worden, “ schmollte ich.
„Ist ja schon gut. Das hast Du wirklich, “ bestätigte er und strich mit der Hand über meinen Kopf.
Ich beeilte mich den Motor zu starten, die Maschine zu wenden und bald waren wir in der Luft. Die abgesteckte Landebahn am Seeufer fand ich sofort, obwohl dort nichts weiter zu sehen war. Kaum waren wir ausgestiegen, lief ich zum See, zog mich aus und stürzte ins Wasser. Ich hatte mich auf dem Schrottplatz so sehr nach kühlem Wasser gesehnt.
Norman kam so schnell gar nicht nach. Als er endlich im Wasser war, schwammen wir um die Wette, tobten ein bisschen herum und ließen uns eine Weile treiben. Nichts und Niemand störte uns.
Nach etwa einer Stunde gingen wir wieder an Land, ließen unsere nackten Körper an der Sonne trocknen und Norman gab mir einen Kuss. Wir waren zwar nicht im Camp aber wir brauchten es mal wieder. Mit einem Augenzwinkern drehte sich Norman um 180 Grad und begann meine Schenkel zu streicheln. Ich massierte seine mit meiner Zunge. Unsere Erregung steigerte sich. Gierig begannen wir und gegenseitig die erogenen Zonen zu verwöhnen, die Eier zu lecken und uns schließlich gegenseitig einen zu blasen.
Das tat nach dem anstrengenden Tag und dem Baden so gut und wir bekamen beide fast gleichzeitig die Geilsahne des anderen in den Mund gespritzt. Norman nannte es immer die Calziumspritze, die er so gerne von mir bekam.
Nach einer kurzen Erholungsphase rafften wir uns auf, zogen uns an und flogen zurück. Auf dem Weg zur Hütte fühlte ich mich wie neu geboren.
Wir bekamen ein kleines Zimmer mit Holzpritschen, die an den gegenüberliegenden Wänden befestigt waren. Ich schaute erst zu der einen, zur anderen und dann zu Norman.
„Ich werde Dich sehr vermissen diese Nacht.“
Norman umarmte mich fest und flüsterte in mein Ohr: „Ja mein kleiner Prinz, man kann nicht alles haben. Aber besser das hier als in einer angolanischen Gefängniszelle.“
„Erinnere mich bloß nicht daran.“ Allein bei dem Gedanken lief mir ein kalter Schauer über den Rücken.
Die Australier saßen mit den beiden Angolanern draußen und bereiteten ein Lagerfeuer vor. Auf dem Weg dorthin sah ich wie die alte rundliche Köchin meinen verdreckten Overall in einem Bottich wusch. Darüber freute ich mich so sehr, dass ich ohne zu zögern zu ihr lief, mich bedankte und ihr einen Kuss auf die Wange gab. Daraufhin strahlte sie über das ganze Gesicht und sagte etwas. Ich hatte sie vorher nie reden hören und geschweige denn lachen gesehen.
„Was hat sie gesagt“, fragte ich den grinsenden Norman.
„Sie hat gesagt, ein so hübscher Pilot muss doch einen sauberen Anzug haben.“
Ich fühlte mich geschmeichelt und nickte ihr noch einmal dankbar zu.
Norman klopfte mir auf die Schulter.
„Ich glaube sie mag Dich.“
„Vielleicht weil ich der Kleine bin, der immer die Drecksarbeit machen muss.“
Als Norman etwas irritiert schaute, sah ich ihm in die Augen und lachte. Jetzt wusste er, dass ich das nicht so ernst gemeint hatte.
Die Australier nahmen uns in ihrer Runde auf und erkundigten sich gleich, ob unser Flugzeug wieder okay sei. Als ich bejahte, bekam jeder eine Dose australisches Bier und sie prosteten uns zu.
Es war mein erstes Bier seit ich in Afrika war und ich genoss es richtig. Die Typen waren ganz lustig und wir unterhielten uns, während die Angolaner Antilopenfleisch über dem Feuer garten.
Noch vor dem Essen bekam ich die zweite Dose Bier. Norman mühte sich noch an der ersten.
Wir lachten viel und das Fleisch schmeckte köstlich und zart. Als ich mit der dritten Dose Bier anfing, schaute mich Norman an. Er schaute nicht böse aber bestimmend und ich wusste, dass es die letzte für diesen Abend sein musste.
Gegen zehn Uhr verabschiedeten wir uns von der lustigen Runde und zogen uns auf unsere Holzpritschen zurück. Ich spürte das Bier. Es machte mich müde aber es hatte mir so gut getan, mal wieder in lustiger Runde mit anderen Menschen zu reden.
Es war total ungewohnt am frühen Morgen in umgekehrter Richtung zu fliegen. Mein Blick wanderte immer wieder zu den Anzeigen für Öldruck und –temperatur aber es ging alles gut. In Kabunda nahmen wir uns eine gute Stunde für einen Brunch und dann ging es mit meiner `Anny` weiter nach Cabora-Bassa.
Ein anstrengender Tag war zu Ende gegangen, als wir nach einem verkürzten Training und dem Abendessen wieder in unserer Unterkunft ankamen und uns erschöpft auf Normans breitem Bett niederließen. Wir waren müde aber irgendwie zufrieden und wieder geil aufeinander.
Mehr als ein gegenseitiges Blasen schafften wir an diesem Abend jedoch nicht mehr.
Am Mittwoch brachte mir Norman ein Buch von Jason mit. Es handelte von der Kolonialisierung Afrikas und dem Abbau von Bodenschätzen. Das Buch war aus der Schulbibliothek entliehen. Jason hatte einen Zettel mit einem Gruß hineingelegt, worüber ich mich sehr freute.
Nun kam der Donnerstag mit dem Sonderauftrag für die Farm. Wir starteten um sieben Uhr.
Da die Farm in meiner Karte nicht eingezeichnet war, musste ich mich an den Weg halten, den ich von unserer Autofahrt kannte. Er führte in südliche Richtung und es dauerte nur zwanzig Minuten bis ich die Farm gefunden hatte. Die Weide neben den Stallungen war frei und so setzte ich nach einer kleinen Runde zur Landung an. Herr van de Waal und seine Frau waren schon in der Nähe und machten einige Fotos von unserem Flugzeug vor ihrem Stall, bevor sie uns zu einem Frühstück mit Lagebesprechung zu ihrem Haus brachten.
Dort zeigte mir Herr van de Waal einen Lageplan, in dem er die Weiden gekennzeichnet hatte, auf denen wir nach dem Vieh schauen sollten.
Um halb neun ging es los. Norman nahm den ungewohnten Sitz hinten im Laderaum ein und Herr van de Waal saß rechts neben mir.
Gleich nach dem Start brach mein Auftraggeber in helle Begeisterung aus und zeigte mir die Richtung, in die ich fliegen sollte. Ich folgte geduldig seinen Anweisungen, wählte eine Höhe von etwa 150 Metern über Grund und flog mit stark reduzierter Geschwindigkeit eine Weidefläche nach der anderen ab.
Es waren nur fünf Weiden, auf denen jeweils 60 bis 100 Tiere grasten. Auf jeder Weide stand eine kleine Holzhütte, die den zwei bis drei Viehhütern und ihren Pferden Schutz bot. Herr van de Waal erklärte mir zwischendurch, dass immer bewaffnete Hüter beim Vieh seien, um Verluste durch Raubtiere möglichst gering zu halten und die Tiere zu tränken. Dazu hatte er auf einigen Weiden einen Brunnen gebohrt. Die übrigen hatten eine Zisterne und wurden nur so lange genutzt, bis das gespeicherte Regenwasser aufgebraucht war.
Besonderes Augenmerk richtete er auf eine Weide, die ziemlich nahe am Farmgebäude lag. Hier waren Kühe untergebracht, die regelmäßig gemolken werden mussten. Einige Kühe waren trächtig oder hatten vor kurzer Zeit gekalbt. Die eigene Zucht war sein ganzer Stolz und machte ihn vom Kauf neuer Kälber unabhängig.
Nach ungefähr zwei Stunden hatte er alles gesehen und sich entsprechende Notizen gemacht. Nach meiner Landung schaute er auf seine Armbanduhr und konnte es gar nicht fassen. „Zwischen Frühstück und Mittagessen das ganze Vieh gezählt. Dazu brauche ich mit dem Pferd eine ganze Woche, “ rief er begeistert und klopfte mir auf die Schulter.
Wir blieben noch bis zum Nachmittagskaffee und nutzten die Zeit zu einem ausgiebigen Bad im Swimmingpool.
Bevor wir zum Heimflug starteten, gaben uns die van de Waals zehn am Vortag geschlachtete Hühner und Hähnchen mit, worüber ich mich freute, denn Geflügel gab es im Camp nur sehr selten zu essen.
Bevor wir zum Training gingen, lieferten wir unseren Lohn bei Kitty in der Kantine ab und konnten sie überreden, uns zwei Hähnchen für das Abendessen zu braten. Wir waren an diesem Abend ziemlich ausgelassen und balgten lachend und spielend wie Kinder auf der Wiese hinter unserer Unterkunft herum, bis das Verlangen nach körperlicher Nähe die Oberhand gewann. Es wurde einer der Abende, wo wir nicht genug von einander kriegen konnten, jedes Zeitgefühl vergaßen und mindestens drei Mal unsere Boysahne hergaben.
Entsprechend müde war ich am nächsten Morgen auf unserem Flug nach Cameia. Ich bereute es aber nicht. Ganz im Gegenteil. Ich liebte Norman mehr denn je und verdrängte den Gedanken, dass es nur noch fünf Wochen waren, bis ich nach Deutschland zurückkehren und ihn verlieren würde.
In den beiden folgenden Wochen empfand ich die Temperaturen heißer als sonst. Die Trockenperiode hielt schon lange an und die Steppe war von der Sonne ausgedörrt. Selbst das Baden am Luapula machte keinen Spaß mehr, da der Fluss kaum noch Wasser führte und die tieferen Stellen zunehmend brackig wurden. Auf unseren Flügen konnte ich beobachten, dass die Tiere Mühe hatten Wasser zu finden. Sie sammelten sich überall dort, wo es noch Wasserlöcher gab und verhielten sich ziemlich nervös.
Auch Sam fand, dass es Zeit für die in dieser Jahreszeit übliche Regenperiode wäre, da sonst auch unser Wasservorrat im Camp knapp werden würde.
Als es dann tatsächlich dazu kam, dass der Wasserverbrauch in Kabunda rationiert wurde, kam ich auf die Idee, Wasser aus Angola und Mozambique zu importieren, damit wir uns abends wenigstens notdürftig duschen konnten. Wir sammelten alle verfügbaren Kanister und Behälter, füllten sie jeweils in Cameia und Cabora Bassa und hatten auf dem Rückweg jedes Mal zweihundertfünfzig Liter Wasser an Bord, um die eigenen Vorräte zu schonen.
Das heiße und trockene Wetter hielt noch bis zum 23. November an. Es war ein Freitag und bereits am Vormittag entwickelten sich große Quellwolken, unter denen wir kräftig durchgeschüttelt wurden. Über Angola war es besser und der Himmel blau. Ich ahnte, dass es auf dem Rückweg Gewitter geben würde und drängte Norman in Cameia deshalb nur eine kurze Pause zu machen.
Auf dem Rückweg konnte man schon die drückende Hitze spüren und bei Mwinilungwa standen bereits die ersten Gewitterwolken, die bei östlichem Kurs immer dichter wurden. Noch kam ich gut voran aber kurze Zeit später hatte ich aktive Gewitter mit Blitzschlag und starkem Niederschlag voraus. Es blieb mir keine andere Wahl, als die Gewitter zu umfliegen und das kostete nicht nur Zeit, sondern auch Konzentration.
Meine Hoffnung, dass es sich um eine lokale Gewitterfront handelte, bewahrheitete sich zunächst nicht, denn die Situation zog sich bis östlich von Lubumbashi hin. Erst hier entspannte sich die Lage und die Gewitterzellen wurden weniger. Wir hatten nun schon fast eineinhalb Stunden mehr Flugzeit als normal und Norman machten die starken Turbulenzen ziemlich zu schaffen.
Okay, ich muss eingestehen, dass es mir als Pilot etwas besser ging, denn ich hatte Steuerknüppel und Ruder mit denen ich die Auswirkungen auszugleichen versuchte.
Ich rechnete, ob ich mit dem Sprit noch bis Kabunda kam und entschied mich wegen der jetzt besseren Lage nicht in Lubumbashi zum Tanken zu landen, weil ich hoffte auf diese Weise noch kurz vor Einbruch der Dunkelheit mit wenig Sprit ankommen zu können. Das war mir lieber, denn ein Flug bei Nacht war bei aktiven Gewittern zu gefährlich, weil ich bei eventuellen Kursänderungen kaum eine Chance gehabt hätte, die nur mit zehn Petroleumlampen gekennzeichnete Landebahn in Kabunda zu finden. Leider versagt auch der Radiokompass bei Gewittern und zeigt ungenaue oder falsche Werte an.
Es ging auf dem letzten Abschnitt glücklicherweise recht gut, weil die einzelnen Gewitter nun abseits meines Kurses standen. Nur ein Gewitter konnte ich bereits zwanzig Minuten vor der errechneten Ankunft in der Gegend von Kabunda sehen.
Als wir uns näherten beruhigte mich die Tatsache, dass das Gewitter offensichtlich in nördliche Richtung zog und mir den Anflug freimachte. Erleichtert kündigte ich die Landung per Funk in Kabunda an und leitete über dem Luapula die Kurve zum Endanflug ein.
Als ich wie gewohnt einen Blick auf die Stelle warf, wo wir so gerne badeten wenn genug Wasser im Fluss war, wurde ich stutzig. Irgendetwas war anders als sonst. Ich informierte Norman, dass ich noch einmal drehen wollte und bat ihn rauszuschauen.
Ich versuchte den Grund zu finden, der mich dazu veranlasst hatte und war fast soweit den Anflug fortzusetzen, als es mir plötzlich wieder auffiel. Es war ein undefinierbarer roter oder besser orangeroter Fleck im Uferbereich, den ich Norman zeigte.
Er raffte sich auf. „Kannst Du tiefer fliegen?“
Ich nahm das Gas zurück und holte ein wenig aus. Als ich an der Stelle knapp über den Bäumen vorbei flog, wurde Norman munter.
„Das war wohl ein Blitzschlag. Es brennt im Unterholz, “ stellte er fest und gab mir ein Zeichen noch einmal darüber zu fliegen, während er das Mikrofon griff und die Taste drückte.
„Hallo Sam, hörst Du mich?“
Es dauerte einen Moment bis Sams Stimme im Bordlautsprecher zu hören war und im Vorbeiflug der Stelle sagte Norman: „Wir haben Feuer am Luapula entdeckt. Der Rauch zieht in Richtung des Camps. Fahre schnell rüber zur Mine und löse Alarm aus. Wir sind gleich da und dann will ich mit Bill sprechen!“
Von Sam kam nur ein knappes „Okay“ und dann wies mich Norman an sofort zu landen.
Ich spürte, dass es für das Camp zu einer bedrohlichen Lage kommen konnte und Norman dies erkannt hatte. Deshalb hielt ich es für ratsam, ihn in seinen Überlegungen nicht zu stören.
Als wir nach der Landung vor dem Hangar ausgestiegen waren, kam Sam bereits mit dem Geländewagen zurück und ein weiterer Wagen folgte.
„Das wird eine harte Nacht“, bemerkte Norman und ging dann auf einen etwa vierzigjährigen stämmigen Mann zu, der fast gleichzeitig mit Sam aus dem Wagen stieg.
Ich sah nur, wie sie hastig miteinander redeten. Nach einer Weile stieg Bill, wie ich inzwischen von Sam erfahren hatte, wieder in seinen Wagen und brauste eilig davon. Norman kam hastig auf uns zu und wandte sich an Sam.
„Sorge bitte dafür, dass die `Paula` startklar ist und Micha etwas zu essen und einen starken Kaffee bekommt.“
Dann wandte sich Norman an mich.
„Ich habe gerade mit Bill die Lage besprochen. Es ist unser Glück, dass Du das Feuer so früh entdeckt hast und vielleicht hilft uns der Regen, dass es sich nicht so schnell ausbreitet.“
„Was kann man tun?“ fragte ich, denn löschen war ja hier unmöglich.
Norman fasste meine Schultern. „Hör mir gut zu. Wir haben nur eine Chance. Wir schlagen mit unseren Kettensägen und drei Bulldozern von der Mine eine Schneise entlang der äußeren Umzäunung. Das ist bei der Dunkelheit nicht ganz einfach und wird Zeit kosten. Damit wir die Schneise an der richtigen Stelle zuerst fertig bekommen, musst Du uns aus der Luft die nötigen Informationen geben. Du beobachtest das Feuer und wie es sich ausbreitet. Ich habe ein Funkgerät mit dem ich Dich erreichen kann und dirigiere die Männer mit den Sägen und die Bulldozer am Boden an die Stellen, die Du mir aus der Luft angibst – okay?“
Ich versuchte mir vorzustellen was er meinte. Klar, ich würde sehen wohin sich das Feuer bewegen würde und wie weit es noch vom Camp entfernt ist.
„Aber wie soll ich dir beschreiben wo die Bulldozer hin müssen?“
Norman holte tief Luft. „Die Bulldozer haben zum Glück starke Scheinwerfer. Du müsstest sie sehen können wenn sie unterhalb des Haupttores anfangen eine Schneise entlang des Zaunes zu schieben. Du musst nur beobachten, dass sie so weit kommen wie nötig um die Richtung des Feuers zu stoppen. Wenn sie die Position erreicht haben von der Du glaubst, dass dort das Feuer zuerst ankommt, dann sagst Du mir Bescheid. Da machen wir die Schneise breit genug und wenn sich die Richtung des Feuers ändert, dann dirigierst Du uns weiter nach vorn oder hinten. Hast Du verstanden?“
„Ja Sir“, bestätigte ich mit einem fröstelnden Gefühl.
Inzwischen hörten wir schon die mächtigen Bulldozer auf dem Weg in Richtung Haupttor fahren. Norman klopfte mir auf die Schulter.
„Du kannst Dir ruhig noch etwas Zeit lassen bis Du startest aber vorher isst Du was und nimm Dir Kaffee mit, damit Du mir da oben nicht einschläfst – verstanden?“
„Aye aye Sir.“
Norman stupste meine Nase und lächelte. Er wusste, dass er sich auf mich verlassen konnte.
„Ich muss los. Pass gut auf dich auf.“
„Du auch, “ rief ich ihm nach und begann die `Paula` startklar zu machen.
Kurze Zeit später kam Sam aus der Kantine zurück. Wir aßen gemeinsam in seinem kleinen Magazin. Er spürte wie nervös ich war.
„Solange Du oben bist, sind die Lampen an der Bahn an und ich bin hier am Funk. Wenn Du Orientierungshilfe brauchst, kann ich Leuchtkugeln schießen und wenn Du zu müde wirst kommst Du runter – kapiert?“
Ich nickte und nahm noch einen Schluck Kaffee, bevor ich die Thermokanne zuschraubte, um sie mitzunehmen.
Ich schaute zur Uhr. Es war 19 Uhr und ich hatte für sieben Stunden Sprit an Bord.
„Tankst Du mir vorsichtshalber die `Anny` noch auf?“ bat ich Sam als ich aufstand.
„Mach dir darüber keine Sorgen.“
Ich drehte mich noch einmal um.
„Norman hat auch noch nichts gegessen. Kannst Du irgendwie dafür sorgen, dass ihm jemand was bringt?“
Sam schmunzelte. „Bei Euch passt wohl einer auf den anderen auf aber da kennst Du den alten Sam nicht. Der hat das in der Kantine schon geregelt.“
„Danke!“ rief ich ging zum Flugzeug.
Als ich mich angeschnallt und die Tür verriegelt hatte, schaute ich in den dunklen Himmel, schüttelte mich und holte tief Luft, bevor ich den Motor startete.
Langsam steuerte ich die Maschine auf die Landebahn. Das Licht meines Landescheinwerfers schwankte vor mir auf dem dürren Gras bis ich das trübe Licht der jeweils fünf Petroleumlampen links und rechts der Piste in Reihe vor mit hatte.
Während der Motor warm lief schaltete ich die rote Instrumentenbeleuchtung ein und dimmte sie auf die richtige Stärke. Ein Blick auf den rechten Sitz ließ mir bewusst werden, dass dies mein erster Flug in Afrika war, bei dem niemand neben mir saß.
„Ich schaffe das“, sagte ich mir, während ich den Kopfhörer aufsetzte und dann schob ich den Gashebel nach vorn.
Nach den ersten beiden Petroleumlampen war ich in der Luft und als ich das Ende der Piste überflogen hatte, drehte ich nach rechts in nördliche Richtung. Der Himmel war klar. Leider war der Mond nur eine kleine Sichel und gemeinsam mit den wenigen sichtbaren Sternen vermochte er mir nur ganz wenig Streulicht zu geben, mit dem ich Konturen am Boden erkennen konnte.
Zum Glück hob sich der Luapula leicht schimmernd von der Umgebung ab. Damit hatte ich eine wichtige Bezugslinie am Boden.
Mein erster Blick galt dem Feuer. Die brennende Fläche war schon größer geworden und die helleren Stellen am Rand hatten die Form einer Ellipse.
Ich drückte die Mikrofontaste.
„Hey Norman. Ich bin jetzt in der Luft. Kannst Du mich hören?“
„Hey Micha, ich kann dich gut hören. Wir haben unterhalb des Haupttores angefangen. Kannst Du die Bulldozer sehen?“ Seine Stimme war umgeben vom Dröhnen der mächtigen Maschinen.
Ich musste mir erst ein Gefühl für die Richtungen und Entfernungen erfliegen aber dann erkannte ich deren Scheinwerfer am Boden. Sie waren allerdings nur zu sehen, wenn ich im richtigen Winkel vorbeiflog, ansonsten verdeckte der Wald meine Sicht in diese Richtung.
„Ja, jetzt sehe ich die Scheinwerfer.“
„Was meinst Du? In welcher Richtung wird uns das Feuer zuerst erreichen?“
Diese Entscheidung war in diesem Moment nicht schwer.
„Ihr müsst weiter in Richtung Mitte des Camps“, sagte ich sofort.
„Okay, es geht los. Wie weit ist das Feuer noch weg und wie schnell bewegt es sich?“
Ich befand mich nun über dem Fluss und konnte auf den Hang schauen.
„Ich schätze eineinhalb Meilen und es kommt im Moment nur langsam voran. Wenn Du mir etwas Zeit Lässt, rechne ich aus wie lange es dauert bis es oben ist.“
„Ja gut ich warte.“
Ich hatte die Maschine gut ausgetrimmt und ließ sie in großem Bogen kreisen. Mit der Stoppuhr und dem Kompass versuchte ich festzustellen wie der Wind war. Ich kam auf Nordost mit maximal fünf Knoten.
„Hey Norman. Wenn der Wind nicht stärker wird, schätze ich acht Stunden bis das Feuer oben ist.“
„Das wäre gut aber darauf sollten wir uns nicht verlassen“, meinte er.
Ich beobachtete wieder die Scheinwerfer der Bulldozer und stellte fest, dass sie nur sehr langsam vorankamen. Als sich Norman das nächste Mal meldete, hörte ich im Hintergrund das Kreischen von Motorsägen und dann wurde mir klar warum. Die Männer mussten erst die hohen Bäume fällen, bevor die Bulldozer sie mitsamt dem Unterholz zur Seite schieben konnten. Dabei wurde mir auch klar, wie gefährlich es sein musste, hohe Bäume in der Dunkelheit zu fällen. Man konnte ja nicht genau sehen in welche Richtung sie fielen und geübte Holzfäller konnten die Männer nicht sein.
Ich hatte plötzlich Angst um Norman und war jedes Mal froh, wenn ich ihn im Funk hörte.
Inzwischen war eine Stunde vergangen und das Feuer breitete sich noch immer mit gleich bleibender Geschwindigkeit aus. Um das etwas genauer zu überprüfen, flog ich sehr tief und langsam das Gebiet ab. Plötzlich sah ich unter mir so etwas wie eine riesige Stichflamme, deren heller Schein an der Unterseite der Tragflächen reflektiert wurde. Im ersten Moment dachte ich, das Flugzeug sei in Flammen aufgegangen. Ohne nachzudenken schob ich den Gashebel nach vorne und zog nach oben. Dabei wurde es wieder dunkel und es dauerte eine Zeit, bis sich meine Augen erneut an die Dunkelheit gewöhnt hatten. Als ich umdrehte, konnte ich sehen was passiert war. Gerade hatte sich das Feuer wieder an einem hohen Baum empor gefressen und die Krone explosionsartig in Brand gesetzt. Mein Pulsschlag ging langsam wieder zurück nach diesem Schreck aber jetzt passte ich besser auf meine Höhe auf.
Ich versuchte mir den Hang bei Tageslicht vorzustellen und kam zu dem Ergebnis, dass jetzt eine Stelle mit höheren Bäumen erreicht war. In einem Film hatte ich einmal gesehen, dass sich ein Feuer auch von Krone zu Krone ausbreiten konnte, ohne dass es am Boden brennen musste.
Ich berichtete Norman was ich sah.
Er ließ sich genau beschreiben in welcher Richtung sich dieses abspielte und es war nach wie vor etwa die Mitte des Camps. Soweit waren die Bulldozer aber noch lange nicht und ich glaubte kaum, dass die Aktion noch zu schaffen war.
Norman erkannte das an meiner Stimme und bemühte sich cool zu bleiben.
„Das ist nur ein Stück. Danach kommt wieder kleiner Bewuchs. Wir dürfen nicht aufgeben, “ beschwor er mich.
Es sah beängstigend aus, wie eine Baumkrone nach der anderen förmlich explodierte. Der Abstand zum Camp betrug an der ungünstigsten Stelle nur noch etwas mehr als eine halbe Meile und die Bulldozer hatten noch mindestens eine viertel Meile, also etwa 500 Meter bis zu dieser Stelle vor sich.
Ich flog jetzt in Form einer Acht, um mit Kurvenwechsel gegen die Eintönigkeit meines Fliegens anzukämpfen. Ich beobachtete das Feuer sehr genau und konnte zu meiner Freude vermelden, dass sich das Ausbreiten über die Kronen nun nicht mehr nach vorne, sondern nur noch in der Breite fortsetzte.
„Siehst Du, das ist die Stelle, wo der hohe Bewuchs aufhört“, stellte Norman gleichsam erleichtert fest.
Es war merkwürdig anzusehen. Bis zu dieser unsichtbaren Grenze war ein hohes Feuer vorausgeeilt und jetzt hielt es an, bis das tiefe Feuer langsam nachzog.
Mit dieser Erleichterung spürte ich die Müdigkeit in meinen Knochen. Ich saß nun sechzehn Stunden mit kurzen Unterbrechungen hinter dem Steuerknüppel. dass mir der Rücken und der Hintern wehtat, spürte ich kaum noch. Ich ging in etwas größere Höhe und klemmte den Knüppel bei gleichmäßigen Kreisen zwischen die Knie. Jetzt hatte ich die Hände frei und griff nach der Kaffeeflasche.
Der heiße Kaffee tat gut und half mir ein wenig über die Zeit. Dann löste ich die Gurte ein wenig und streckte meine schmerzenden Schultern und den Nacken.
Um mir ein wenig kühle Luft um die Nase wehen zu lassen, öffnete ich das kleine Schiebefenster an der Seite, welches gerade groß genug war, um meine Hand ein wenig hinaus zu strecken.
Ich sehnte mich nach meinem Bett aber ein Blick nach unten genügte, um den Gedanken wieder zu verdrängen. Das tiefe Feuer hatte die vorherige Linie noch nicht erreicht. Die Bulldozer waren inzwischen ungefähr einhundert Meter vorangekommen. Jetzt hatten sie etwa sie Hälfte der Strecke, die sie mindestens brauchen würden, um das Feuer vom Camp abzuhalten.
„Hey Norman, wie geht es dir?“
„Das gleiche sollte ich dich fragen. Gibt es etwas Neues?“
„Ihr habt jetzt die Hälfte“, sagte ich.
„Na prima. Das ist doch was – oder?“
„Ja. Ihr macht das bestimmt ganz gut aber es ist sehr einsam ohne Dich hier im Flugzeug.“
„Oh Mann und ich dachte Du genießt es mal ohne den Typen neben Dir zu fliegen.“
Ich musste schmunzeln. Er war sicher genauso müde und kaputt wie ich aber er schaffte es trotzdem, mich aufzumuntern.
Ich schaute wieder herunter. Am Fluss war inzwischen alles dunkel und an den Rändern im Osten und Westen schien sich das Feuer langsam totzulaufen. Es war aber eine riesige Fläche in der es noch glimmte und glühte. Wie mochte es wohl am nächsten Tag aussehen? Ein riesiger Hang verbrannter Erde. Welche Tiere werden sich wohl vor dem Feuer gerettet haben und welche hatten es nicht geschafft, sich in Sicherheit zu bringen?
Diese Fragen gingen mir durch den Kopf und lenkten mich ein wenig von meinem Kampf gegen die Müdigkeit ab. Dann sah ich auf einmal meinen Freund und Piloten Patrick vor mir. Ich dachte wie schön. Er wird mich gleich ablösen, doch dann schrie er: „Pass auf!“
Es war ein Traum und er riss mich aus einem Sekundenschlaf in die Wirklichkeit zurück.
Etwas mehr als vier Stunden hing ich nun schon hier oben. Ich fror aber das Außenthermometer zeigte noch deutlich über zwanzig Grad. Es war die Müdigkeit und es kostete so viel Kraft dagegen anzukämpfen, dass ich am liebsten geheult hätte.
Ich riss mich zusammen und begann meinen Spritverbrauch auszurechnen. Es war eine halbe Stunde vor Mitternacht. Weil ich die meiste Zeit mit gedrosselter Leistung geflogen war, blieb mir mehr Flugzeit als unter normalen Umständen. Ich kam zu dem Ergebnis, dass der Sprit bis drei Uhr ausreichen würde und sagte es Sam, damit er sich deshalb keine Sorgen machen musste.
Unterdessen fraß sich das Feuer unten langsam weiter und hatte fast die Linie erreicht, wo vorher schon die Baumkronen verbrannt waren.
Ich gab Norman einen neuen Bericht. Danach begann ich laut zu singen. Es waren deutsche Fahrtenlieder aus der ‚Mundorgel‘, die ich noch von Jugendfreizeiten in Erinnerung hatte, als ich zwölf oder dreizehn Jahre alt war. Die Texte stammten zum Teil aus der Seefahrt und beschworen den Teamgeist. Eigentlich sang man solche Lieder nur in Gruppen und wenn man noch ganz jung oder gut angeheitert war. Das war mir jetzt aber egal und es war niemand da, der unter meinem Gesang hätte leiden müssen.
Nachdem ich mein Repertoire dreimal runter geschmettert hatte, wurde ich heiser und genehmigte mir einen Becher Kaffee. Ich hatte das Gefühl, dass es mir jetzt etwas besser ging.
Es gab ein Knacken im Funk. Dann hörte ich Norman.
„Hey Micha, kannst Du noch?
„Ja, geht schon“, versuchte ich ihn zu beruhigen.
„Ich sehe dich da oben. Wie weit sind wir?“
Ich flog auf der Feuerseite an der Brandschneise vorbei und achtete auf die Scheinwerfer.
„Ihr habt jetzt ungefähr zwei Drittel“, stellte ich fest.
„Und wie weit ist das Feuer entfernt?“
„Halbe Meile. Ausbreitung gleich bleibend, “ gab ich durch.
Es blieb eine Weile still. Dann meldete sich Norman wieder.
„Dann bleibt ungefähr eine Stunde bis es die nächsten hohen Bäume erwischt, die bis an die Schneise heranreichen und bis dahin müssen wir weit genug gekommen sein.“
„Ja das kommt ungefähr hin“, bestätigte ich.
Beim nächsten Vorbeiflug teilte ich die derzeitige Brandschneise in fünf Stundenabschnitte ein und dachte mir einen solchen Abschnitt dazu. Das könnte knapp werden aber ich hoffte, dass etwas mehr Zeit blieb.
Die nächsten beiden Stunden würden entscheiden, dessen war ich sicher. Schade, dass ich kein Löschflugzeug unter mir hatte. Ich stellte mir vor, dass ich auf dem nächsten See Wasser aufnehmen und es in riesigen Wolken auf das Feuer werfen würde. Das wäre super. Dann hätte ich eine richtige Aufgabe, statt immer nur zu kreisen und auf dieses dämliche Feuer zu schauen.
Bis ein Uhr gab es keine besondere Entwicklung. Immer wieder sah ich unten helle Flammen wenn ein Busch in Brand geriet. Norman meldete sich regelmäßig und ich spürte seine Sorge, dass ich wach blieb.
Ich begann wieder zu frieren und konnte dagegen nicht mehr tun, als mir die Arme zu reiben.
Gegen halb zwei beobachtete ich wieder eine hohe Stichflamme. Jetzt war es also soweit. Ich gab es sofort an Norman durch.
„Okay Micha. Sag mir immer wieder wie weit es noch von uns weg ist. Wir haben noch ein kurzes Stück bis zu den alten Abraumhalden. Wenn wir es bis dahin schaffen, kann das Feuer nicht mehr durch.“
Bis die nächste Stichflamme emporkam, verging ein wenig Zeit. Ich schätzte die Entfernung auf etwa vierhundert Meter bis zur Schneise.
Ich rechnete schnell noch einmal meinen Spritvorrat und es blieb beim Limit von drei Uhr.
Inzwischen explodierten immer mehr Baumkronen auf breiter Front. Es war ein beängstigendes Gefühl zu sehen, wie sich das Feuer nun sehr schnell in Richtung Camp ausbreitete.
Die Geschwindigkeit betrug etwa einhundert Meter in zwanzig Minuten. Norman beruhigte mich. „Wir sind nur noch fünfzig Meter vor dem Ende“, gab er mir durch. Ich hoffte, dass es reichte und jedes Mal wenn eine weitere Baumreihe in Brand geriet, lief mir ein Schauer über den Rücken.
Um zwei Uhr schätzte ich die Entfernung auf nur noch zweihundert Meter.
„Ich kann es schon riechen“, sagte Norman.
Ich gab ihm jetzt ständig die Entfernung durch. Als die Einhundertmetermarke erreicht war, kam die triumphierende Nachricht, dass sie mit der Brandschneise die Abraumhalden erreicht hatten.
„Wir verteilen jetzt die Männer auf die Strecke damit wir sicher sein können, dass nichts auf die andere Seite fliegt.“
„Pass auf Norman und viel Glück“, rief ich und schaute gebannt wie die letzten Baumreihen langsam ein Raub der Flammen wurden.
„Jetzt kann ich das Feuer sehen“, berichtete mir Norman. Seine Stimme klang ruhig. Offensichtlich war er sich sicher, dass die Schneise breit genug war.
Ein kurzer Blick auf die Uhr zeigte mir, dass es kurz vor halb drei war.
In der Mitte der Brandschneise schätzte ich noch zwei oder drei Baumreihen. Die gingen innerhalb von fünf Minuten hoch. Jetzt starrte ich gebannt auf diese Stelle und tatsächlich hörte das Inferno dort auf. Das Feuer kam zum Stehen, wo es die Brandschneise erreicht hatte. Nur noch links und rechts flammten die Baumkronen auf.
„Es funktioniert“, rief ich ins Mikrofon.
„Was siehst Du genau? Ich bin ganz am Ende der Schneise, “ fragte Norman.
„In der Mitte hat es schon aufgehört. Am Anfang und am Ende sind noch nicht alle Bäume weg aber es kann nicht mehr lange dauern.“
Es war eine große Erleichterung zu sehen, dass das Feuer immer mehr zur Ruhe kam. Dort wo sich Norman aufhielt, erreichten die letzten aufflammenden Baumkronen die Schneise und die Abraumhalde.
„Wir haben es geschafft!“ rief Norman und mir liefen aus Erleichterung ein paar Tränen über das Gesicht.
Es war viertel vor drei. Ich drehte noch eine letzte Runde und überzeugte mich davon, dass das Feuer an keiner Stelle übergesprungen war. Dann rief ich Norman. „Ich muss jetzt landen. Ich habe keinen Sprit mehr.“
„Ja okay und denke daran, wir zwei sind die Größten.“
Ich zog meine Gurte stramm und konzentrierte mich mit letzter Kraft auf die Landung. Da ich die ganze Zeit auf das Feuer geschaut hatte, sah ich die winzigen Petroleumlampen an der Landebahn erst sehr spät. Meine Landung war miserabel aber die ´Paula` nahm mir das nicht übel.
Ich rollte die Maschine vor den Hangar und schaltete das Triebwerk aus. Bei der plötzlichen Ruhe fielen mir die Augen zu.
Als ich aufwachte, schien mir die Sonne ins Gesicht. Ich kniff die Augen zu und spürte ein dumpfes Gefühl im Kopf. Mein Rücken schmerzte und langsam begann ich zu begreifen was geschehen war.
Neben mir lag Norman und schlief ganz fest. In seinem Gesicht waren noch Spuren von Asche oder Staub. Ich wäre am liebsten unter seine Decke gekrochen aber ich wollte ihn nicht wecken. Wie ich ins Bett gekommen war, wusste ich nicht. Ich schlich mich ganz leise ans Fenster und zog die Gardine zu. Dann krabbelte ich wieder ins Bett und versuchte noch etwas zu schlafen. Mir gelang aber nur noch ein Dämmerschlaf und als ich die Augen öffnete, schaute mich Norman an und lächelte.
„Na, mein kleiner Held?“
„Ich bin kein Held und klein bin schon überhaupt nicht, “ protestierte ich.
Norman strich mir über die Stirn und lachte.
„Wie ich höre, geht es Dir schon wieder gut.“
„Mir tun alle Knochen weh“, gab ich zu.
„Ja ich weiß. Über neunzehn Stunden im Flugzeug sitzen ist ganz schön hart.“ Er hob dabei die Bettdecke und ich rutschte zu ihm herüber.
„Hast Du mich ins Bett gebracht?“
„Nein das war Sam. Er hat Dich aus dem Flugzeug geholt weil Du auf dem Instrumentenbrett eingeschlafen warst.“
„Und er hat mich ausgezogen und in DEIN Bett gelegt?“ fragte ich ungläubig.
Norman grinste und gab mir einen Kuss.
„Er hat Dich in DEIN Bett gelegt aber als ich später kam, habe ich Dich geholt, weil ich Dich nicht alleine lassen wollte.“
Obwohl ich mir etwas blöd vorkam, nachts wie ein Baby herumgetragen zu werden, war das sehr lieb von ihm und typisch Norman.
Um vier Uhr nachmittags standen wir auf, duschten ausgiebig und gingen in die Kantine um zu `frühstücken`.
„Hätten wir nicht heute nach Cabora Bassa fliegen müssen?“ fragte ich ziemlich keck.
Norman nickte. „Das habe ich Steve aufs Auge gedrückt.“
„Sollen wir gleich mal starten und uns ansehen wie der Hang jetzt aussieht?“
Norman schüttelte den Kopf und senkte die Augenbrauen.
„Micha Du bist unmöglich. Das hat bis zu unserem nächsten Flug am Montag Zeit. Heute und morgen kommst Du nicht mal in die Nähe eines Flugzeugs. Du kriegst gleich Deinen Rücken massiert und dann trainieren wir uns wieder fit, okay?“
Jetzt verzog ich das Gesicht und sagte um Streit zu vermeiden mit einem leichten Seufzen: „Aye, aye Sir.“ Die Massage tat mir aber trotzdem gut.
Der Himmel war bedeckt und die Luftfeuchtigkeit sehr hoch. Ich fühlte mich nach der Strapaze ziemlich matt und ich wusste, dass es Norman mit dem Training nur gut meinte. Meinen Gedanken lieber Schwimmen zu gehen, verwarf ich gleich wieder als mir einfiel, dass unsere idyllische Badestelle nun der Ausgangspunkt eines verkohlten Hanges war, dessen Anblick ich sicher nur schwer ertragen konnte.
Deshalb trottete ich lustlos mit zum Kraftraum und machte meine Übungen, bis mir der Schweiß aus allen Poren lief. Erst nach dem gemeinsamen Duschen fühlte ich mich etwas besser.
Norman war sehr lieb und wir verbrachten den Abend und den Sonntag mit Faulenzen und sehr viel Schmuseeinheiten.
Die Gewitterfront, die am Freitag den Waldbrand ausgelöst hatte, läutete eine Schlechtwetterperiode ein, die offensichtlich für diese Jahreszeit typisch war. Schwülwarme Luft sorgte für labile Bewölkung mit Schauern und lokalen Gewittern. Das Fliegen wurde unter diesen Umständen zu einer Qual. Nicht die Turbulenzen, das schwierige Navigieren oder die damit verbundenen Verspätungen und Nachtlandungen waren so unerträglich sondern die Hitze und die hohe Luftfeuchtigkeit. Ich konnte unterwegs kaum so viel trinken wie ich schwitzte und wenn ich abends total erschöpft ins Bett gefallen war, konnte ich kaum schlafen.
Am Mittwoch, meinem nächsten freien Tag verkroch ich mich in den Wald, wo er am dunkelsten und kühlsten war. Ich fühlte mich nicht besonders gut und setzte mich auf den Boden, wo ich mich gegen einen Baumstamm lehnen konnte.
Ich hatte die Schnauze voll von diesen Lebens- und Arbeitsbedingungen und vor allem von der Einsamkeit. Seufzend zählte ich die Tage an meinen Fingern bis zum 15. Dezember. Es waren noch zweieinhalb Wochen und noch zwanzig Flüge die mir bevorstanden. Ich konnte es kaum erwarten in eine große Maschine zu steigen, um mich in die Heimat zurückfliegen zu lassen.
In Deutschland war jetzt Winter. Wahrscheinlich grau und kalt mit Regen oder Schnee aber wie gemütlich konnte es da bei heißem Tee und Kerzenlicht zuhause sein. Das war die Zeit wo man sich Zeit nahm, um mit der Familie oder Freunden zusammen zu sitzen und zu reden. Ich vermisste sie so sehr, meine Familie und meine Freunde aber bald würde ich sie wieder sehen und wir hätten uns so viel zu erzählen.
Mit diesen tröstlichen Gedanken schlief ich ein und wachte erst wieder auf, als Ameisen die Hosenbeine meines Overalls entdeckt hatten und an meinen Beinen herauf krabbelten. Ich schüttelte sie heraus und blieb bis zum Nachmittag in der Kühle des Waldes.
Norman machte das Wetter nichts aus. Als er aus Lubumbashi zurückkam, war er gut gelaunt und nahm mich gleich mit zum Training. Am Abend saßen wir nur spärlich mit einem Slip bekleidet in seinem Zimmer. Ich hatte mir vorgenommen, endlich das Thema meiner Heimreise anzusprechen. Endlich fand ich den Mut.
„Weißt Du, dass meine Zeit in Afrika bald vorbei ist?“
Norman nickte. Sein Blick war ein wenig traurig. Dann reichte er mir eine Hand und setzte sein unwiderstehliches Lächeln auf.
„Lass uns morgen darüber reden, okay?“
Norman hatte recht. Morgen war unser freier Tag und der Abend war viel zu schade für dieses Thema. Ich nahm seine Hand, die mich zu ihm zog. Wenig später rieb sich die weiche Haut unserer nackten Körper auf dem großen Bett. Wie immer, wenn wir so nahe beieinander waren, rauschte ein wahnsinniges Prickeln durch jeden Winkel meines Inneren. Wir küssten und liebkosten uns gegenseitig vom Kopf bis zu den Füßen und wir wollten beide, dass es eine lange Nacht werden würde.
Da es wirklich eine lange und intensive Nacht geworden war, frühstückten wir erst um zehn. Norman hatte bis zum Mittagessen in der Mine zu tun und ich legte mich noch einmal auf das Bett. Eine solche Nacht spürte ich am nächsten Tag noch immer in den Knochen und besonders in meinem Hinterteil aber ich war sehr glücklich dabei.
Mir wurde schmerzlich bewusst, dass ich Norman verlieren würde aber ich wollte und musste bald nach Hause.
Wollte er deshalb erst heute mit mir über meine Rückkehr reden? Hoffte er, dass ich vielleicht doch noch einmal verlängern würde?
Diese Frage hatte ich mir auch schon gestellt aber ich konnte diese Strapazen, diese Einsamkeit und mein Heimweh nach Familie und Freunden nicht mehr länger ertragen. Meine Liebe zu Norman hatte ohnehin keine Zukunft. Das hatte ich inzwischen begriffen, obwohl es sehr weh tat. Er würde bald mit seinem Bruder nach Amerika gehen und ich gehörte nach Deutschland. Außerdem musste ich mir in den vergangenen Monaten eingestehen, dass er mich nicht so liebte wie ich ihn. Für ihn war ich sein Pilot, Freund, Gesellschafter und Sexpartner. Er hat mir immer das Gefühl gegeben, dass er mich mag und ganz geil findet aber er hat nie gesagt, dass er mich liebt. Er sorgte für mich, tat alles, damit es mir gut ging, war lieb und verständnisvoll aber wenn er es für richtig hielt auch hart und unnachgiebig. Für mich war er ein großer Bruder, ein Freund und eine Respektsperson in die ich aber dummerweise verliebt war. Ich tat alles für ihn aber ich wehrte mich heftig, wenn ich mich ungerecht behandelt fühlte. Das war für uns beide okay.
Im Augenblick kam mir in den Sinn, wie wir uns auf dem Hügel das erste Mal geküsst hatten und wie er mich in sein Bett getragen hatte, welches wir seither teilten. Es war für mich das erste echte Sexerlebnis und weil ich es mir immer nur mit einem hübschen kräftigen Mann gewünscht und vorgestellt hatte, war es unbeschreiblich schön. Wäre Norman nicht der aktive Partner gewesen, hätte ich mich nie getraut das zu tun, was wir getan haben. Er hat mir gezeigt wie schön und aufregend Sex sein kann, hat mir alle Hemmungen genommen und jetzt fragte ich mich ob es ohne ihn jemals wieder so sein kann.
Obwohl ich auf diese Frage keine Antwort fand, war mein Wille bald nach Deutschland zurückzukehren stärker als je zuvor.
Beim Mittagessen waren wir sehr schweigsam. Ich schaute ihn oft an und schließlich brach ich das Schweigen.
„Es war sehr schön mit Dir letzte Nacht.“
Norman schmunzelte.
„Ja das finde ich auch aber nicht nur diese.“
Ich atmete tief durch.
„Ich werde Dich sehr vermissen.“
Norman schob seinen Teller beiseite.
„Du willst fort und zählst schon die Tage, stimmt’s?“
Ich ließ mir mit der Antwort ein wenig Zeit.
„Ja ich habe Heimweh. Ich will mich wieder frei bewegen, Menschen und Freunde treffen, kannst Du das verstehen?“
„Klar verstehe ich das. Ich war übrigens gestern bei Kintu im Flughafen. Am Sonntag, den 16. gibt es einen direkten Flug nach Brüssel. Ich habe ihn gebeten dafür einen Platz zu reservieren. Ist das okay?“
Damit hatte ich nicht gerechnet aber ich war sehr froh, dass sich Norman bereits darum gekümmert hatte.
„Von Lubumbashi nach Brüssel – das ist super. Von Brüssel kann ich mit dem Zug nach Deutschland fahren wenn ich keinen Anschlussflug kriege.“
Ich bedankte mich bei Norman und er versprach mir am Mittwoch vor meiner Abreise das Ticket, meine Papiere und einen Scheck mitzubringen.
„Was wirst Du machen wenn ich weg bin?“ fragte ich Norman, als wir am Nachmittag Tee tranken.
Norman hielt seinen Becher mit beiden Händen.
„Ich werde über Weihnachten einige Tage mit meinem Bruder in Lubumbashi verbringen und im Januar wahrscheinlich einen neuen Piloten einweisen.“
„Habt ihr schon einen Nachfolger für mich?“ wollte ich wissen.
Norman wiegte den Kopf hin und her.
„Ich glaube ja aber genaues weiß ich noch nicht.“
Als ich ihn fragte, ob er sich schon auf Amerika freue, war seine Reaktion alles andere als überschwänglich. Einerseits freute er sich darauf aber andererseits war er nicht sicher, ob er dort leben wolle. Ich hatte den Eindruck, dass er bei seinem Bruder im Wort stand und es nur deshalb versuchen würde.
Die nächsten Tage vergingen ziemlich zäh. Es blieb schwül und heiß. Ich war jeden Abend froh, wenn ich wieder einen Tag abhaken konnte. Um die Abende und die freien Tage mit Norman noch einmal genießen zu können, verdrängte ich meine Gedanken an meine Abreise und wir sprachen nicht darüber.
Am Mittwoch meiner letzten Woche war ich innerlich ziemlich aufgeregt. Ich konnte es kaum erwarten endlich mein Ticket und meine Papiere in den Händen zu halten. Außerdem hatte ich ausgerechnet, dass ich 13.500 Dollar verdient hatte. Das war für meine Vorstellungen sehr viel Geld und ich war schon jetzt sehr stolz darauf einen solchen Scheck bei meiner Bank einlösen zu können.
Den Nachmittag verbrachte ich wie gewohnt im Hangar. Sam spürte meine Ungeduld und hatte Verständnis dafür. Wir tranken gerade Kaffee und reden darüber was ich als erstes tun würde wenn ich wieder in Deutschland wäre, als Steve die Ankunft aus Lubumbashi meldete.
Mir fiel auf, dass Norman einen niedergeschlagenen und nervösen Eindruck machte, als er mit einigen Unterlagen wie gewöhnlich erst zur Mine fuhr. Den gleichen Eindruck hatte ich immer noch nachdem er mich eine halbe Stunde später abholte und zur Unterkunft fuhr.
„Ist was nicht in Ordnung?“ fragte ich vorsichtig.
„Warte bis wir da sind“, antwortete Norman ziemlich trocken.
Ich nahm an, dass es ein Problem mit der Mine gab aber ich machte mir trotzdem Sorgen. Er ging mit mir in sein Zimmer.
„Setz Dich.“ Sein Ton gefiel mir nicht aber ich tat was er sagte.
Er setzte sich mir gegenüber an den Tisch und ich schaute ihn besorgt an.
Norman rieb sich mit der Handfläche an der Stirn und sagte knapp: „Schlechte Nachrichten für Dich.“
„Für mich?“ ich konnte mir immer noch keinen Reim darauf machen.
Norman seufzte:
„Ich habe kein Ticket, keine Papiere und keinen Scheck für Dich.“
Als ich langsam begriff was er gesagt hatte, war das wie ein Faustschlag in meinen Magen.
Ich schaute ihn an und war sicher, dass er gleich lachen und mir sagen würde, dass es ein Scherz war. Aber genau das passierte nicht.
„Bitte Norman, sag mir dass das nicht wahr ist“, flehte ich ihn an.
Er schüttelte aber ganz leicht den Kopf und sagte: „Der neue Pilot hat offensichtlich abgesagt und mein Vater will dass Du eine Weile weitermachst. Deshalb hat er mir die Papiere und den Scheck nicht gegeben.“
Mir war als schnürte jemand meine Kehle zu. Ich konnte nichts sagen und mein Blick verschwamm in den Tränen, die mir in den Augen standen.
„Tut mir leid Kleiner. Das habe ich nicht gewollt, “ fügte Norman hinzu und wollte meine Hand greifen. Ich wich ihm aus, stand auf, lief in mein Zimmer, knallte die sonst immer offen stehende Tür zu und warf mich in voller Montur auf mein Bett. Ich war nicht in der Lage einen klaren Gedanken zu fassen aber als erstes wurde mir bewusst, dass mein heiß ersehnter Rückflug nicht stattfinden würde. Ich schlug mit den Fäusten auf das Kopfkissen ein, schrie und tobte bis ich erschöpft in das Kissen sank und von Weinkrämpfen geschüttelt wurde.
Ich weiß nicht wie lange ich so dagelegen und geweint hatte. Jedenfalls als ich wieder zu mir kam, war es bereits dunkel und das Kopfkissen von meinen Tränen durchnässt.
Norman musste, ohne dass ich es bemerkt hatte, im Zimmer gewesen sein, denn die kleine Nachttischlampe war eingeschaltet und auf dem Tisch stand eine Kanne Tee und ein Teller mit belegten Broten.
Als ich das sah wollte ich wieder heulen aber ich hatte keine Tränen mehr. Ich spürte, dass er in der Nähe war aber er hatte wenigstens den Anstand, mich an diesem Abend alleine zu lassen. Ich mochte nichts essen aber der Tee tat meiner ausgedörrten Kehle gut.
Ich nahm den kleinen Teddy von meinem Nachtschränkchen und setzte ihn vor mich auf den Tisch.
„Falls Du mal keinen hast, mit dem Du reden kannst“, hatte mein Freund Patrick gesagt, als er ihn mir zum Abschied schenkte. Jetzt war es soweit und ich begann mit ihm zu reden wie in jüngster Kinderzeit.
Ich strich mit einem Finger über den winzigen flauschigen Bauch. Irgendwie hatte ich das Bedürfnis deutsch zu reden und zu denken.
„Ich will nach Hause aber sie lassen mich nicht. Warum? Ich habe doch alles eingehalten was wir abgemacht haben. Warum halten sie es nicht ein? Wer ist Normans Vater? Warum habe ich ihn nie gesehen? Warum ist er so feige und sagt es mir nicht selbst? Wie lange muss ich das Leben hier noch ertragen?“
Es waren quälende Fragen auf die auch der liebste Teddy keine Antwort weiß. Was mir innerlich am meisten weh tat war die Tatsache, dass ich ab sofort gegen meinen Willen hier festgehalten würde.
Ich glaubte Norman, dass er das nicht gewollt hat. Er hat sich aber auch diesmal nicht gegen seinen Vater durchgesetzt und deshalb konnte ich kaum damit rechnen, dass er mir wirklich helfen könnte.
Ich kam mir so allein und hilflos vor, dass ich das Bedürfnis hatte, mich unter der Bettdecke zu verkriechen, um mich vor der bösen Welt zu schützen. Ich konnte aber nicht schlafen und je mehr Gedanken durch meinen Kopf gingen je trostloser wurde meine Stimmung.
Irgendwann am frühen Morgen muss ich in einen unruhigen Schlaf gefallen sein. Als ich aufwachte war es schon heller Vormittag. Ich schwitzte unter der Bettdecke und mein Kopf brummte. Ich stand langsam auf. Meine Stiefel und mein Overall lagen auf dem Fußboden verstreut. Auf dem Tisch stand mein Frühstück mit einem Zettel auf der Tasse. Ich setzte mich an den Tisch, nahm ihn in die Hand und Lass:
Ich bin nebenan in meinem Zimmer. Bitte ruf mich oder komm rüber wenn Du willst oder wenn Du was brauchst. Bleibe nicht zu lange alleine.
Norman.
Ich zerknüllte den Zettel in der Hand und warf ihn wütend auf den Boden. Am liebsten hätte ich wieder geheult aber dann packte mich meine Ehre. Irgendetwas in meinem Inneren sagte mir: “Hör auf damit. Überlege lieber wie es weitergeht und gib Dich nicht auf. Es gibt bestimmt eine Möglichkeit da raus zukommen und wenn es Dir nicht jetzt einfällt dann später.“
Ich musste zugeben, dass an dieser Erkenntnis etwas dran war. Also beschloss ich mein Alleinsein zu nutzen und bei einem ausgiebigen Frühstück in Ruhe über meine Situation nachzudenken.
Zunächst einmal musste ich akzeptieren hier bleiben zu müssen und weiter zu fliegen. Norman musste den Eindruck gewinnen, dass ich darunter litt, mich aber langsam und brav mit der Tatsache abfinden würde. Mir blieb ja auch nichts anderes übrig aber ich würde Augen und Ohren offen halten, um nach Möglichkeiten einer Flucht nachzudenken. Was mich dabei etwas beruhigte war die Tatsache, dass ich wenigstens noch Geld hatte, von dem Norman nichts wusste.
Da ich die Umstände im Camp und bei meinen Flügen zur Genüge kannte, hatte es keinen Zweck sofort über Fluchtpläne nachzudenken. Dazu brauchte ich Zeit. Wahrscheinlich sogar viel Zeit.
Stattdessen musste ich mir einen Plan machen, wie ich mich jetzt verhalten sollte ohne dass meine Absichten erkennbar wurden.
Ein dumpfes drückendes Gefühl hatte ich immer noch in der Brust aber ich konnte wieder rational denken und darauf war ich irgendwie stolz.
Ich nahm meinen Teddy und gab ihm einen Kuss.
„Wir schaffen das schon irgendwie“, sagte ich und setzte ihn wieder auf das Nachtschränkchen.
Am Nachmittag schlich ich mich über den Flur auf die Toilette. Nachdem ich die Spülung gezogen hatte, rief ich im Flur nach Norman. Es dauerte keine fünf Sekunden bis er an der Tür erschien. Ich stand in Unterwäsche und zerzausten Haaren da und sagte:
„Hast Du für Deinen Gefangenen eine Kopfschmerztablette?“
Während er zum Medizinschrank ging, trottete ich in mein Zimmer und setzte mich auf das Bett. Kurz darauf erschien er mit einer Tablette und einem Glas Wasser. Mit leidendem Gesicht nahm ich die Tablette und spülte sie mit dem Glas Wasser hinunter. Er schaute auf den Tisch.
„Na wenigstens hast Du gut gefrühstückt.“
„Ich hab’s versucht aber ich musste es leider vorhin wieder ausspucken“, log ich glaubhaft.
Norman seufzte.
„Tut mir leid aber ich fühle mich auch nicht besonders gut dabei. Kann ich sonst noch was für Dich tun?“
Ich deutete schwach auf meine Sachen auf dem Boden.
„Wenn ich mich bücke platzt mir der Schädel.“
Mit leichtem Widerwillen hob Norman meinen Overall auf, brachte ihn zum Wäschekorb und stellte anschließend meine Stiefel neben den Schrank.
„Danke“, hauchte ich matt. „Ich habe die ganze Nacht nicht geschlafen. Lass mir bitte noch ein bisschen Ruhe.“
Er zog die Stirn kraus.
„Okay, ich bin nebenan und schaue später wieder nach Dir.“
Als er die Tür geschlossen hatte, streckte ich mich ein wenig erleichtert aus. Fürs erste hatte es geklappt. Ich musste nur vorsichtig sein sonst konnte er den Spieß sehr schnell umdrehen.
Es gelang mir sogar noch ein wenig zu schlafen und wurde wach, als Norman ins Zimmer kam, um nach mir zu sehen.
„Na, geht es Dir jetzt besser?“ fragte er.
„Ja etwas“, gab ich zu.
„Hast Du Hunger?“
Ich schüttelte den Kopf.
„Ich möchte ein bisschen spazieren gehen. Darf ich?“
„Warum fragst Du und gehst nicht?“
Ich schaute ihn vorsichtig an.
„Weil ich jetzt Dein Gefangener bin.“
Für einen Moment sah es so aus als würde er die Beherrschung verlieren aber dann holte er tief Luft.
„Micha hör auf so zu reden. Du bist nicht mein Gefangener.“
„Okay Du hast recht. Genau genommen bin ich der Gefangene Deines Vaters aber was ist das für ein Unterschied? Du tust doch was er will und offensichtlich akzeptierst Du es auch.“
Es war nicht zu übersehen, dass Norman einen roten Kopf bekam. Er ging nervös im Zimmer auf und ab.
„Ich arbeite für die Firma und mein Vater ist in diesem Fall mein Boss.“
Ich hatte nicht die Kraft meine Empfindungen auszudiskutieren und schwieg weil ich mich einem handfesten Streit nicht gewachsen fühlte.
Norman kam näher und ging vor meinem Bett in die Hocke.
„Ich sage Dir noch einmal dass es mir Leid tut. Lass uns das Beste daraus machen und so miteinander umgehen wie bisher.“
Ich fasste an meine Brust und schaute zur Decke.
„Es tut so verdammt weh. Ich hoffe, dass es nicht so lange dauert aber Lass mir ein bisschen Zeit.“
„Soll ich Dich alleine lassen?“ fragte er gefühlvoll.
Ich schüttelte den Kopf. „Willst Du mit mir spazieren gehen?“
Normans Blick verriet etwas Erleichterung und er stand langsam auf.
„Ja klar. Ich gehe mit wenn Du willst.“
Ich stieg aus dem Bett und zog mir meinen Trainingsanzug und Turnschuhe an. Langsam gingen wir zum Wald in Richtung Hügel. Ich musste mir einiges von der Seele reden und fing einfach an ohne eine Antwort zu erwarten.
„In den letzten Tagen habe ich mich so sehr darauf gefreut wieder nach Hause zu kommen. Ich wollte Dich fragen, ob ich die Overalls und die Stiefel mitnehmen kann damit ich sie meiner Familie und meinen Freunden zeigen und ihnen von meinen Flügen und Erlebnissen erzählen kann. Von Dir, von Sam und von Kitty, dass es manchmal hart aber auch schön war. Ich wollte meinen Brüdern von den Tieren in der Natur und von der Farm erzählen. Über die Weihnachtstage wollte ich mit meinem besten Freund Patrick über das Fliegen reden und erfahren, wie es ihm bei der Ausbildung in der Laufwaffe geht. Ich wollte mit meiner Mutter darüber reden, dass ich schwul bin und mich ausgerechnet in Kabunda zum ersten Mal richtig verliebt habe. Sie würde es verstehen, da bin ich mir ganz sicher. Vielleicht würde ich auch mit meinen Freunden darüber reden, zumindest mit Patrick. Er weiß es sowieso, weil er der einzige ist, mit dem ich schon immer über alles reden konnte. Er fehlt mir so und ich weiß, dass es ihm genauso geht, obwohl er nicht schwul ist. Wir sind einfach nur die besten Freunde.“
Nachdem ich das einfach so aus mir herausgeredet hatte, machte ich eine Pause. Norman hatte mir aufmerksam zugehört aber er sagte nichts. Wir umrundeten den Hügel ohne hinauf zu steigen und dann fuhr ich fort:
„Das alles war so nah und es tut so verdammt weh wenn man erfährt, dass es nur ein Traum war.“ Nach einer weiteren Pause fuhr ich fort:
„Ich schaffe das schon irgendwie und ich mache Dir auch keine Schwierigkeiten. Ich habe doch sonst niemanden und ich mag und bewundere Dich noch immer.“
Dieses Geständnis fiel mir nicht leicht und ich blieb stehen, weil mir zum Heulen war. Norman drehte sich zu mir um und nahm mich in den Arm. Diesmal wich ich nicht aus. Es war eine Geste, die ich auch ohne Worte verstand. Ich hebe geheult wie ein kleines Kind und seine Hand an meinem Kopf hat mich getröstet.
Als wir unseren Spaziergang beendet hatten, spürte ich Normans Verlegenheit. Ich hatte das Gefühl er wollte mir etwas sagen, um mich zu trösten, wusste aber offensichtlich nicht was oder wie er es sagen sollte.
Ich boxte ihm ganz leicht gegen die Brust.
„Danke, dass Du mir zugehört hast.“
Bevor er darauf reagieren konnte, fügte ich hinzu:
„Lass uns jetzt nicht mehr darüber reden. Ich hoffe dann komme ich am ehesten darüber hinweg, okay?“
Man konnte deutlich sehen, wie sich seine Gesichtszüge entspannten.
„Ja okay“, meinte er sichtlich erleichtert und dann war ich es, der ihn animierte, mit mir trainieren zu gehen.
Obwohl ich mir alle Mühe gab, mich nicht hängen zu lassen, blieb mir der Schmerz der Enttäuschung in Form von dumpfen Bauchschmerzen. Egal was ich versuchte, die Bauchschmerzen blieben und das machte mich ziemlich fertig. Ich erklärte Norman, dass ich heute wieder in meinem Zimmer schlafen wollte und er zeigte Verständnis dafür.
Nachdem ich mich lange im Bett hin und her gewälzt hatte und keinen Schlaf fand, ging ich ins Bad und durchsuchte den Medizinschrank. Schließlich fand ich eine kleine Flasche Baldriantropfen. Ich nahm einen ganzen Löffel voll und setzte mich eine Weile außen auf die Türschwelle. Die frische Luft tat mir gut und ich wurde endlich müde. Ich hatte plötzlich das Bedürfnis nicht allein zu sein und öffnete vorsichtig die Tür zu Normans Zimmer. Er schlief und ich schlüpfte kurz entschlossen hinein und legte mich neben ihn, ohne ihn zu wecken. Sein gleichmäßiger Atem war so beruhigend, dass ich sofort einschlief. Als er mich am frühen Morgen weckte, lächelte er mich an. Ich merkte, dass er sich darüber freute, mich in seinem Bett zu finden. Ich hingegen war mir nicht sicher ob es richtig war aber wenigstens hatte ich ein paar Stunden geschlafen. Ich spürte immer noch meinen Bauch und versuchte mich auf das Fliegen zu konzentrieren. Es war eine merkwürdige Atmosphäre der Sprachlosigkeit. Ich hatte keinen Nerv zu reden und Norman hatte Hemmungen oder Angst irgendetwas Falsches zu sagen.
Am Samstag nach unserer Rückkehr von Cabora Bassa machte Norman den Vorschlag auf den Hügel zu steigen und Steaks zu grillen. Da mir nichts Besseres einfiel, war ich einverstanden.
Als wir oben waren, half ich Norman erst einige Scheite Holz zu hacken. Nachdem das Feuer angezündet war, schauten wir uns den Sonnenuntergang an. Norman legte dabei vorsichtig seinen Arm auf meine Schulter. Kurz darauf legte ich meinen Arm um seine Taille. Ohne etwas zu sagen standen wir da bis die Sonne am Horizont verschwunden und das Holz gut angebrannt war. Anschließend grillten wir die Steaks und aßen sie mit Fladenbrot. Norman hatte wieder eine Flasche Rotwein geopfert und so saßen wir im Schein des Feuers.
„Wir haben in letzter Zeit nicht viel geredet“, stellte Norman plötzlich fest.
„Ja stimmt.“
„Ich weiß einfach nicht wie ich es anfangen soll. Ob Du überhaupt mit mir reden willst.“
„Ich weiß es ja selber nicht“, gab ich zu. „Mir geht es nicht besonders gut. Ich kann nichts dafür und ich kämpfe dagegen an aber es ist das verdammte Heimweh.“
Norman stocherte mit einem Stock in der Glut.
„Ja man merkt, dass es Dir nicht gut geht und ich wünschte ich könnte Dir irgendwie helfen.“
Ich schüttelte mit dem Kopf.
„Da muss ich alleine durch.“
Norman seufzte.
„Aber dann Lass uns doch wenigstens darüber reden.“
„Ich habe Angst, dass es dadurch nur noch schlimmer wird“, gab ich zu Bedenken.
„Okay, ich habe es einfach nur gut gemeint.“
Norman schwieg eine Weile und drehte sich dann zu mir um.
„Eins muss ich Dich aber noch fragen. Als wir vorgestern spazieren gegangen sind hast Du ganz allein geredet. Das war doch gut oder?“
Ich holte tief Luft.
„Ja in dem Moment war es gut. Ich musste es einfach loswerden.“
Er schien zu überlegen was er sagen sollte.
„Du hast auch gesagt, dass Du dich in Kabunda zum ersten Mal richtig verliebt hast. Ist das war?“
Jetzt hatte er meinen wunden Punkt getroffen.
„Ja verdammt, es ist wahr!“ rief ich als sollte es das ganze Camp hören.
Norman zuckte merklich zurück. Dann hockte ich mich näher ans Feuer und schaute ihn an.
„Keine Sorge ich habe mich im Laufe der Zeit damit abgefunden.“
„Womit hast Du dich abgefunden?“ fragte er.
„dass wir eines Tages wieder unsere eigenen Wege gehen.“
„Ja, daran habe ich auch oft gedacht.“
Das Flackern des Feuers spiegelte sich in seinen Augen. Wir schauten uns eine ganze Weile an. Mir wurde bewusst, dass Norman genauso schön war wie ich es an unserem ersten Abend hier oben empfunden hatte. Er war mein einziger Trost bei dem Gedanken, dass ich hier bleiben musste. In meinem Herzen wurde der Wunsch immer stärker ihm nahe zu sein. Deshalb raffte ich mich auf und nahm ihn in die Arme.
Er lächelte und küsste mich.
Als ich am nächsten Morgen neben ihm aufwachte, hatte ich ein schlechtes Gewissen. Mir war eingefallen, dass ich meinen Eltern schreiben musste. Ich hatte ihnen mein Wort gegeben, das ich zu Weihnachten wieder zu Hause wäre. Mir war es immer wichtig mein Wort zu halten aber diesmal konnte ich es nicht und hatte noch keine Ahnung wie ich das erklären sollte. Statt mir darüber Gedanken zu machen, hatte ich mit Norman geschlafen und Sex gehabt, als ob alles in bester Ordnung wäre.
Ich stand auf und ging in mein Zimmer während Norman noch schlief, ließ aber die Tür offen.
Als wenn ich mich damit bestrafen wollte, knallte ich den Schreibblock auf den Tisch und setzte mich davor. Erst jetzt ging mir die Frage durch den Kopf was ich eigentlich schreiben wollte. Sollte ich schreiben: „ Bitte helft mir. Ich will nach Hause aber man Lässt mich nicht?“
Nein das kam nicht in Frage. Nicht wegen meinem Stolz aber diese Form von Wahrheit würde zumindest meine Mutter nicht verkraften. Es würde meine Familie schwer belasten und das wollte ich auf keinen Fall. Wie sollten sie mir auch helfen?
Ich hörte wie Norman nebenan aufstand. Nur mit Slip bekleidet kam er einen Schritt in mein Zimmer und fragte besorgt, ob alles in Ordnung sei.
Da ich eher böse mit mir und nicht mit ihm war, sagte ich:
„Ja alles in Ordnung. Ich war nur ausnahmsweise mal früher wach als Du und ich wollte Dich nicht wecken.“
Als er sich daraufhin umdrehte und ins Bad ging, kam mir ein weiterer Gedanke. Würde Norman in dieser Situation einen Brief von mir abschicken wenn er nicht wusste was ich darin geschrieben habe? Woher sollte er wissen, ob ich nicht einen Hilferuf abschicke, der auf irgendeine Weise Schwierigkeiten für die Firma bedeuten könnte.
Ich seufzte und stand wieder auf. Erst einmal frühstücken, dachte ich. Wenn ich erst einmal was im Magen hätte, würde mir schon was einfallen.
Ich bemühte mich beim Frühstück nett und nicht so muffig zu sein. Wie immer an unseren freien Tagen ließen wir uns Zeit und tranken noch eine zweite oder dritte Tasse Kaffee. Dabei nutzte ich die Gelegenheit.
„Du Norman?“
„Ja?“
„Ich muss heute unbedingt einen Brief an meine Eltern schreiben. Sie machen sich bestimmt furchtbare Sorgen wenn ich nicht komme und sie nichts von mir hören.“
Norman hielt seine Tasse mit beiden Händen.
„Ja das musst Du wohl.“
Aus seiner Antwort war herauszuhören, dass er mir keinen Rat geben konnte oder wollte. Deshalb fügte ich hinzu:
„Ich kriege das schon irgendwie hin. Sie müssen nur wissen, dass es mir gut geht.“
Norman fuhr nach dem Frühstück zur Mine und ich blieb mit der Aufgabe den Brief zu schreiben allein in meinem Zimmer. Nach dem dritten Anlauf hatte ich es dann. Es fiel mir nicht leicht und ich musste manchmal aufpassen, dass mir keine Träne auf das Papier kullerte. Am Ende war ich aber überzeugt, dass es das Beste war, was ich machen konnte.
Norman kam vor dem Mittag zurück. Ich zeigte ihm den Block als Zeichen, dass ich fertig war und bat ihn, sich auf mein Bett zu setzen. Ich setzte mich neben ihn und begann den Brief zu übersetzen und vorzulesen.
„Hallo liebe Eltern, hallo meine Brüder,
es fällt mir nicht leicht, Euch heute diesen Brief zu schreiben. Eigentlich wollte ich jetzt im Flugzeug sitzen, um von hier aus direkt nach Brüssel zu fliegen und nach Hause zu kommen.
Ja das wollte ich wirklich und ich habe mich schon darauf gefreut. Nicht nur weil ich Euch mein Wort gegeben habe an Weihnachten wieder zuhause zu sein. Mein Platz in der Maschine war schon gebucht aber vor drei Tagen sagte mir Norman, mein Chef, dass der Pilot, der mich ablösen sollte, unerwartet abgesagt hat.
Ich war natürlich sehr enttäuscht und es ist mir sehr schwer gefallen aber ich kann Norman nicht hängen lassen.
Ihr müsst verstehen, ich mag ihn sehr gern. Er ist immer da wenn ich ihn brauche. Er hat mir sehr viel von diesem schönen Land gezeigt, damit es mir an den freien Tagen nicht langweilig wurde und -– so blöd es auch klingt, er passt immer auf, dass ich genug esse, ordentlich angezogen bin und Sport treibe.
Ich bin ein wenig traurig, dass ich Weihnachten und an meinen 20. Geburtstag etwas einsam und ohne Euch verbringen muss aber macht Euch keine Sorgen. Denkt an diesen Tagen an mich und ich denke an Euch. Dann sind wir uns in Gedanken ganz nahe.
Es ist sowieso ziemlich komisch für mich an Weihnachten zu denken. Hier ist es sehr warm und manchmal so schwül wie in der Sauna.
Irgendwann im Frühjahr kommt ein neuer Pilot und dann komme ich so schnell ich kann. Das verspreche ich Euch und das halte ich auch.
Ich denke auch oft an Patrick und hoffe, dass es ihm bei der Luftwaffe gefällt. Vielleicht hat er auch schon die Erfahrung gemacht, dass Fliegen eine harte Arbeit sein kann. Ich habe hier schon über 900 Flugstunden hinter mir. Das ist viel mehr als jeder Linienpilot in dieser Zeit macht. Aber Vater sagt ja auch immer, dass Arbeit nicht schändet.
Grüßt Patrick von mir und sagt ihm, dass ich hier verdammt viel gelernt habe und oft an ihn denke.
Es tut mir leid aber ich kann nicht anders. Ich habe Euch alle sehr sehr lieb. Das merkt man erst richtig wenn man weit weg ist.
Ich wünsche Euch frohe Weihnachten, einen guten Rutsch ins neue Jahr und mit ganz lieben Grüßen bin ich
Euer Micha“
Norman hatte mir ganz still zugehört. Als ich zu Ende war, legte er mir einen Arm auf die Schultern und sagte nach einer Weile:
„Ich beneide Dich um Deine Familie und bewundere Deinen Charakter.“
Ich hatte ihm den Brief nicht vorgelesen, um ihn zu beeindrucken, sondern um sicherzustellen, dass er ihn abschickt.
Deshalb war ich mir unsicher aber ich fragte ihn trotzdem:
„Du meinst, Du vermisst Deine Mutter, stimmt’s?“
Er nickte.
„Ja manchmal.“
Ich umfasste seine Taille.
„Du hast einen Bruder. Ich glaube er ist Deiner Mutter sehr ähnlich. Pass auf ihn auf und höre wenigsten manchmal auf ihn, auch wenn er der jüngere ist.“
Norman schmunzelte und zog mich nach hinten. So lagen wir eine ganze Weile mit den Oberkörpern auf meinem Bett und es tat mir gut, dass er bei mir war.
Ich hatte die Sorge, dass der Brief nicht mehr vor Weihnachten ankommen würde aber Norman gab sich zuversichtlich. Er schrieb einen Zettel an die Sekretärin seines Vaters und bat sie dafür zu sorgen, dass der Brief per Luftpost auf dem schnellsten Wege nach Deutschland gelangen würde.
„Die hat damit Erfahrung“, sagte er, heftete den Zettel an den Brief und versprach mir, ihn morgen auf den Kurierflug nach Lubumbashi mitzugeben.
Am Nachmittag fiel mir ein, dass heute der dritte Advent war und ich bekam ein großes Verlangen Plinsen zu backen. Das ist eine schlesische Spezialität und mein Vater machte sie manchmal an einem Adventssonntag zum Kaffee. Ich mochte sie wahnsinnig gern und heute hatte ich ein unbändiges Verlangen danach.
Zuerst überredete ich Norman mit mir in die Kantine zu gehen und dann gelang es mir sogar Kitty davon zu überzeugen, dass ich einmal in ihrer Küche tätig sein wollte. Schließlich wusste ich, dass es dort fast alles gab was das Herz begehrt und so fand ich was ich brauchte.
Zuerst rührte ich einen Pfannkuchenteig und verdünnte ihn mit Milch bis er fast flüssig war. Dann kam etwas Pflanzenöl in eine gusseiserne Pfanne, in der ich den Teig zu dünnen goldgelben Pfannkuchen backte. Nebenbei bereitete ich eine Soße aus süßer Sahne, die ich in einem Topf mit einem reichlichen Stück Butter und Zucker erhitzte. Diese Soße wurde mit einem Löffel auf jedem Pfannkuchen verstrichen und diese dann zusammengerollt.
Norman und Kitty schauten mir gespannt zu, bis ich einen Berg von zwanzig Plinsen fertig hatte, die ich zwischendurch immer wieder in der Backröhre warm stellte. Nun brachte ich die Plinsen mit einer großen Kanne Kaffee auf den Tisch.
„Wer soll das alles essen?“ fragte Norman.
Ich schaute ihn gnädig an und sagte: „Zehn für mich und der Rest für Euch.“
Sie waren mir gut gelungen. Als ich die erste Plinse aß war ich happy und sie schmeckten sogar wie zuhause. Norman und Kitty mochten sie auch, so dass wir sie restlos verspeisten.
„Würde mich nicht wundern, wenn Du sogar kochen kannst“, meinte Norman lobend.
„Wenn Du mir versprichst, dass ich es nicht immer tun muss und Du eine Flasche Rotwein spendierst mache ich etwas zu Sylvester.“ Der Gedanke kam mir spontan aber ich hatte richtig Lust dazu bekommen.
Norman hob seine Hand und ich schlug ein. Auf diese Weise hatte der Sonntag für meine Stimmung noch eine gute Wendung genommen.
Die Flüge in der Vorweihnachtswoche liefen routinemäßig. Allmählich herrschte wieder ein stabiles Hochdruckwetter. Die Temperaturen waren zwar recht hoch aber erträglich, da die Schwüle der letzten beiden Wochen verflogen war.
Am Donnerstag erklärte mir Norman, dass an den beiden Weihnachtsfeiertagen, die auf Sonntag und Montag fielen, nicht geflogen würde. Dafür aber Dienstag und Mittwoch.
„Wolltest Du nicht über Weihnachten ein paar Tage zu Deinem Bruder?“ fragte ich ihn.
„Ja“, meinte er, „ich habe es Jason schon lange versprochen aber es geht leider nur am Sonntag und Montag. Steve fliegt am Samstagabend nach Lubumbashi und Montagabend zurück. Ich will Dich aber auch nicht so gerne alleine lassen.“
Ich ließ mir meine Enttäuschung nicht anmerken. Mir war klar, dass es aussichtslos war, dass Jason nach Kabunda kommen würde. Mir war auch klar, dass Norman mich nicht nach Lubumbashi mitnehmen würde. Es wäre für mich die ideale Chance abzuhauen und das wusste er. Deshalb ersparte ich es uns beiden, ihn darum zu bitten.
„Klar musst Du zu Deinem Bruder. Ich komme auch alleine zurecht, “ sagte ich so locker wie möglich.
„Danke für Dein Verständnis. Tut mir leid aber Du weißt ja, dass Jason nicht hierher kommt.“
Ja, das wusste ich aber es bewies zumindest, dass er sich auch darüber Gedanken gemacht hatte und mich nicht gerne alleine ließ.
Kapitel 4
Am Samstag, Heiligabend, war mein zwanzigster Geburtstag. Ich versuchte nach dem Aufstehen nicht daran zu denken und war froh, dass ich fliegen musste. Es wäre mir sogar lieber gewesen, wenn heute Cameia und nicht Cabora-Bassa dran gewesen wäre. Dann wäre der Flug länger und der Tag würde schneller vorbeigehen.
Als wir am Nachmittag in Kabunda landeten, war mir schon ein bisschen komisch zumute. Kaum hatten wir das Flugzeug in den Hangar geschoben, nahmen mich Sam und Norman in die Mitte und führten mich in Sams Magazin. Dort stand ein kleiner Kuchen neben einer brennenden dicken roten Kerze.
Ich schaute etwas ratlos und dann umarmte mich Norman und sagte:
„Happy Birthday, alles Gute zu Deinem 20. Geburtstag.“
Als er mich aus seiner festen Umarmung entließ, streckte mir Sam seine Pranke entgegen und schloss sich den Geburtstagswünschen an.
Ich war so überrascht und gerührt, dass ich ganz glasige Augen bekam. Ich hatte nicht damit gerechnet, dass ich hier zu meinem 20. Geburtstag irgendwelche Glückwünsche bekam und deshalb freute es mich umso mehr.
Während Sam Kaffee in die Becher goss und den Kuchen schnitt, kramte Norman zwei Päckchen hinter der Tür hervor und überreichte sie mir.
„Zwei kleine Geschenke für Dich.“
Dabei hatte er das unwiderstehliche Lächeln aufgelegt, das ich über alles an ihm liebte. Ich musste mich in der Gegenwart von Sam mächtig zurückhalten, um Norman nicht gleich um des Hals zu fallen.
Norman war einverstanden, dass ich die Päckchen erst in der Unterkunft auspacken würde und so widmeten wir uns erst einmal Malzkaffee und Kuchen.
Eine halbe Stunde später fuhr Norman mit mir in unsere Unterkunft. Norman bestand jetzt darauf, dass ich die Geschenke auspackte.
In dem ersten fand ich einen neuen Trainingsanzug und ein halbes Dutzend neuer T-Shirts. In dem zweiten befand sich ein wunderschöner Bildband mit Luftaufnahmen verschiedener Nationalparks in Zentralafrika.
Nachdem ich mich bedankt hatte, fiel ich ihm wirklich um den Hals und daraus wurde ein leidenschaftlicher Kuss.
„Probier ihn mal an“, sagte er und deutete auf den Trainingsanzug.
Ich schälte mich also aus Stiefeln und Overall, was er zur gleichen Zeit auch tat und als ich nur noch in Slip und Socken nach den neuen Teilen greifen wollte, fassten seine Hände von hinten um meinen Oberkörper.
„Ich hab’s mir anders überlegt“, hauchte er mir ins Ohr und zog mich rückwärts auf das Bett. Etwas Schöneres konnte ich mir im Moment gar nicht wünschen. Im Nu lag ich ausgestreckt auf dem Rücken und Norman befand sich auf Knie und Ellenbogen gestützt über mir. Seine weichen Lippen und seine Zunge übersäten mein Gesicht und anschließend meine Brust mit Küssen. Er tat das mit einer Leidenschaft, als hätten wir schon länger keine Liebesnacht mehr miteinander verbracht. So wie ich lag konnte ich nichts weiter tun, als mich dem Gefühl des Schwebens hinzugeben.
Es war das erste Mal, dass wir Sex bei Tageslicht hatten aber es war unglaublich schön. Wir lagen noch eine Weile eng umschlungen und genossen ganz einfach die Nähe des anderen. Schließlich kam der Zeitpunkt, wo wir uns aufrafften und gemeinsam unter die Dusche gingen. Wir mochten es beide, uns gegenseitig einzuseifen und abzutrocknen und hatten immer viel Spaß dabei.
Norman zog sich anschließend für seinen Besuch bei Jason an und packte ein paar Sachen zusammen, während ich in meinen neuen Trainingsanzug schlüpfte und einen Brief aus meinem Zimmer holte, den ich Norman für seinen Bruder Jason mitgab.
Ich hatte den Brief offen gelassen, um Norman damit anzudeuten, dass ich keine Geheimnisse hatte, denn ich hatte geschrieben:
Lieber Jason,
es ist schon eine Weile her seit ich Dich kennen gelernt habe und ich muss immer an Dich denken wenn Dich Norman besucht. Ich hoffe, dass es Dir gut geht und Du immer noch so gut drauf bist wie damals bei den van de Waals.
Ich will Dich nicht langweilen, sondern Dir ein frohes Weihnachtsfest wünschen.
Genieße die kurze Zeit, in der Dich dein Bruder besucht, den ich so sehr liebe.
Ich wünsche mir so sehr, Dich einmal wieder zu sehen aber ich weiß nicht wann und wie.
Machs gut und herzliche Grüße
Micha
Als Norman fertig war, schaute er mich traurig an. Ich versuchte zu lächeln und ihm zu vermitteln, dass es für mich schon in Ordnung war. Zum Abschied gab er mir einen Kuss und stieg dann in den Wagen.
Ich hatte erst überlegt, ob ich bis zum Hangar mitfahren sollte aber dann wäre mir der Abschied noch viel schwerer gefallen.
Die nächsten 48 Stunden würde ich alleine sein und zwar ganz alleine.
Ich hatte mir fest vorgenommen nicht traurig zu sein aber das wollte einfach nicht klappen.
Nach einer unruhigen Nacht stand ich schon früher auf als sonst an meinen freien Tagen. Ich hielt es im Bett nicht mehr aus weil ich an vieles denken musste, was für mich unerreichbar war.
Ich ging frühstücken und anschließend in den Kraftraum, um mich abzulenken. Nach dem Mittagessen durchstreifte ich den für mich zugänglichen Teil des Camps. Irgendwann erreichte ich den hohen Zaun, der das Camp begrenzte.
Der Anblick dieses Zauns machte mir auf brutale Weise wieder einmal deutlich, dass ich hier eingesperrt war. Selbst wenn es mir gelingen würde mich unter diesem Zaun hindurchzugraben oder darüber hinwegzuklettern, wäre meine Chance an irgendein Ziel zu kommen, ohne fremde Hilfe gleich null.
Meine Beine wurden ganz weich, mein Magen drückte und als ich mich im Schatten auf das vertrocknete Gras setzte, begann ich laut und hemmungslos zu weinen.
Ich rief meinen Vater, meine Mutter, die Namen meiner Brüder und Patricks. Meine Sehnsucht nach ihnen war so stark, dass ich von regelrechten Weinkrämpfen geschüttelt wurde, die ich nicht mehr unter Kontrolle hatte.
Ich weiß nicht mehr wie lange dieser Anfall von extremem Heimweh gedauert hat aber danach fühlte ich mich wie betäubt.
Ich war an diesem Abend noch nicht einmal in der Lage, mir ernsthafte Gedanken über eine Flucht zu machen. Das gelang mir erst am nächsten Tag aber das Ergebnis war niederschmetternd. Es gab einfach keinen Ort und keinen Zeitpunkt, von wo aus ich eine alleinige Flucht wagen konnte. Was mir fehlte war ein Verbündeter und den hatte ich nicht.
Zum Glück verging die Zeit mit diesen Überlegungen recht schnell und bald würde Norman wieder auftauchen und die einsamsten Stunden meines Lebens würden endlich zu Ende gehen.
Kurz vor Sonnenuntergang hörte ich das Geräusch der Do im Landeanflug. Ich räumte ein bisschen auf und es dauerte nicht lange bis der Rover vor der Unterkunft hielt und Norman hereinkam. Ich lief ihm entgegen und wir umarmten uns, als hätten wir uns Ewigkeiten nicht mehr gesehen.
Kaum hatten wir uns wieder losgelassen, musste ich die Augen zusammenkneifen. Da stand tatsächlich noch jemand im Türrahmen.
Mein Schreck wich in dem Moment, wo ich im Dämmerlicht Jason erkannte. Ich starrte ihn eine Weile nur an und stammelte dann:
„Ich fasse es nicht. Jason? Du hier?“
Er kam auf mich zu, lächelte mich an und nickte.
„Freust Du dich ein bisschen?“
„Oh Mann und wie ich mich freue.“
Ich verlor alle Hemmungen, umarmte ihn wie meinen besten Freund und heulte fast vor Freude.
Norman legte eine Hand auf meine Schulter.
„Sag mal Micha, hast Du was dagegen, wenn Jason ein paar Tage in Deinem Bett schläft?“
„Da fragst Du noch? Natürlich habe ich nichts dagegen. Ich werde es gleich frisch beziehen.“
Norman lachte.
„Nein Lass mal. Das mache ich wenn ich ausgepackt und geduscht habe. Setzt Euch beide solange draußen auf die Bank. Ihr habt Euch bestimmt eine Menge zu erzählen.“
Das ließ ich mir nicht zweimal sagen und verschwand mit Jason auf die Rückseite unserer Unterkunft und zündete die Petroleumlampe an.
Jason setzte sich mit angezogenen Knien auf den Boden und ich folgte seinem Beispiel. So konnten wir uns besser sehen.
„Wie geht es Dir?“ fragte ich ihn.
„Alles okay aber ich fürchte, dass es Dir nicht besonders gut geht.“
„Warum?“
Er schaute mich an.
„Da ist etwas Tieftrauriges in Deinen Augen und dann Dein Brief. Ich hatte sofort ein schlechtes Gewissen als mir einfiel, dass Du an Weihnachten ganz alleine hier in Kabunda sitzt.“
„Das mit dem schlechten Gewissen wollte ich nicht“, erklärte ich.
„Ach Micha, das weiß ich doch aber sei doch mal ehrlich.“
Ich holte tief Luft.
„Ja Du hast recht. Ich bin fast durchgedreht vor Heimweh. Gestern war ich ganz krank und hab fast nur noch geheult.“
Merkwürdigerweise hatte ich so viel Vertrauen zu Jason, dass ich das unumwunden zugab. Norman hätte ich das ganz bestimmt nicht erzählt.
„Siehst Du? Das dachte ich mir und deshalb kam ich mir ziemlich mies vor. Mein Prinzip nie wieder nach Kabunda zu kommen war Norman und Dir gegenüber ziemlich egoistisch. Vielleicht kann ich es wenigstens ein bisschen wieder gut machen.“
„Ach Jason. Ich freue mich so, dass Du da bist und ich endlich mal mit einem reden kann außer mit Norman. Das hat mir schon bei unserer ersten Begegnung so gut getan.“
Jason hatte ein ähnlich verführerisches Lächeln wie sein älterer Bruder wenn man etwas Nettes gesagt hatte.
„Norman hat mir erzählt, dass Du Sylvester was Gutes kochen willst. Wenn Du mich am 2. Januar bei dem Flug nach Cameia in Lubumbashi absetzen willst, kann ich so lange bleiben und Sylvester einen Punsch machen. Ist das okay?“
Jetzt musste ich auch lachen.
„Willst Du darauf wirklich eine Antwort? Ich sage nur ich freue mich. Ist das auch okay?“
Dann fiel mir plötzlich ein, dass ich ja ab morgen schon wieder fliegen musste und das machte mich wieder traurig.
Jason schien das zu bemerken.
„Micha was ist? Warum guckst Du jetzt schon wieder so traurig?“
„Ach ich hab ja fast vergessen, dass ich die ganze Zeit fliegen muss. Durch die blöden Feiertage habe ich nur zwei freie Tage in der Zeit. Du wirst Dich wohl ziemlich langweilen, oder?“
„Nicht wenn Du mich mitnimmst“, entgegnete er.
Ich schaute ihn ganz verdutzt an.
„Du meist mitfliegen?“
Jason nickte heftig.
„Norman sagt immer, dass Du ein verdammt guter Pilot bist.“
„So? Sagt er das?“ Ich fühlte mich richtig geehrt.
„Ja und ich bin schon verdammt lange nicht mehr mitgeflogen. Also was ist? Nimmst Du mich mit?“
„Hast Du Norman schon gefragt?“
Jason rollte mit den Augen.
„Micha. Du bist der Pilot. Ich möchte Dein okay. Norman wickele ich doch um den kleinen Finger.“
Jetzt musste ich grinsen.
„Ich gebe Dir nicht nur mein Okay, sondern auch eine persönliche Einladung. Ob Du es allerdings schaffst, dass Dein großer Bruder hinten sitzt, ist allerdings Deine Sache.“
Jason lachte und hob die Hand. Ich schlug ein und just in diesem Moment kam Norman um die Ecke.
„Na Kinder, was habt ihr ausgeheckt?“ wollte er wissen.
„Wir haben nur beschlossen, dass wir Hunger haben und Dich notfalls mitschleifen um Essen zu gehen“, sagte ich mit unschuldiger Mine.
„Micha, “ meldete sich Jason zu Wort, „hast Du nicht gehört, dass er KINDER zu uns gesagt hat?“ Dabei sprang er auf und begann mit seinem Bruder spaßhaft zu ringen.
Da er bei Norman wenige Chancen hatte, schaute er zu mir.
„Willst Du mir nicht helfen?“
Ich schaute etwas verlegen drein.
„Er ist doch mein Boss und …“
„Und Dein Lover, ich weiß“, ergänzte Jason grinsend. Der `Kampf` war damit zu Ende und Norman beteuerte, dass er `Jungs` gesagt haben wollte.
Guter Stimmung marschierten wir in die Kantine. Kitty kannte Jason noch nicht aber es gefiel ihr, dass jetzt mal etwas mehr Leben auf dieser Seite ihrer Bude war.
Wir aßen uns rundum satt und hatten richtig Spaß dabei. Ich glaube ich habe in der ganzen Zeit im Camp nicht so viel gelacht wie an diesem Abend.
Wir hatten auch noch nie so viel Zeit in der Kantine verbracht als an diesem Abend und als wir in die Unterkunft kamen, meinte Norman, dass es Zeit sei zu Bett zu gehen.
Jason schaute mich an. „Macht er das immer so?“
Ich nickte. „Es ist in Ordnung. Wir müssen morgen früh raus und da bin ich immer dankbar, wenn ich nicht allzu müde bin.“
Später, als ich neben Norman im Bett lag und noch einen Moment mit ihm schmuste, sagte er: „Ich habe Dich schon lange nicht mehr so fröhlich gesehen.“
Ich gab ihm einen Kuss.
„Mal ein anderes Gesicht, eine andere Stimme. Ich mag Deinen Bruder und danke, dass Du ihn mitgebracht hast.“
Er drehte sich zu mir um.
„Du musst Dich nicht bei mir bedanken. Ich habe es acht Jahre nicht geschafft, ihn hierher zu bringen aber Du schaffst es mit einem einzigen Brief.“
Was Norman da gesagt hatte, ging mir noch eine Weile im Kopf herum aber bald schlief ich ein.
Am nächsten Morgen weckte mich Norman wie gewöhnlich und auf dem Weg zum Bad gab er mir mit nettem Unterton den Auftrag Jason zu wecken. Ich tapste also in mein Zimmer und sah Jason so friedlich schlafen, dass ich es kaum über das Herz brachte. Da er aber unbedingt mitfliegen wollte, blieb mir nichts anderes übrig. Ich stupste ihn an.
„Jason, aufstehen!!!“
Er brummte aber nur und drehte sich um. Ich musste also zu härteren Methoden greifen und zog ihm kurzerhand die Bettdecke weg. Jason riss erschrocken die Augen auf und als er mich erkannte schloss er sie wieder und brummte:
„Hätte nicht gedacht, dass Du so brutal bist.“
Ich musste lachen.
„Was glaubst Du wohl was Dein Bruder mit mir macht. Da ist das mit der Bettdecke noch das harmloseste.“
Er machte die Augen wieder auf.
„Ehrlich?“
Ich nickte.
„Na dann will ich es mal lieber nicht drauf ankommen lassen.“ Sprach’s und krabbelte langsam aus den Federn.
Beim Frühstück konnte ich feststellen, dass Jason mindestens genauso ein Morgenmuffel war wie ich.
Vor dem Hangar streckte ich wie üblich erst mal alle Glieder. Dann holte ich eine Garnitur Kopfhörer mit Mikrofon aus der `Paula`, um sie neben dem hinteren Sitz in der `Anny` einzustöpseln. Somit war es möglich, sich zu dritt während des Fluges zu unterhalten.
Beim Beladen fragte ich Norman, ob er seinem Bruder den Copilotensitz überlassen würde.
„Klar, kein Problem“, bekam ich zur Antwort und somit war auch die Sitzordnung geregelt.
Während der Motor warmlief, erklärte ich Jason die wichtigsten Instrumente und dann ging es schon auf die Piste. Es war ein wunderschöner Tag mit guten Sichten und der aufgehenden Sonne im Rücken.
Jason war von der Aussicht ganz begeistert und deshalb hielt ich mich leicht südlich vom Kurs, um ihm einige schöne Landschaftsmerkmale zeigen zu können.
Es war schon ein schönes Gefühl, mal jemandem etwas erklären und zeigen zu können. Außerdem kam mir die knapp fünfstündige Flugzeit viel kürzer vor als sonst.
In Cameia machte Jason wilde Verrenkungen.
„Der Flug war super aber mir tut ganz schön der Hintern weh.“
Ich musste lachen.
„Ja weißt Du Jason, man kann nicht alles haben und glaub‘ mir, man gewöhnt sich daran.“
Beim Mittagessen war er aber wieder ganz locker und amüsierte sich über die beiden Typen, die auf dem klapprigen LKW standen und Benzin aus den Fässern in das Flugzeug pumpten.
Beinahe noch lustiger fand er die Prozedur, wie mich Norman auf seine Schulter nahm, damit ich vor dem Rückflug oben am Motor Öl nachfüllen konnte.
Ich schlug vor, Jason auf dem Rückflug mal unsere Schlechtwetterroute zu zeigen und Norman hatte nichts dagegen, da wir gut in der Zeit lagen.
So folgte ich gleich nach dem Start in Cameia der Eisenbahnlinie und hielt Ausschau, wann uns ein Güterzug entgegenkam. Es machte mir nämlich immer Freude, in niedriger Höhe direkt auf die schwere Dampflokomotive zuzufliegen und als Gruß mit den Tragflächen zu wackeln. Kurz vor der Grenze zu Zaire kam dann ein Kohlenzug. Ich zeigte Jason den langen Wurm am Horizont und flog darauf zu. Nachdem ich mit den Tragflächen gegrüßt hatte, stieg oben an der Lok eine kleine schneeweiße Dampfwolke auf.
„Guck Jason, das ist die Lokpfeife. Sie haben uns gesehen und gegrüßt, “ freute ich mich.
Darauf hörte ich Normans Stimme im Kopfhörer.
„Manchmal ist Micha wie ein kleines Kind.“
„Und manchmal ist Norman wie ein humorloser Opa“, konterte ich.
Jason grinste und zeigte mit dem Daumen, dass ihm meine Reaktion gut gefiel.
Der Flug über die besiedelten Gebiete entlang der Eisenbahn war ein schöner Kontrast zu der Landschaft, die wir auf dem Hinflug gesehen hatten. Nach knapp sechs Stunden landeten wir wieder in Kabunda und Jason jammerte noch mehr über sein schmerzendes Hinterteil.
Norman musste noch einmal kurz zur Mine. Jason und ich entschieden uns deshalb zu Fuß zur Unterkunft zu gehen.
„Oh Mann wie machst Du das bloß? Ich bin ja schon vom Mitfliegen total geschafft.“
Ich schaute zu Jason, den neben mir ging.
„Ach heute war doch alles optimal. Wenn das Wetter mies ist oder Gewitter zu umfliegen sind und ich das letzte Stück im Dunklen fliegen muss – das ist hart, “ erklärte ich.
„Puh, kann ich mir denken. Jedenfalls freue ich mich jetzt auf die Dusche.“
Ich lachte.
„Also mit Feierabend ist noch nicht.“
Er blickte fragend zu mir.
„Wieso? Was denn noch?“
„Warte mal ab bis Dein großer Bruder kommt.“ Mehr sagte ich dazu nicht.
Wir waren kaum zwei Minuten am Ziel. Jason hatte sich gerade auf die Türschwelle gesetzt und die Beine von sich gestreckt, als Norman mit dem Rover kam. Mit leichten Schritten kam er zur Tür, tippte Jason beim Passieren der Tür an die Schulter und sagte:
„Los Jungs, ab in die Sportklamotten!“
Bei Jasons Blick musste ich grinsen.
„Was wird das jetzt?“ wollte er von mir wissen.
„Das wird eine Stunde bei der Du dich noch mehr auf die Dusche freust“, antwortete ich betont sachlich.
Er verdrehte die Augen.
„Oh nein. Nichts gegen Sport, aber jetzt? Ich bin ziemlich geschafft.“
Da ich zum Umziehen durch die Tür musste, fasste ich seinen Arm und sagte: „Diskussion ist absolut zwecklos und wenn, dann kostet das nur Kraft, die Dir später fehlt.“
Maulend folgte er mir und ging in sein Zimmer. Als Norman und ich in unseren Trainingsanzügen in den Flur kamen, erschien auch Jason. Ich fand, dass er in Boxershorts, einem engen T-Shirt, weißen Socken und Nike-Turnschuhen verdammt gut aussah.
Norman lief voraus und ich folgte mit Jason neben mir. Wie immer legte Norman während des halbstündigen Waldlaufs ein gutes Tempo vor. An eine Unterhaltung war nicht zu denken. Als wir keuchend und schwitzend das Ziel vor dem Kraftraum erreicht hatten, mussten wir erst mal verschnaufen aber Norman ließ uns nicht viel Zeit dazu.
„Bevor ihr kalt werdet geht’s weiter. Micha auf die Ruderbank und Jason an die Gewichte.“
Jason seufzte und ergab sich seinem Schicksal. Er selbst begab sich auf das Trimmrad und nach jeweils zehn Minuten wechselten wir die Geräte. Im Raum waren nur die Geräusche der Geräte und unser keuchendes Atmen zu hören.
Nach einer halben Stunde machte Norman der Plackerei ein Ende und wir trabten zurück zur Unterkunft. Im Flur ließ sich Jason an der Wand zu Boden gleiten und stöhnte:
„Ich kann nicht mehr.“
Ich beugte mich zu ihm herunter.
„Du hast Dich doch so auf die Dusche gefreut. Willst Du zuerst?“
Er schüttelte matt mit dem Kopf.
„Ich glaube ich habe noch nicht die Kraft den Wasserhahn aufzudrehen. Geh Du zuerst.“
Ich strich ihm aufmunternd mit der Hand durch die Haare und erklärte: „Norman und ich duschen gemeinsam. Das geht schneller und macht außerdem auch Spaß.“
Das schien ihm im Moment völlig egal zu sein, denn der erwartete Kommentar blieb aus.
Die Dusche hatte selbst bei Jason die Lebensgeister so weit geweckt, so dass wir bald darauf in die Kantine marschierten und kräftig reinhauten.
Jason legte gesättigt das Besteck auf den Teller und lehnte sich auf dem Stuhl zurück.
„Also das Essen hier ist spitze aber Micha tut mir richtig leid. Wie hältst Du das nur aus und wie kann es sein, dass der Sklaventreiber auch noch Dein Lover ist?“
Ich fand es ja toll, dass Jason zu mir hielt aber auch wenn er diese Bemerkung nicht ganz ernst gemeint hatte, hielt ich es für richtig, jetzt mal etwas ernst Gemeintes dazu zu sagen.
„Weißt Du Jason, es ist ein harter Job. Es stimmt schon, dass Dein Bruder, was den Job angeht, ziemlich konsequent ist aber um ganz ehrlich zu sein, ich brauche das. Ohne ihn wüsste ich nicht, dass ich viel mehr leisten kann als ich mir vorher je selbst zugetraut hätte und nach dem Job ist er der liebste, netteste und zärtlichste Mensch, den ich je kennen gelernt habe. Ich hoffe, dass Du das verstehen kannst aber deswegen tue ich mir nicht leid.“
Jetzt meldete sich Norman zu Wort.
„Also wenn wir schon mal angefangen haben ganz ehrlich unsere Meinung über den anderen zu sagen, dann will ich mal weitermachen. Jason – Du bist der beste kleine Bruder, den sich ein großer Bruder wünschen kann. Du bist clever, gut in der Schule, manchmal ein bisschen vorlaut aber Du weißt was Du willst, kannst Dich durchsetzen und Respekt verschaffen. Was ich an Dir besonders schätze ist, dass ich mich auf Dich verlassen kann und dass wir immer über alles miteinander reden konnten. – Und Micha? Du bist der beste Pilot Deiner Altersklasse, den ich mir vorstellen kann. Du hast Dich nie beklagt und wenn Du mal maulst, dann ist das auch berechtigt oder auch mehr als das. Ich mag Dich vom ersten Moment an, wo ich Dich gesehen habe und danach immer mehr.“
Nach diesen Worten herrschte nachdenkliche Ruhe bis Norman zu seinem Bruder schaute.
„So Jason. Jetzt bist Du an der Reihe.“
„Ähm“, meinte er verlegen und schaute dann auf den Tisch.
„Okay, ich liebe und bewundere meinen großen Bruder. Er war immer für mich da wenn ich ihn brauchte. Ohne ihn wäre ich ganz alleine. Deshalb war ich auch so froh, als er Dich kennen gelernt hat. Vorher war er so ernst und traurig. Jetzt ist er viel glücklicher und Du Micha bist für mich ein super Kumpel und Freund.“
Was da jetzt so ohne Vorwarnung emotional rüber kam ging ziemlich unter die Haut. Von meiner Seite fehlte nur noch etwas. Deshalb entschloss ich mich den Rest auch noch zu sagen:
„Als ich Dich, Jason, kennen gelernt habe, warst Du mir sofort sympathisch. So offen und nett und ohne auf irgendetwas eifersüchtig zu sein. Ich mag Dich und ich habe noch nie erlebt, dass jemand so schnell einer meiner besten Freunde werden kann. Deshalb freue ich mich so, dass Du hier bist.“
Ich glaube jetzt hatte jeder das Bedürfnis dem anderen Danke zu sagen aber wir schwiegen und das war wohl auch besser so.
Auf dem Rückweg zur Unterkunft gingen wir schweigend nebeneinander. Norman legte mir einen Arm über die Schulter und ich meinen um seine Taille. Damit Jason auf der anderen Seite nicht alleine war, legte ich meinen Arm auf seine Schulter und er seinen um meine Taille.
Ich hätte so noch stundenlang weitergehen können aber unsere Baracke war ja nicht weit.
Als ich später ins Bad ging, kam mir Jason auf dem Flur entgegen. Ich hob meine Hand und er ergriff sie.
„Gute Nacht Jason. Morgen ist der Flug nicht so lang. Da können wir fast eine Stunde länger schlafen.“
Er lächelte mich an.
„Weckst Du mich?
„Wenn Du willst?“
Er nickte.
„Ich werde mich auch nicht beklagen.“
„Okay, und schlaf gut, “ antwortete ich.
„Du auch, “ sagte er und verschwand in meinem Zimmer.
Der Flug nach Cabora-Bassa versprach auch sehr schön zu werden. Zwar hatte man beim morgendlichen Hinflug die Sonne vor sich aber die Landschaft ließ sich auch aus den Seitenfenstern bewundern. Bei Serenje zeigte ich Jason die Baustelle der Eisenbahnlinie, welche von Tansania aus in Sambia Anschluss an das übrige Eisenbahnnetz des südlichen Afrika erhalten sollte. Dieses Projekt hatte für die betroffenen afrikanischen Staaten offensichtlich hohe Bedeutung, denn Jason erzählte mir, dass sie in der Schule schon viel über diesen Bahnbau gehört hatten.
Als wir die Bergkette im Grenzgebiet zwischen Sambia und Mosambique überquert hatten, erlaubte ich mir einen kleinen Umweg, um Jason die riesige Baustelle des Cabora-Bassa Stausees zu zeigen.
Später, als wir auf der staubigen Piste gelandet waren und in der schäbigen Baracke ein bescheidenes Mittagessen vorgesetzt bekamen, konnte er auch verstehen, warum ich mich hier nicht sonderlich wohl fühlte.
Da wir uns nicht lange dort aufhielten, waren wir um kurz nach zwei Uhr nachmittags bereits wieder in Kabunda. Diesmal absolvierten wir die obligatorische Sportstunde ohne Gezeter und standen bereits um halb vier unter der Dusche.
Norman musste anschließend noch mal weg und ich begab mich mit Jason nach draußen hinter unsere Unterkunft. Wir legten uns in den Schatten.
„Was machst Du sonst an einem Nachmittag wie heute?“ wollte Jason wissen.
„Lesen oder Flugbuch schreiben oder einfach nur träumen“, antwortete ich.
„Ist das nicht langweilig?
Ich nickte.
„Ja das ist es oft aber was soll ich machen? Wenn Norman Zeit für mich hat, fahren wir schon mal ein Stück raus oder gehen schwimmen aber sonst …“
Er kam auf Deutschland zu sprechen und ich musste ihm erzählen was ich dort so gemacht und erlebt hatte. Das Erzählen machte mir richtig Spaß weil er ganz gespannt darauf war.
Gegen fünf kam Norman zurück und hatte eine Kanne Kaffee mitgebracht. Ich holte drei Becher und dann saßen wir im Kreis auf dem Boden.
„Was haltet ihr davon, wen wir heute Abend grillen?“ schlug Norman vor.
Ich war begeistert und stellte mir vor was Jason wohl sagen würde, denn er kannte den Hügel ja noch nicht.
Mit einem Blick auf die Uhr stand Norman auf.
„Dann will ich mal sehen was ich von Kitty kriegen kann damit wir nicht zu spät kommen.“
„Wieso zu spät kommen?“ fragte Jason.
Ich hob die Augenbrauen.
„Das wirst Du schon sehen. Lass Dich einfach überraschen.“
Er krabbelte zu mir herüber.
„Komm sag schon.“
Ich schüttelte den Kopf und schon begann er aus Spaß mich zu kitzeln, was in eine harmlose Balgerei mündete, wobei ich Mühe hatte die Oberhand zu behalten.
Am Ende lagen wir beide auf dem Rücken und lachten.
Den ankommenden Rover hatten wir gar nicht gehört und schreckten hoch, als Norman von der Ecke aus rief:
„Nicht so faul ihr zwei.“
Neugierig ging Jason neben Norman und mir in den Wald. Er sagte aber selbst da noch nichts, als wir den Hügel hinaufstiegen. Erst oben schaute er sich um und staunte wie ein kleines Kind.
„Waau, das habe ich ja noch nie gesehen.“
Norman lachte.
„Als ich das entdeckt habe war ich fünfzehn und Du neun. Also ideal um mal Ruhe vor Dir zu haben.“
„Bist Du auch so gemein zu Deinen Brüdern?“ fragte mich Jason.
Ohne näher auf die Frage einzugehen half ich Norman Holz in den Grill zu schichten während Jason die Aussicht genoss.
Langsam entwickelte sich das Feuer und die Sonne berührte den Horizont. Still schauten wir zu wie sie langsam von unserem Teil der Erde Abschied nahm und die wundervolle Landschaft allmählich der Dunkelheit überließ.
Jason war in diesem Moment genauso ergriffen wie ich es am ersten Abend hier oben war. Es ist ein Moment, den man nie vergessen kann.
Langsam setzten wir uns an die Feuerstelle und Norman legte die Eisenplatte auf. Er hatte „zwölf“ Impala-Steaks, dazu Fladenbrot, eine Schüssel Salat und eine Literflasche Rotwein organisiert.
„Mann, Ihr lebt ja nicht schlecht“, fand Jason. „Macht Ihr das öfter?“
„Och, nur wenn es nichts besseres gibt“, flachste Norman.
Das Essen schmeckte so gut, dass wir tatsächlich alles vertilgt haben. Ich nahm mir fest vor Kitty zu fragen, welche Gewürze sie für die Steaks und den Salat verwendete.
Am Ende waren wir so satt, dass wir eine Pause brauchten um irgendetwas zu sagen. Norman saß auf dem quer liegenden Holzstamm, ich auf dem Boden an seine Beine gelehnt und Jason auf einem Holzklotz, uns schräg gegenüber. Im Schein des Feuers konnte ich erkennen, wie er zu uns herüberblickte. Norman spielte mit einer Hand in meinen Haaren und ich streichelte seine Wade.
„Mann, muss Liebe schön sein“, meinte Jason seufzend.
Ich quittierte seine Bemerkung mit einem Lächeln. Er hatte ja so recht aber mein Magen war so voll, dass mein Gehirn keine passende Antwort darauf produzieren konnte.
„Wann wollen wir denn morgen losfahren?“ fragte Norman.
Erst verstand ich die Frage nicht, denn Norman hatte, egal was anlag, bisher immer bestimmt wann was losging. Dann fiel mir aber siedend heiß ein, dass morgen ja der letzte Donnerstag im Monat war und wir zur Farm fahren würden. Ich hatte mir sogar vorgenommen bei den van de Waals ein paar Sachen zu besorgen, sie ich für das Sylvesteressen benötigte aber seit Jason hier war, hatte ich daran nicht mehr gedacht.
„Seit wann fragst Du?“ gab ich mich erstaunt.
„Wovon redet ihr eigentlich?“ wollte Jason wissen.
„Morgen geht’s zu den Fleischtöpfen“, erklärte ich grinsend.
„Häh?“
Norman verpasste mir einen Klaps auf den Hinterkopf und klärte seinen kleinen Bruder auf.
Der strahlte erfreut.
„Waau, ist ja super. Glaubst Du, dass Philippe auch da ist?“
Norman nickte und seinem Gesichtsausdruck konnte man entnehmen, dass er sich darauf freute.
„Also um acht“, verkündete Norman. Das war früher als sonst aber ich konnte verstehen, dass er für einen alten Freund etwas Zeit haben wollte.
Nachdem wir die Flasche Wein geleert und noch ein bisschen geredet hatten, packten wir die Sachen zusammen und machten uns auf den Heimweg.
Am nächsten Morgen war Norman der erste im Bad und ich weckte Jason.
„Hast Du gut geschlafen?“ fragte ich als er noch unschlüssig auf dem Rücken lag.
Mit einem schelmischen Grinsen fragte er: „Sag‘ mal, seid ihr immer so laut wenn ihr … na Du weißt schon.“
Puh, mir schoss das Blut in den Kopf. Norman und ich hatten ja mal wieder unserem Verlangen freien Lauf gelassen und ich spürte noch immer ein leichtes Ziehen in meinem Hintern.
„Oh, äh, wir haben wohl nicht daran gedacht, dass jemand in der Nähe ist, der uns hören kann“, versuchte ich mich bzw. Norman und mich zu erklären.
Zum Glück ließ er es mit einem breiten Grinsen bewenden und während er ins Bad verschwand, erzählte ich Norman, was sein Bruder bemerkt hatte. Er machte ein ertapptes Gesicht und meinte: „Na ja, dumm gelaufen aber es ist nun mal so.“
Ich kam wie so oft als letzter ins Bad und musste mich auf Normans Drängen tierisch beeilen.
Nach dem Frühstück luden wir die leeren Behälter in den Rover und Norman machte es sich halb liegend auf dem Rücksitz bequem.
„Einigt Euch wer hin und wer zurückfährt. Ich will es heute einmal gut haben, “ meinte er und grinste uns an.
Kaum hatte ich mich versehen, saß Jason schon am Lenkrad. Also war die Sache bereits entschieden. Wie die meisten amerikanischen Kids, hatte Jason bereits mit sechzehn Jahren den Führerschein gemacht. Allerdings fehlte ihm die Fahrpraxis und der schwere Rover erforderte ziemliche Kraft am Lenkrad. Jason nahm am Anfang nicht nur jedes Schlagloch mit, er verschaltete sich auch einige Male. Auf diese Weise wurden wir ziemlich durchgeschüttelt aber wir hatten auch eine Menge Spaß dabei.
Am späten Vormittag erreichten wir schließlich das Haus der van de Waals. Ich hatte mich schon daran gewöhnt, dass wir auf der Terrasse begrüßt wurden. Frau van de Waal war völlig überrascht, dass Jason auch mitgekommen war und begrüßte ihn überschwänglich. Dann rief sie Philippe und kurz darauf erschien der Sohn des Hauses. Er war einen halben Kopf kleiner als Norman aber sehr kräftig und sportlich in seiner Figur. Er trug einen sehr kurzen Haarschnitt, der seiner Erscheinung etwas Eigenwilligkeit verlieh.
Zuerst begrüßte er Norman und fasste ihn dabei an den Schultern. Ebenso kam Jason an die Reihe und mir reichte Phillipe die Hand.
„Hallo, Du musst wohl Micha sein.“
Ich nickte und schaute ihm kurz in seine braunen Augen.
„Hab schon von Deinem Einsatz bei der Viehzählung gehört“, fügte er hinzu.
Wir setzten uns an den großen Tisch und bekamen gekühlten Maracujasaft serviert. Während sich Philippe, Norman und Jason viel zu erzählen hatten, wandte ich mich an Frau van de Waal und erzählte ihr von meinem Vorhaben am Silvesterabend. Sie war ganz erstaunt, dass ich kochen wollte und dann noch einen Sauerbraten.
Sie hatte schon davon gehört aber wie man ihn zubereitet wusste sie nicht. Ich erklärte ihr, dass man das Fleisch drei bis vier Tage in eine Marinade einlegen muss und was man an Zutaten dafür braucht.
Kurzerhand nahm sie mich mit in ihre Speisekammer und suchte Weinessig, Zwiebeln, Knoblauchzehen, Lorbeerblätter, Senf- und Pfefferkörner und sie fand sogar Wacholderbeeren.
Ich strahlte zufrieden und sagte: „Toll, dass Sie das alles haben. So kann ich mal etwas machen, was ich schon lange vermisst habe und die beiden können mal was aus meiner Heimat probieren.“
Frau van de Waal war ganz interessiert.
„Das würde ich gern auch mal machen. Verrätst Du mir das Rezept?“
Wer wollte da schon nein sagen und so einigten wir uns, dass ich an Ort und Stelle die Marinade für zwei Sauerbraten machte. Dadurch konnte ich meinen schon hier einlegen und das Gefäß bis zum nächsten Mal mitnehmen. Wie man den Braten später zubereitet, wie man die Soße macht und was man dazu isst erklärte ich ihr anschließend.
Es war mir ganz recht, dass Norman und Jason davon nichts bemerkten, denn sie waren mit Philippe vollauf beschäftigt.
Nach dem Mittagessen zogen sich Norman und Philippe zurück. Jason und ich beschlossen ein wenig die Gegend zu erkunden und nahmen Claire, den schwarzen Riesenschnauzer mit. Zuerst wollten wir mal zu den Stallungen gehen.
„Bist du eifersüchtig auf Philippe?“ fragte Jason auf dem Weg.
„Nein. Warum? Sollte ich?“
Er lachte.
„Entschuldige, war nur ein Scherz.“
Ich erzählte ihm, dass ich auch so einen guten Freund habe, den ich sehr vermisse und deshalb großes Verständnis für Norman hätte.
Die meisten Ställe waren leer aber in einem entdeckten wir eine Stute mit einem Fohlen. Es war erst wenige Tage alt.
„Ach ist das niedlich“, rief Jason entzückt.
Er hatte recht. Es hatte ein dunkelbraunes Fell. Die Mähne und der Schwanz waren pechschwarz. Ganz vorsichtig und immer auf die Stute achtend, ließ es sich streicheln.
Wir beobachteten eine Weile wie das kleine Fohlen Muttermilch saugte und dann schlenderten wir wieder zurück zum Haus.
Wir hatten beide Lust auf ein Bad im Swimmingpool und begannen uns auszuziehen. Ich musste Jason dabei unweigerlich beobachten, denn er hatte nicht nur ein hübsches Gesicht, sondern auch einen hübschen makellosen Körper.
Im Wasser war es herrlich. Wir schwammen und tobten fast eine Stunde im Becken, bis wir uns unter Bäumen in den Schatten legten und von der warmen Luft trocknen ließen.
Norman und Philippe sahen wir erst wieder, als es Kaffee und Kuchen gab. Anschließend beluden wir den Rover mit Fleisch und Gemüse und nahmen langsam Abschied.
Nun sollte ich eigentlich fahren aber Norman bot sich an, weil die Fahrt in der Dunkelheit immer sehr anstrengend war, er die Strecke besser kannte und ich am nächsten Tag wieder fliegen musste. Ich war ihm dafür sogar dankbar.
Es war ein sehr schöner Tag und nach dem Abendessen gingen wir bald schlafen.
Unser Flug nach Cameia begann am nächsten Morgen um kurz vor sechs Uhr, wie immer mit dem Auftauchen der ersten Sonnenstrahlen. Die `Anny‘ lag wie ein Brett in der ruhigen Luft und wir unterhielten uns über unsere Mikros und Kopfhörer über den gestrigen Tag.
Etwa auf halber Strecke überprüfte ich mal wieder routinemäßig die Kontrollinstrumente und stellte am Drehzahlmesser leichte Zuckungen des Zeigers fest.
„Seit mal einen Moment still“, gab ich den beiden durch.
„Ist was nicht in Ordnung?“ fragte Norman besorgt.
„Werde ich gleich wissen. Ich prüfe jetzt die beiden Magnetsysteme. Nicht erschrecken, okay?“
Flugzeugmotoren verfügen über eine doppelte Magnetzündung. Deshalb hat jeder Zylinder zwei Zündkerzen und im Normalfall arbeiten beide Magnetsysteme gleichzeitig.
Mit dem Zündschlüssel schaltete ich zunächst den rechten Zündmagneten ab. Jetzt fiel die Drehzahl um 300 Umdrehungen pro Minute ab und bei diesem Wert blieb der Zeiger ruhig stehen. Dann schaltete ich vom linken auf den rechten Magneten um. Jetzt konnte man ein deutliches Schütteln des Motors feststellen. Das bedeutete also den Ausfall mindestens einer Zündkerze im rechten Magnetsystem. Damit mir aber die intakten Zündkerzen in diesem System nicht total verrußen, schaltete ich wieder auf beide Systeme und schob den Kopfhörer wieder über meine Ohren.
„Habt ihr was gemerkt?“ fragte ich in die Runde.
„Na komm, sag‘ schon was los ist, “ drängte Norman.
Ich schaute nach hinten.
„Mindestens ein Zylinder läuft nur auf einer Kerze. muss ich mir in Cameia näher ansehen.“
Norman stieß einen Seufzer aus.
„Kriegst Du das wieder hin?“
Ich grinste ihn an.
„Hab ich Dich jemals irgendwo stehen lassen?“
Sein Gesicht hellte sich wieder auf und er gab mir einen Stups mit der Faust gegen die Schulter.
„Woran hast Du das bemerkt?“ wollte Jason wissen.
Ich zeigte ihm den Drehzahlmesser, dessen Nadelspitze etwa einen Millimeter hin und her tanzte.
„Puh, das kann man ja kaum erkennen“, fand er.
Ich musste lachen.
„Sollte man aber. Außerdem spüre ich das im Hintern.“
Mit einem Blick über die Schulter sah ich Norman grinsen und sagte: „Halt jetzt bloß die Klappe Norman.“
Jason schaute mich ungläubig an und ich flog ganz normal weiter.
Nach der Landung in Cameia nahm ich zunächst nur die Motorverkleidung ab. Da das Triebwerk noch viel zu heiß war, um daran zu arbeiten, gingen wir erst in die Hütte um uns zu stärken.
Jason fragte mich, ob ich auch so was wie Flugzeugmechaniker gelernt hätte.
„Ja, immer mittwochs bei Sam“, erklärte ich und dann begann Norman die Geschichte mit dem geplatzten Ölschlauch ganz dramatisch zu erzählen.
Jason war ziemlich beeindruckt. Ich war ihm dankbar, dass er die unglückliche Geschichte von dem verstopften Benzinfilter nicht erzählte.
Als ich später auf Kisten stehend die Zündkabel von den unteren Kerzen abzog, wurde ich schon bei der dritten fündig. Nicht die Kerze, sondern der Stecker war kaputt. Ich hatte keine Ahnung wie so was passieren kann aber so war es nun mal.
Zum Glück fand ich in meiner Ersatzteilkiste neben einem kompletten Satz Zündkerzen auch zwei Stecker.
Mit Zange und Schraubenzieher gelang es mir nach einiger Mühe den defekten Stecker vom Kabel abzumontieren und den neuen daran festzuklemmen. Als ich anschließend die dazugehörige Zündkerze herausgeschraubt hatte, war sie an der Innenseite schwarz wie ein Bergwerk. Ich drückte sie dem erstaunten Jason in die Hand und nahm eine neue aus der Kiste.
„Kannst Du als Erinnerung behalten“, sagte ich und stieg wieder auf meine Kisten.
Der Rest war in wenigen Minuten erledigt und ich startete den Motor zu einem Probelauf.
„Läuft wie geschmiert“, verkündete ich stolz und deutete Norman, mir die Motorverkleidung nach oben zu reichen.
Als die ‚Anny‘ wieder wie ein Flugzeug aussah, musste ich erst einmal mit Sandseife zum Brunnen und meine Hände schrubben.
Beim Einsteigen schaute ich auf meine Uhr. Wir hatten eine gute Stunde verloren.
„So Jason, heute kommst Du sogar noch in den Genuss einer Nachtlandung.“
Seinem Gesicht konnte man ansehen, dass er nicht wusste, ob er das gut finden sollte oder nicht.
Auf dem Rückflug stand der Drehzahlmesser wieder wie er sollte. Die Dunkelheit erwischte uns eine halbe Stunde vor dem Ziel. Die schmale Sichel des Mondes und der klare Sternenhimmel machten den heutigen Nachtflug fast zu einem schönen Erlebnis. Trotzdem musste ich mit Radiokompass und Stoppuhr arbeiten, um Kabunda nicht zu verpassen.
Jason guckte abwechselnd in die dunkle Nacht und dann wieder zu mir, wenn ich Frequenzen wechselte und die Zeiten überprüfte.
Pünktlich kam die Schleife des Luapula Flusses in Sicht. Jetzt nur noch Rechtskurve, dreißig Sekunden geradeaus und dann langsam nach links.
Ich schaute kurz zu Jason und sagte: „Achtung, eins – zwo – drei.“
Bei drei tauchten die winzigen Lichtpunkte der Petroleumlampen etwa drei Meilen vor uns auf.
Ich merkte wie er in seinem Sitz immer kleiner wurde.
„Oh Mann. Ist – ist das alles?“
„Keine Angst, das schaffen wir leicht“, beruhigte ich ihn und begann die Landung vorzubereiten.
Obwohl ich das schon oft und auch bei schlechteren Bedingungen gemacht hatte, war es wieder eine Landung, bei der sich die Bauchdecke spannt.
Kaum huschten die ersten Lampen links und rechts unter den Tragflächen durch, berührte das Fahrwerk auch schon den Boden.
Jason reckte vorsichtig den Kopf.
„Alles in Ordnung. Kabunda hat uns wieder, “ verkündete ich und er atmete auf.
Während Norman und ich den Flieger in den Hangar schoben und wir gemeinsam zur Unterkunft fuhren, war Jason merkwürdig still.
Erst beim Abendessen gestand er: „Noch einmal halte ich das nicht aus.“
Er meinte damit die Nachtlandung und ich konnte ihn sehr gut verstehen.
Nun kam der letzte Tag des Jahres. Um 14.30 Uhr waren wir von Cabora Bassa zurück und bereits bester Laune. Gleich nach dem Training marschierte ich zur Kantine. Für das Zubereiten des Abendessens hatte ich drei Stunden veranschlagt.
Kitty war mit dem Essen für die Minenarbeiter beschäftigt und begrüßte mich kurz.
Zuerst holte ich den zwei Kilo schweren Rinderbraten aus der Marinade, briet ihn von allen Seiten kurz an und schob ihn in die vorgeheizte Backröhre. Anschließend schälte ich eine ganze Menge Kartoffeln, die ich für den Knödelteig benötigte. Es sollten Kartoffelknödel halb und halb werden. Zwischendurch gab ich immer wieder etwas von der Marinade zum Braten, der bei 200 Grad schön vor sich hin schmorte.
Von Frau van de Waal hatte ich zwei Gläser ihres selbst eingekochten Rotkohls bekommen, die ich nun öffnete. Bevor ich den Inhalt in den Topf gab, erhitzte ich darin etwas Schweineschmalz. Das gibt dem Rotkohl eine besondere Geschmacksnote.
Über das Dessert hatte ich lange nachgedacht. Bei dem was mir zu Verfügung stand war Obstsalat nahe liegend aber mir war eher nach einem Pudding. Was macht man aber ohne die praktischen Puddingpulver von Dr. Oe…?
Ich wollte improvisieren und wenn es misslingen würde, gäbe es eben doch Obstsalat.
So nahm ich eine Pfanne, ließ darin Butter braun werden und gab dann vorsichtig Zucker hinzu, um ihn zu karamellisieren. Das Produkt aus der Pfanne rührte ich vorsichtig in Milch, ließ das ganze kurz aufkochen und dickte mit Stärkemehl an. Zu meinem Erstaunen schmeckte das wirklich wie Caramelpudding.
Jetzt hatte ich ein bisschen Zeit und Jason kam, um den Pusch vorzubereiten. Zu dritt war es in der Küche ein bisschen eng aber er bekam noch eine freie Herdplatte und kochte zunächst einmal zwei Liter starken schwarzen Tee. In einem Korb hatte er noch drei Flaschen Rotwein und eine Flasche Arak.
Ich schaute mir die Flasche an und fragte erstaunt: „Wo hast Du die denn aufgetrieben.“
Jason grinste mich an.
„Sag ich Dir nur wenn Du mir verrätst was es zu Essen gibt.“
„Kommt gar nicht in Frage. Das grenzt ja an Erpressung, “ gab ich entschlossen zurück.
„War nur ein Scherz“, meinte Jason.
„Mein Vater trinkt das Zeug gerne im Tee und als wir noch hier wohnten, hatte er immer ein paar Flaschen davon im Keller versteckt. Ich bin mal hin und habe nachgeschaut. Er waren tatsächlich noch drei Flaschen da und jetzt sind es nur noch zwei.“
Das wichtigste an einem guten Sauerbraten ist die Soße. Darum kümmerte ich mich jetzt. Wie ich die hinkriege ist mein Geheimnis aber es empfiehlt sich der Schmorflüssigkeit rechtzeitig einige Stücke Brot beizugeben. Das bindet die Soße prima und macht sie schön sämig.
Als Jason seinen Punsch fertig hatte, überredete ich ihn den Tisch zu decken. Norman und Sam, den wir auch zum Essen eingeladen hatten, kamen pünktlich um sieben Uhr. Ich hatte alles fertig bis auf die Knödel. Ich wollte sie zuletzt garen, damit sie nicht zu Brei werden, wenn sie länger aus unbedingt nötig im heißen Wasser bleiben müssten.
Schließlich war es soweit. Ich reichte Norman die Schüssel mit zwanzig Knödeln aus der Küche, Jason die Schüssel mit Rotkraut und ich selbst brachte die Platte mit dem aufgeschnittenen Fleisch und eine Schüssel mit der Soße auf den Tisch.
Als Sam die Knödel sah, meinte er: „Das sieht ja wie ein deutsches Essen aus.“
„Ist es auch“, bestätigte ich und Jason versuchte sich den leicht säuerlichen Geruch des Fleisches zu erklären.
„Also am besten schmeckt es solange es noch heiß ist. Was das ist, kann ich Euch ja nachher erzählen, “ sagte ich und begann meinen Teller zu füllen.
Die anderen folgten meinem Beispiel und nach den ersten zaghaften Bissen wich die Skepsis einem gesunden Appetit.
„Schmeckt irre“, sagte Jason und drückte seinen Knödel so, dass er möglichst viel Soße damit aufnehmen konnte.
Norman guckte zwischendurch mal in die Runde.
„Also wenn Kitty mal krank ist oder ein Kind kriegt …“ weiter kam er nicht, denn da stieß mein Ellenbogen bereits kräftig in seine Seite.
Nachdem wir alle rund herum satt waren, holte ich das Dessert und Jason den Punsch.
Mit meinem Caramelpudding hatte ich besonders bei Sam voll ins Schwarze getroffen.
Als er ihn probiert hatte war er so begeistert, dass er lachte und uns erzählte, dass seine Großmutter ihm als kleines Kind manchmal Caramelpudding gekocht hatte. Das muss so am Anfang des 20. Jahrhunderts gewesen sein.
Jason hatte inzwischen die Punschgläser gefüllt und Norman erhob sein Glas. „Nachdem wir festgestellt haben, dass Micha ebenso gut kochen wie fliegen kann, möchte ich für ihn einen Toast ausbringen und ihm für das schöne Abendessen danken. Cheers!“
Sam und Jason schlossen sich dem Toast an und ich war fast ein bisschen verlegen.
Der Punsch schmeckte ein klein wenig herb aber das mochte ich ganz gern.
Natürlich musste ich jetzt erzählen wie und was ich da gekocht hatte und Norman interessierte sich besonders dafür, wie ich die ganzen Zutaten organisiert hatte.
Dann brachten wir Sam dazu, uns einige besonderen Erlebnisse aus seiner Militärzeit in Afrika zu erzählen.
Nach dem dritten und vierten Glas Punsch verhalf uns der Alkohol zu einer sehr ausgelassenen Stimmung. Gegen zehn Uhr verabschiedete sich Sam. Er war in letzter Zeit gesundheitlich nicht so gut dran. Ich hatte manchmal den Eindruck, dass er bei manchen Bewegungen Schmerzen hatte aber er redete nicht darüber.
Norman machte den Vorschlag, das neue Jahr bei einem Lagerfeuer auf dem Hügel zu begrüßen. Jason und ich fanden den Vorschlag gut und räumten den Tisch ab. Norman füllte den Rest Punsch in eine Thermokanne, packte dazu noch ein paar Gläser in den Korb und gab ihn Jason. Draußen vor der Tür holte er eine Gitarre aus dem Rover und reichte mir eine Taschenlampe.
Es war gar nicht so leicht im Dunklen nur im Schein einer kleinen Taschenlampe den Hügel hinaufzuklettern aber nach einigen Ausrutschern hatten wir es schließlich geschafft und oben ein Feuer entfacht.
Jason verteilte ein volles Punschglas an jeden und Norman stimmte seine Gitarre. Nach einem kräftigen Schluck begann er zu spielen und sang zusammen mit Jason ein schönes Westernlied.
„Kannst Du auch ein Lied?“ fragte mich Jason anschließend.
„Ich kann nicht gut singen“, versuchte ich abzuwiegeln.
„Ach komm, das macht doch Spaß“, drängelte er.
Na gut, dachte ich. Der Punsch hatte mich mutig gemacht und ich konnte ja Elvis Presley einigermaßen imitieren. Also sang ich ‚It’s now or never‘ und Norman improvisierte eine Gitarrenbegleitung.
Dann fanden wir einige Songs aus berühmten Filmen heraus, die wir alle kannten und sangen ‚Cey Sera‘, ‚True Love‘, ‚Thats Amore‘ und noch einige andere.
Um kurz vor Mitternacht kramte Norman ganz stolz eine Flasche Champagner aus dem Korb, die er vorher unbemerkt mit hineingeschmuggelt haben muss. Dann schaute er auf die Uhr und ließ Punkt Mitternacht den Korken mit einem Knall in den Nachthimmel schießen.
Nachdem wir mit Champagner angestoßen hatten, umarmten wir uns gegenseitig und wünschten uns ein gutes neues Jahr. Dann sangen Norman und Jason die amerikanische Nationalhymne und ich fragte mich mal wieder, warum uns Deutschen So was nicht in den Sinn kommen würde.
Wir hatten noch eine Menge Spaß und machten uns erst auf den Rückweg, als die Champagnerflasche leer war.
Jason und ich rutschen mehr den Hügel hinunter als wir liefen. Wir hatten einen ordentlichen Schwips aber das störte uns nicht.
Am Neujahrsmorgen schliefen wir lange. Ich hatte einen leichten Kater und weil es den beiden offensichtlich ähnlich ging, lagen wir den Tag über mehr oder weniger faul herum. Erst am Nachmittag drängte uns Norman im Luapula schwimmen zu gehen.
Ich mochte am Abend gar nicht hinsehen, wie Jason langsam seine Sachen packte. Bevor wir zu Bett gingen traf ich ihn vor der Tür zum Bad.
„Kann ich in Lubumbashi irgendetwas für Dich tun oder besorgen und Norman für Dich mitgeben?“ fragte er.
„Ja ein Heft oder irgendetwas, worin ich mein Flugbuch ordentlich schreiben kann“, antwortete ich nach kurzer Überlegung.
Das war im Moment das einzige was mir einfiel, denn meine Aufzeichnungen waren eine primitive Zettelwirtschaft.
Er schaute mich an. „Ist das wirklich alles?“
Ich nickte und er fasste mich am Arm.
„Wenn Dir noch etwas einfällt kannst Du es mir morgen noch sagen. Du brauchst mich erst auf dem Rückweg in Lubumbashi absetzen. Dann haben wir morgen noch ein bisschen vom Tag.“
„Danke Jason. Das ist sehr lieb von Dir. Ich bin froh, dass wir so gute Freunde geworden sind. Schlaf gut.“
„Gilt für Dich auch. Gute Nacht Micha.“
Es war schön, dass Jason noch einmal auf dem langen Flug nach Cameia neben mir saß und wir uns locker unterhalten konnten. Da ich auf dem Rückweg in Lubumbashi zwischenlanden musste, flog ich noch einmal entlang der Eisenbahnlinie und wir hatten zweimal den Spaß einen entgegenkommenden Güterzug zu grüßen.
Auf dem Flughafen von Lubumbashi begleiteten Norman und ich Jason bis zum Gebäude. Norman würde seinen Bruder schon Übermorgen wieder sehen aber ich hatte keine Ahnung ob ich ihn überhaupt jemals wieder sehen würde. Deshalb war ich ziemlich traurig, als wir uns zum Abschied kurz umarmten. Ich sah ihm noch nach, bis er im Gebäude verschwand und dann legte mir Norman einen Arm auf die Schulter und wir gingen zum Flugzeug zurück.
Norman schien meine Stimmung bemerkt zu haben, denn beim Abendessen kam er darauf zu sprechen.
„Du bist wohl sehr traurig, dass Jason wieder weg ist – oder?“
Ich nickte. „Ja es ist so schade, dass die schönen Tage so schnell vorbei gegangen sind.“
„Es war für uns alle sehr schön und dass er überhaupt nach Kabunda gekommen ist, lag nur an Dir.“
Ich musste es Norman wohl glauben und war auch ein wenig stolz darauf.
Die nächsten Tage fielen mir ziemlich schwer. Die Erinnerung an die schönen Tage war noch frisch und der alte Trott und die Isoliertheit wurden mir stärker bewusst als je zuvor.
Entsprechend war meine Laune und manchmal war das Verhältnis mit Norman ziemlich gereizt. Man nennt so etwas wohl Lagerkoller. Man kann sich noch so sehr zusammenreißen und geht sich trotzdem gegenseitig auf die Nerven.
An einem Sonntag Ende Januar hatten wir wieder einmal wegen irgendeiner Kleinigkeit gestritten. Ich konnte in dieser Nacht lange nicht einschlafen. Erst am frühen Morgen fiel ich in einen tiefen Schlaf, aus dem mich Norman zur üblichen Zeit jäh herausriss. Ich bekam im ersten Moment gar nicht mit, dass es schon Zeit zum Aufstehen war. Auch als mir Norman wie üblich die Bettdecke wegzog, war ich noch nicht ganz bei Sinnen und blieb noch mit geschlossenen Augen liegen. Da hob mich Norman aus dem Bett, lud mich in der Dusche ab und drehte kaltes Wasser auf.
Als mich der Strahl auf Kopf und Rücken traf, blieb mir fast das Herz stehen. Der Schock war so heftig, das ich weder schreien, noch mich bewegen konnte. Unterdessen prasselte das kalte Wasser auf mich herab und niemand half mir.
Irgendwie gelang es mir dann mich so weit aufzurichten, das ich den Wasserhahn zudrehen konnte. Mein Herz raste wie wild und ich war allein. Norman war in das Zimmer zurückgegangen. Mir war vor Entsetzen, Angst und Wut speiübel und zitterte am ganzen Körper, als ich versuchte mich abzutrocknen.
Nachdem ich das geschafft hatte, ging ich in mein Zimmer und zog mich so schnell es eben ging an. Ich war stocksauer und fühlte mich zutiefst verletzt. Im ersten Moment dachte ich daran, einfach wegzulaufen. Ich wollte Norman nicht mehr sehen. Dann überlegte ich es mir aber doch noch anders, huschte aus der Unterkunft und rannte zur Kantine. Ich wollte vor Norman da sein und das gelang mir auch. Obwohl mir jeglicher Appetit vergangen war, nahm ich mir einen Kaffee und ein Wurstbrot bevor Norman kam. Ich schaute ihn nicht an und als er sich an meinen Tisch setzte, nahm ich mein Tablett und setzte mich demonstrativ an einen anderen Tisch.
Dabei blieb es, bis Norman laut fragte: „Können wir?“
Ich folgte ihm wortlos und hätte ihm am liebsten den Hals umgedreht.
Im Flugzeug beachtete ich ihn gar nicht und als er nach dem Start etwas sagte, schaltete ich einfach das Funkgerät ab, an dem unsere Kopfhörer angeschlossen waren. Die Spannung, die zwischen uns herrschte, war kaum zu ertragen und entsprechend endlos erschien mir der Flug.
In Cameia ließ ich mir von der alten Frau den Teller mit dem Mittagessen in die Hand geben und aß im Stehen. Ich war fest entschlossen Norman den Teller ins Gesicht zu kippen, wenn er mich irgendwie angesprochen oder gar angefasst hätte. Er tat es zum Glück nicht und so blieb es auch auf dem Rückflug.
Nach der Landung in Kabunda stellte ich den Motor ab, stieg aus und marschierte sofort in Richtung Unterkunft. Norman rief mir hinterher aber ich ignorierte es einfach. Kurz bevor ich die Unterkunft erreichte, hörte ich hinter mir seinen Rover. Ich wollte noch schnell in mein Zimmer flüchten aber im Flur holte er mich ein und kriegte von hinten meine Arme zu fassen.
Obwohl ich mich heftig wehrte, schob er mich in sein Zimmer und legte mich bäuchlings auf das Bett. Ich keuchte aber weil er meine Arme wie ein Schraubstock festhielt, konnte ich nur noch meinen Kopf von ihm abwenden.
Nach einem kurzen Moment sagte er: „Micha Du zitterst ja.“
Ich war kurz davor zu heulen.
„Ich hab Angst Norman. Was hab ich Dir denn getan?“
Jetzt ließ er plötzlich meine Arme los und strich mit einer Hand über meinen Kopf.
„Du musst keine Angst vor mir haben. Das einzige was ich will, ist, dass Du mir einen Moment zuhörst.“
Er machte eine Pause und ich musste wenigstens nicht mehr befürchten, dass er mir etwas antun würde.
Ich hörte ihn tief einatmen.
„Ich war heute Morgen sauer weil Du nach dem zweiten Wecken noch nicht aufgestanden bist und dann habe ich Mist gebaut. Ich habe irgendwie gedacht, dass es ein Spaß ist aber dann habe ich an Deiner Reaktion gemerkt, dass ich Dich tief verletzt habe. Micha glaube mir – das habe ich nicht gewollt und es tut mir leid.“
Ich war nicht in der Lage in diesem Moment etwas sagen. Das ganze hatte mir den Tag über so wehgetan, dass ich jetzt nicht darüber lachen konnte.
Norman kam nun auf die andere Seite des Bettes, kniete sich davor und nahm meine Hand.
„Micha ich will mich entschuldigen. Ich habe Deine Verachtung den ganzen Tag gespürt und mich dafür geschämt was ich getan habe. Was kann ich denn tun, damit Du mir verzeihst?“
Aus einem Augenwinkel sah ich Norman. Er kniete vor mir und dem Bett. Sein Blick war traurig und besorgt. Jetzt lag es an mir.
Ich öffnete die Augen und sah ihn eine Weile an.
„Mann Norman. Ich war kurz vorm Herzschlag. Ich bin erst um zwei Uhr eingeschlafen und hätte noch eine oder zwei Minuten gebraucht um aufzustehen. Hab ich meinen Job bisher so schlecht gemacht, dass ich So was verdient habe?“
Norman schüttelte den Kopf.
„Nein Micha. Eben weil Du Deinen Job so gut machst schäme ich mich.“
Ich zögerte und kämpfte mit mir. Schließlich gewann die Überzeugung, dass es so wie heute zwischen uns nicht weitergehen konnte. Vielleicht sollte ich ihm glauben, dass er sich wirklich nichts Böses dabei gedacht hat.
„Okay akzeptiert“, sagte ich. „Ich war in letzter Zeit vielleicht auch manchmal ekelig und schwer zu ertragen. Du brauchst mich und ich brauche Dich. Also Lass es uns noch einmal versuchen.“
Er gab mir einen Kuss auf die Wange.
„Danke Micha.“
Jetzt war dieser Druck weg und wir taten so als wäre nichts passiert. Allerdings hinterließ die Sache bei mir eine kleine seelische Narbe.
In den nächsten Tagen kamen wir wieder einigermaßen gut miteinander aus. Norman war sogar sehr nett und versuchte mir die Freizeit mit einigen Kurzausflügen etwas erträglicher zu gestalten. Ich versuchte ihm klarzumachen, dass er sich wegen mir kein Bein ausreißen muss aber er meinte, dass es ihm selber auch Spaß machen würde. Ich trug natürlich auch meinen Teil zum allgemeinen Frieden bei. Ich bemühte mich nicht zu murren. Nicht beim frühen Aufstehen und nicht beim Sport nach einem anstrengenden Flug. Das fiel mir manchmal ziemlich schwer aber es ging. Zur Belohnung ließen wir es uns abends im Bett ziemlich gut gehen.
Kapitel 5
Wie üblich fuhren Norman und ich am letzten Donnerstag im Januar zu den van de Waals und kamen auf dem Rückweg kurz vor Sonnenuntergang wieder auf den Weg, der zum Camp führte. Die Sonne stand sehr tief, und alles was ihr im Weg stand, warf überlange Schatten. Ich schaute zur Seite und irgendwann machte mich etwas stutzig. Mir war nicht klar was es war aber wenn man über Monate bei jeder Fahrt immer wieder diesen Weg sah, kannte man jede Pflanze.
„Halt mal an Norman“, rief ich.
Norman bremste. „Was ist denn los?“
„Ich weiß nicht genau aber mir ist beim Vorbeifahren irgendetwas aufgefallen“, erklärte ich und bat ihn ein Stück zurückzufahren.
Norman gab sich geduldig und setzte ein Stück zurück. Erst dachte ich, ich hätte mich getäuscht aber dann sah ich es wieder. Es sah aus wie eine Bremsspur, die nach rechts vom Weg in den abschüssigen Hang führte. Er war keine deutliche Spur. Nur fehlten dort die kleinen Steine, die sonst überall den Weg leicht bedeckten und am Rand waren die dürren Halme geknickt oder abgerissen.
Ich zeigte es Norman und wir überlegten erst, ob das von Bedeutung war. Schließlich entschlossen wir uns auszusteigen und nachzusehen. Da wir auch leichte Spuren am Hang entdeckten, stiegen wir diesen nach. Etwa hundert Meter weiter entdeckten wir ein Auto, das gegen einen Baum geprallt war.
„Das ist Steves Wagen“, sagte Norman und lief voraus. Ich folgte ihm und als wir das Auto erreicht hatten, sahen wir Steve mit dem Oberkörper über dem Lenkrad hängen.
Norman riss die Fahrertür auf und versuchte Steve anzusprechen. Da dies erfolglos war, fasste er vorsichtig an Kopf und Schulter, um ihn gegen die Rückenlehne des Fahrersitzes zu ziehen. Das Gesicht war voller Blut. Mit einem Handgriff fühlte Norman den Puls und rief mir zu, den Verbandkasten aus seinem Rover zu holen. Ich rannte sofort los und kam mit der Kiste zurück. Ich half Norman die klaffende Wunde an der Stirn zu verbinden und roch dabei eine eklige Whiskyfahne.
Als die offene Wunde verbunden war, hob Norman den Verletzten aus dem Autowrack und trug ihn den Hang hinauf. Ich lief mit dem Verbandkasten voraus. Inzwischen war es schon dunkel. Norman legte Steve auf die Ladefläche, blieb bei ihm und wies mich an, vorsichtig zum Camp zu fahren. An der Wache sprang Norman ab und alarmierte den Sanitäter. Er sollte sofort zum Hangar kommen. Ich fuhr dann auch dorthin, wo wir Steve auf eine Decke legten.
Inzwischen war auch Sam zur Stelle und besorgte ein nasses Tuch, um Steve das angetrocknete Blut vom Gesicht zu wischen. Wenige Minuten später kam ein Rover mit dem Sanitäter.
Ich sah nur noch wie der eine Spritze aufzog und dann rief Norman, ich solle sofort eine Maschine startklar machen. Sam fasste mit an und schob mit mir die ‚Paula‘ aus dem Hangar. Dann fuhr er sofort los, um die Petroleumlampen an der Piste anzuzünden. Als Norman und der Sanitäter den verletzten Steve auf einer Trage in den Laderaum schoben, saß ich schon angeschnallt auf dem Pilotensitz.
Norman brauchte mir nichts zu sagen. Er saß noch nicht richtig im rechten Sitz, da hatte ich schon den Motor gestartet und begann zur Piste zu rollen.
„Lubumbashi?“ fragte ich und Norman nickte.
Woandershin hätte ich ohnehin nicht fliegen können, denn ich hatte noch nicht einmal eine Karte dabei.
Nach mehreren Versuchen bekam ich auf halber Strecke endlich Funkkontakt zum Tower in Lubumbashi. Ich erklärte, dass ich einen Verletzten an Bord hätte und nach der Landung einen Krankenwagen am Flugzeug brauchte. Irgendwann hatten sie es begriffen und bestätigt.
Gegen halb neun landeten wir auf dem gut beleuchteten Flughafen. Der Lotse wies mir eine Parkposition neben dem Flughafengebäude zu, wo der Krankenwagen bereits wartete.
Ein Arzt und zwei Sanitäter kümmerten sich um Steve. Norman fasste mich an der Schulter.
„Komm Micha Lass uns mal rein gehen und nachsehen, ob wir wenigstens einen Kaffee kriegen.“
Das Gebäude war wie ausgestorben. Norman steuerte in das Flughafenbüro und da trafen wir Kintu. Der schaute uns überrascht an.
„Was macht Ihr denn um diese Zeit hier?“ fragte er erstaunt.
Norman erklärte kurz den Verletztentransport und dann wandte sich Kintu an mich.
„Und fliegst immer noch für diese Yankees?“ wollte er wissen und lachte dabei.
„Ja, immer noch, “ antwortete ich.
„Gibt es hier irgendwo so was wie Kaffee oder Tee?“ fragte Norman.
Kintu nickte.
„Wartet einen Moment Jungs, ich besorge Euch was.“
Nachdem Kintu das Büro verlassen hatte, schaute Norman zu mir und sagte: „Tut mir leid, dass der Abend so anstrengend für Dich ist.“
Ich schenkte ihm ein Lächeln.
„Schon gut Norman. Es ist ja nicht Deine Schuld aber hast Du bemerkt, dass Steve furchtbar nach Whisky gerochen hat?“
Er nickte stumm.
Ich holte tief Luft.
„Ich weiß schon lange, dass er trinkt. Ich hab nur nichts gesagt weil er mich dann auch noch für einen Verräter halten würde.“
Jetzt schüttelte Norman den Kopf.
„Keine Sorge, das bist Du nicht. Ich weiß es und Sam weiß es. Wir können nichts dagegen machen. Zum Glück trinkt er immer nur nach dem Fliegen aber diesmal hat es ihn erwischt. Hoffentlich geht es noch mal gut.“
Nach diesem Satz kam Kintu zurück. Weiß der Himmel wo, aber er hatte zwei Becher Kaffee und ein Fladenbrot organisiert.
Dankbar machten wir uns darüber her und nachdem wir alles verputzt hatten, stand Norman auf.
„Komm Micha. Das wird eine kurze Nacht.“
„Ja Sir“, antwortete ich und folgte ihm.
„Guten Flug“, wünschte uns Kintu und schon waren wir wieder unterwegs.
Als wir ins Bett kamen, war es kurz vor Mitternacht. Mir war klar, dass ich nur vier Stunden Schlaf bekommen würde aber das war halt so.
Am nächsten Morgen musste ich auf dem Flug nach Cameia in Lubumbashi zwischenlanden. Da ich sehr müde war, fiel mir das erste Teilstück ziemlich schwer.
Norman telefonierte im Flughafengebäude und ich wartete eine halbe Stunde am Flugzeug. Dann ging es weiter. Unterwegs war Norman gedanklich beschäftigt und erst bei der Pause in Cameia sagte er mir, dass ich auf dem Rückweg wieder in Lubumbashi landen müsse, um die Sachen mitzunehmen, die für den Kurierflug bestimmt waren, den Steve normalerweise heute gemacht hätte.
Das bedeutete wieder einen langen Tag und ein ganzes Stück Nachtflug.
Warum muss immer alles auf einmal kommen, fragte ich mich aber ich musste verstehen, dass Norman das Beste aus der Situation zu machen versuchte.
Am Samstag war zum Glück nur die normale Cabora-Bassa-Tour auf dem Programm.
Am Nachmittag und am Sonntagmorgen war Norman jedoch in der Mine beschäftigt. Erst danach begann er mir möglichst schonend meinen neuen Flugplan beizubringen.
Ich war erst erschrocken und als ich begriffen hatte was das bedeutet, hätte ich heulen können. Nun lastete der gesamte Flugbetrieb auf mir allein und das war ziemlich schwer.
Um das Pensum von Steve mit zu erledigen, hatte Norman einen sechstägigen Wochenplan erstellt. Dieser sah von Montag bis Samstag abwechselnd Flüge nach Cameia und Cabora Bassa vor. Die Kurierflüge nach Lubumbashi wurden mit den Flügen nach Cameia zusammengelegt. Das bedeutete je eine Zwischenlandung auf dem Hin- und Rückflug in Lubumbashi. Um das zu schaffen, mussten wir bereits vor Sonnenaufgang starten und kamen erst nach Sonnenuntergang in Kabunda an. Die Erledigungen in Lubumbashi übernahm montags und freitags ein örtlicher Mitarbeiter. Mittwochs erledigte es Norman, um wenigstens anschließend einen kurzen Besuch bei Jason machen zu können. Für den Weiterflug von Lubumbashi nach Cameia und zurück teilte mir Norman an den Tagen diesen örtlichen Mitarbeiter als Begleiter zu.
Er hieß Bruce, war etwas älter als Norman und redete wie ein Wasserfall. Es brachen also harte Tage für mich an.
Der Mittwoch der zweiten Woche war ein solcher Tag. 5.43 Uhr Start in Kabunda, 7.30 Uhr Ankunft in Lubumbashi. Norman steigt aus, ich bitte ihn, seinen Bruder Jason zu grüßen und mein Ersatzbegleiter Bruce steigt ein. 7.50 Uhr Start in Lubumbashi, 12.05 Uhr Landung in Cameia. Ich bitte die Männer, sich beim Betanken zu beeilen, wechsle mein triefnasses Hemd, schlinge eine Portion Hühnerfleisch mit Maniok herunter, spüle mit einem Becher lauwarmem Tee nach, sammele Bruce ein, prüfe den Ölstand und starte um 12.52 Uhr. Um 17.40 Uhr Landung in Lubumbashi. Norman wartet schon ungeduldig und fragt, wo ich denn bliebe, er habe sich schon Sorgen gemacht. Von den Gewittern, die mich ab Mwinilungwa auf einer Strecke von 150 Kilometern fast zur Verzweiflung gebracht hatten, weiß er nichts. Während des Auftankens, verabschiedet sich Bruce. Norman lädt die Versorgungsgüter ein. Ich bekomme neben dem Flugzeug einen Becher Kaffee und ein Stück Fladenbrot. Bevor ich mich diesen ‚Köstlichkeiten‘ widme, schäle ich mich bis zur Gürtellinie aus meinem Overall und wechsele zum zweiten Mal mein Hemd. Ich genieße die trockene Baumwolle auf meiner Haut und weiß, dass es nur kurz anhalten wird. Spätestens in einer halben Stunde wird auch das dritte Hemd auf meinem Rücken kleben. Um 18.22 Uhr Start in Lubumbashi. Der Sonnenuntergang vollzieht sich kurz nach dem Start hinter unserem Rücken. Nachtflug mit Stoppuhr und Radiokompass ist angesagt. Wir reden nur wenig. Norman weiß wie anstrengend Nachtflug für mich ist. Um 20.13 Uhr erreiche ich den Luapula. An der markanten Biegung habe ich einen exakten Kurs von 185 Grad anliegen und drücke die Stoppuhr. Nach 30 Sekunden bei 90 Knoten Geschwindigkeit fliege ich eine Linkskurve mit 15 Grad Schräglage. Noch 30 Sekunden, dann müssen die zehn Petroleumlampen links und rechts der Piste auftauchen. Und da sind sie. Wie eine Formation von Glühwürmchen in dunkler Nacht. Um 20.20 Uhr klettern wir aus dem Flugzeug. In meinem Kopf brummt das Motorengeräusch nach. Norman hat Sam einen jungen Schwarzen als Helfer zugeteilt. Das Ausladen und Einräumen der Maschine bleibt mir erspart. In der Unterkunft schäle ich mich aus den dampfenden Klamotten und befördere sie mit dem Fuß neben den Wäschekorb. Für einen Augenblick genieße ich die Kühle auf meiner Haut, bevor ich in den Trainingsanzug und die Turnschuhe schlüpfe. Wenn ich mich jetzt hinsetze, komme ich nicht mehr hoch. Da ich das weiß, tue ich es nicht und trabe stattdessen brav neben Norman zum Kraftraum. Immerhin hat er mit Rücksicht auf mein geschwächtes Nervenkostüm das Trainingsprogramm auf eine halbe Stunde zusammengestrichen und speziell auf die Lockerung meiner verspannten Rücken- und Nackenmuskulatur abgestimmt. Zum Abschluss liege ich mit dem Bauch auf einer Bank und biete meinen Rücken seinen kräftigen Händen als Knetmasse dar. Ich wehre mich nicht, denn ich spüre, dass es irgendwie gut tut. Die Stellen wo es weh tut, fühle ich kaum, denn ich habe die Augen geschlossen und befinde mich in einer Art Dämmerzustand, aus dem ich zurückkehre, sobald Norman seine Massage mit einem Klaps auf meinen Po beendet. Fünf Minuten später stehe ich unter der Dusche und genieße das lauwarme Wasser am ganzen Körper. Norman seift mich ein und trocknet mich nach dem Abspülen ab. Anschließend tue ich das gleiche bei ihm. Erfrischt aber trotzdem erschöpft, gehen wir in die Kantine. Norman drängt mich viel zu essen und zu trinken. Um 22.00 Uhr liegen wir im Bett. Sieben Stunden Schlaf liegen vor mir. Davon opfere ich 15 Minuten und schmuse mit demjenigen, der mir spätestens um fünf Uhr gnadenlos die Bettdecke wegzieht. Ich brauche diese Nähe und Zärtlichkeit. Ohne sie schaffe ich das alles nicht in diesem zeitweise ganz normalen Wahnsinn.
Zum Ende der zweiten Woche war ich ziemlich am Ende meiner Kräfte. Am Sonntag, dem einzigen freien Tag schlief ich bis Mittag. Ich war nervös und launisch. Norman nahm es mit seiner stoischen Gelassenheit und ließ mich gewähren. Wir hätten uns streiten und so richtig fetzen können, um unseren Frust raus zu lassen aber das tat er nicht. Stattdessen behandelte er mich wie ein rohes Ei.
Ich hatte den Eindruck, dass er auch unter dem Druck litt aber es nicht zeigen wollte. Nach einem gemeinsamen Brunch schlug er mir vor Schwimmen zu gehen aber ich wollte nicht. Ich fragte ihn, ob er etwas dagegen hätte, wenn ich am Nachmittag auf die Abraumhalde steigen würde, um eine Weile allein zu sein.
„Mach das wenn Du willst, “ antwortete er wie erleichtert. „Ich lege mich hinter die Hütte und lese.“
Ich nahm mir eine Flasche Wasser mit und zog los. Bevor ich mich dort oben auf dem Baumstamm niederließ, betrachtete ich eine Weile die Landschaft. Ich war traurig und wünschte mir Steve zurück. Obwohl ich ihn fürchtete und ihm aus dem Weg ging, war es ohne ihn alles andere als besser. Ich bekam schon Bauchweh, wenn ich nur an die kommende Woche dachte. Mir war auch klar, dass ich das nicht mehr lange durchstehen würde. Ich hatte mich nicht beklagt, um Norman nicht zu enttäuschen oder zu verärgern. Dazu liebte und respektierte ich ihn viel zu sehr.
Eigentlich wäre ich jetzt gern mit ihm zusammen, unbeschwert und glücklich aber da stand der Widerspruch. Norman, der Freund den ich liebte und Norman, mein Boss der mehr von mir verlangte, als ich verkraften konnte. Norman akzeptierte kein `Nein` und das machte er mir vor aber ich hatte eine Verantwortung. Ich musste die Maschine sicher über die Strecke bringen. Nicht nur mein, sondern auch sein Leben hing davon ab. Ob er das wusste? Und wenn ja, dann hatte er ein sehr großes Vertrauen zu mir. Ich musste ihm also rechtzeitig sagen, dass ich mit meinen Kräften am Ende war.
Ich fragte mich ernsthaft, warum ich das alles tat. Was wäre wohl, wenn ich es nicht tun würde?
Später, kurz vor Sonnenuntergang hörte ich Norman den Hang hinaufklettern. „Störe ich?“
Ich schüttelte mit dem Kopf.
Er hatte den Korb dabei.
„Ich dachte Du würdest lieber hier oben essen.“
Das war der andere Norman und ich wusste wieder warum ich bisher noch nicht gestreikt hatte. Er war so lieb, dass ich auch an diesem Abend nicht über mein Problem sprach, sondern es einfach vergaß.
Erst am darauf folgenden Mittwoch beim Abendessen musste ich es loswerden und begann ganz vorsichtig.
„Du Norman?“
„Ja?
„Du hast doch mal gesagt, wir sind ein unschlagbares Team.“
Er schaute mich an.
„Das sind wir doch auch.“
Ich verzog etwas mein Gesicht.
„Na ja, ich weiß, Du hängst in letzter Zeit genauso drin wie ich aber Du bist stärker als ich und ich schaffe das nicht mehr.“
Er rückte etwas näher an den Tisch und griff meine Hand neben dem Teller. „Ich weiß was Du in den letzten Wochen geleistet hast. Ich bin nur dabei aber Du hast die ganze Arbeit gemacht. Du bist viel stärker als ich vermutet habe.“ Er machte eine Pause aber sein Blick sagte mir, dass er noch nicht fertig war. „Ich wollte Dir heute Abend auch etwas sagen. Am Samstag wird Steve aus der Klinik entlassen und er will ab Montag wieder fliegen.“
Mir fiel ein Stein vom Herzen und atmete auf.
„Dann wird es wieder wie vorher?“
Norman schmunzelte und schüttelte dabei den Kopf.
„Steve fliegt in der nächsten Woche den Plan, den Du bis jetzt geflogen bist und wir fahren am Sonntag für eine Woche auf die Farm zu den van de Waals. Weg von Kabunda und machen So was wie Urlaub.“
Ich bekam ganz große Augen.
„Ist das Dein Ernst?“
Norman lehnte sich wieder zurück.
„Natürlich nur wenn Du willst.“
Mir entfuhr in diesem Moment ein so gewaltiger Freudenschrei, dass Kitty ihren massigen Körper blitzartig aus der Durchreiche streckte, um nachzusehen, ob ich noch am Leben war.
Auf dem Weg zu unserer Unterkunft hatte er seinen Arm auf meine Schulter gelegt.
„Meinst Du, Du schaffst es noch bis Samstag?“
„Ja Sir“, antwortete ich.
Norman lachte.
„Ich bin übrigens auch froh, dass der Stress bald vorbei ist.“
„Hat Jason dann zufällig Ferien?“
„Du willst ihn wohl gerne dabei haben.“
„Ja, Du nicht?“
Norman nickte.
„Doch. Aber Jason hat leider keine Ferien. Du musst also mit mir allein Vorlieb nehmen.“
„Woher weißt Du denn ob die van de Waals nichts Besseres vorhaben, als uns eine Woche in Urlaub zu nehmen?“ fragte ich.
„Weil ich sie heute von Lubumbashi aus über Kurzwelle angefunkt habe“, antwortete Norman mit einem verschmitzten Lächeln.
Nach den Strapazen der letzten Tage freute ich mich so sehr auf die Woche Urlaub, dass die beiden nächsten Tage sehr schnell vergingen. Zum Abschluss meines dreiwöchigen Wahnsinnsflugplans erfolgte etwas ganz neues. Ein Direktflug von Cabora-Bassa nach Lubumbashi. Nicht dass der Flug sonderlich lang gewesen wäre. Er war mit dreieinhalb Stunden nur unwesentlich länger als nach Kabunda aber er führte über Gelände, welches ich vorher noch nicht gesehen hatte.
So hatte ich von der Südspitze Zaires einen Kurs, der in etwa der Eisenbahn folgte. Auf diese Weise überflog ich all die Städte mit ihren Fördertürmen und hässlichen Abraumhalden diesseits und jenseits der Grenze zwischen Sambia und Zaire. Der Gegensatz zwischen weiter Natur und industriell geprägter Zivilisation konnte kaum größer sein und erschreckte mich geradezu.
Am frühen Nachmittag landeten wir in Lubumbashi. Von Steve war noch nichts zu sehen. Norman und ich gingen ins Flughafengebäude. Diesmal war richtiges Leben in der Abflughalle. Kein Wunder. Auf dem Vorfeld stand schließlich eine DC 8, die um 15 Uhr nach Kinshasa abfliegen sollte.
Kintu war heute nicht im Dienst aber Norman kannte auch andere Flughafenleute bei denen er telefonieren und einen Kaffee organisieren konnte.
Wir mussten fast eineinhalb Stunden warten, bis Bruce ankam und Steve mitbrachte. Die Begrüßung war eher beiläufig. Mit Norman wechselte Steve wenigstens ein paar Worte. Ich bekam lediglich mit, dass er sich wieder gut fühlte. Außer der noch nicht ganz verheilten Wunde an der Stirn, sah er auch unverändert aus.
Mich würdigte er nur eines flüchtigen Blickes aber mehr wäre mir wohl auch eher peinlich gewesen. Ich hatte vorher überlegt ihn zu fragen, ob er nach Kabunda fliegen wolle aber jetzt war ich zu stolz dazu.
Er stieg sogar freiwillig hinten ein und das war mir mehr als recht. Unterwegs hörte ich in meinem Kopfhörer mit, was Norman und Steve miteinander sprachen. Es ging um den Unfall und den Krankenhausaufenthalt. Ich sagte nichts dazu und hoffte bald in Kabunda zu sein.
Nach der Landung schob ich mit Sam den Flieger in den Hangar. Norman zeigte Steve einen älteren Jeep, den er ihm von der Firma besorgt hatte. Als ich aus dem Hangar kam, um zu sehen wie weit Norman war, kam Steve auf mich zu. Etwas nervös und verkrampft sagte er:
„Danke für die Hilfe nach dem Unfall und die Vertretung.“
Ich hatte jetzt nicht mehr damit gerechnet und bevor er sich umdrehen und weggehen konnte, sagte ich:
„Schon gut Steve. Ich bin nicht Dein Freund aber Du bist auch nicht mein Feind.“
Mit meinen Worten hatte ich seinen Abgang höchstens fünf Sekunden verzögert und ich hatte keine Ahnung, ob sich das Verhältnis zwischen uns auch nur eine Spur verbessern könnte.
In der Unterkunft angekommen, fühlte ich mich wie von einer Last befreit. Der Spuk der letzten Wochen war jetzt vorüber und eine ganze freie Woche außerhalb des Camps stand uns bevor. Noch am Abend begann ich die Sachen zusammenzusuchen, die ich zum Anziehen brauchen würde.
Ich zog gerade das Band an meinem Rucksack zu, als Norman in mein Zimmer kam.
„Na mein kleiner Prinz. Freust Du dich?“
Ich hatte nur eine Shorts an, setzte mich auf mein Bett, ließ meinen Oberkörper nach hinten fallen und streckte meine Arme über den Kopf.
„Klar freue ich mich.“
Norman schaute mich an und lächelte verschmitzt.
„Wenn ich Dich so liegen sehe, möchte ich Dich auf der Stelle vernaschen.“
Sein Anblick und seine Ankündigung reichten aus, dass ich einen richtigen Ständer bekam.
„Du siehst schon ganz blass aus“, fand ich.
„Ganz blass? Wie kommst Du denn darauf?“ fragte er verdutzt.
„Na ja, typischer Fall von Calziummangel.“
„Na warte“, meinte er lachend und bevor ich mich in Sicherheit bringen konnte, stürzte er sich auf mich, hielt mit einer Hand meine Arme fest und begann mich mit der anderen Hand zu kitzeln. Ich wand mich aber ich hatte keine Chance ihm zu entkommen. Da Norman meine empfindlichsten Stellen kannte, lachte und prustete ich bis ich mich keuchend ergab. Widerstandslos ließ ich mich nun von meiner Shorts befreien und meinen Körper von seinen Lippen erforschen. Das brachte mich so richtig in Wallung.
Als er anfing, sich um mein bestes Stück zu kümmern, maulte ich:
„Bitte Norman sei nicht unfair. Ich hab doch auch Calziummangel.“
Er lachte kurz.
„Oh, tut mir leid. Hab gar nicht bemerkt, dass Du auch ganz blass bist.“
Mit einem Griff streifte er seine Shorts vom Körper und hockte sich in der so genannten 69er Stellung über mich.
Hmm, jetzt hatte ich auch was und begann zuerst seine kugeligen Eier zu lutschen, bevor ich die ersten Lusttropfen von seiner prallen Eichel schleckte.
Norman hatte es gut drauf, mich immer wieder kurz vor den Höhepunkt zu bringen und sich dann wieder mit meinen Oberschenkeln oder Eiern zu beschäftigen. Mein bestes Gegenmittel bestand darin, es bei ihm auch so zu machen. So war es immer ein Wettstreit, wer es am längsten aushielt und er merkte bald, dass er seinen Höhepunkt erst bekam, wenn er mir meinen verschaffte oder umgekehrt. Irgendwann hatte ich ihn soweit, dass er meinen Schwanz stramm zwischen die Lippen nahm und mit seinem rhythmische Fickbewegungen in meinem Mund begann. Ich spürte, dass ich es nicht mehr zurückhalten konnte und ließ seine Eichel wild über meine Zunge streichen. Jetzt zuckte es in meinem Mund und als sich mein Becken leicht aufbäumte, schossen mir die ersten Schübe seines köstlichen heißen Lustsaftes gegen den Rachen.
Wir ließen keinen Tropfen entkommen und nachdem wir unsere besten Stücke leer gesaugt hatten, lagen wir keuchend und zufrieden nebeneinander.
Ich zog seinen Kopf etwas näher und gab ihm einen Kuss. Norman revanchierte sich und sagte:
„Das ist doch ein guter Anfang für unseren Urlaub.“
Ich konnte ihm damit nur recht geben.
Am Tag unserer Abreise ließ mich Norman einmal richtig ausschlafen. Er meinte, das hätte ich mir verdient und es sei ja früh genug, wenn wir nach einem Brunch am Mittag losfahren würden.
Da musste ich ihm ja mal wieder so recht geben und so fuhren wir in ausgelassener Stimmung aus dem Camp.
Bei den van de Waals wurden wir mit Kaffee und Kuchen begrüßt und anschließend bezogen wir das Gästezimmer. Zum Glück schien sich die Gastgeberin nichts dabei zu denken, dass Norman das ihm angebotene Zimmer von Philippe zugunsten des Gästezimmers für uns beide ablehnte.
Nachdem wir unsere Sachen verstaut hatten, unterhielt sich Norman mit Herrn van de Waal und ich ging zu den Ställen hinüber, um mir das Fohlen anzuschauen. Nach ein paar Schritten merkte ich, dass mir Claire, der schwarze Riesenschnauzer folgte. Ich kannte ihn ja inzwischen aber bisher hatte er nie besondere Notiz von mir genommen. Diesmal war ich wohl der einzige, mit dem er etwas anfangen konnte und so stupste er mit dem Kopf an meine Beine. Ich hob ein kleines Aststück auf und warf es ein Stück. Claire spurtete sofort los und brachte es zurück.
Auf diese Weise kamen wir bei den Ställen an.
Da ich nicht wusste, ob sich der Hund mit den Pferden vertrug, sagte ich ihm, dass er draußen warten solle und ging hinein. In einer der Boxen entdeckte ich das Fohlen. Es war in der Zwischenzeit schon erstaunlich gewachsen und schaute mich neugierig an.
Der schwarze Stalljunge verteilte gerade frisches Stroh in den Boxen. Er kannte mich noch aber wir konnten uns nicht verständigen. Ich schätzte ihn auf vierzehn oder fünfzehn Jahre. Er hatte pechschwarze krause Haare und ein Lächeln im Gesicht, wobei seine weißen Zähne blitzten.
Als ich das Fohlen streichelte, reichte er mir eine Möhre und deutete in die Box. Ich bedankte mich und fütterte das Fohlen damit.
Als ich den Stall verließ, erwartete mich Claire vor der Tür und leckte meine Hand. So ermuntert schlenderte ich wieder zum Haus zurück und beschäftigte den Hund mit dem Aststück.
In den nächsten Tagen war ich nicht immer mit Norman zusammen. Manchmal fuhr er mit Herrn van de Waal raus oder er las auf der Veranda ein Buch. Ich beschäftigte mich dann oft mit Claire und erkundete die Umgebung des Farmhauses.
Es war richtig erholsam, mal auszuschlafen, zu faulenzen und einfach nur das zu tun, wozu ich Lust hatte.
Am vorletzten Tag unseres Urlaubs war ich wieder einmal allein unterwegs und kam auf der westlichen Seite zum Farmhaus zurück. Auf dieser Seite der Veranda stand als Sonnenschutz eine Wand aus geflochtenem Stroh. Bevor ich die Veranda erreichte, schaute ich durch eine Ritze und sah Norman und Frau van de Waal am Tisch sitzen und sich unterhalten. Während ich überlegte, ob ich einfach stören sollte, hörte ich ihr Gespräch mit.
Es ging offensichtlich um Jason und Norman und ihre Abreise nach Amerika.
„Wann ist es denn soweit?“ wollte Frau van de Waal wissen.
„Am 16. Mai fliegen wir. Dann haben wir noch Zeit, um uns ein bisschen einzugewöhnen, bevor das Semester beginnt, “ antwortete Norman.
Was ich da hörte, versetzte mir einen Stich. Nach den unbeschwerten Tagen holte mich die Realität wieder ein. Ich schlich mich ein Stück vom Haus weg und setzte mich unter eine Baumgruppe.
Warum hatte mir Norman nichts gesagt, wenn er den genauen Tag ihrer Abreise schon kennt?
dass er mit Jason nach Amerika gehen würde war mir schon bewusst aber er hatte damals von Juli oder August gesprochen. Jetzt musste ich es auf diese Weise erfahren und das tat mir ziemlich weh. Ich wartete doch auch so sehnlich auf eine Information, wann ich nach Deutschland zurückkehren konnte.
Sollte es wieder eine der üblichen Überraschungen werden oder war Norman noch nicht klar wann ICH abreisen konnte?
Mit einem Seufzer beschloss ich nicht zu verraten, dass ich das Gespräch belauscht hatte und insgeheim hegte ich die Hoffnung, dass sich für mich bis dahin auch eine Lösung ergab.
An unserem letzten Abend saßen wir noch lange mit den van de Waals zusammen. Sie waren richtig nette Leute. Ich hatte immer das Gefühl, dass ich genauso willkommen war, wie Norman oder Jason.
Am Sonntag verabschiedeten wir uns nach dem Mittagessen, bedankten uns für die Gastfreundschaft und machten uns auf den Weg zurück zum Camp.
Ich fühlte mich ganz gut erholt, bevor der normale Alltag wieder begann. Meine leise Hoffnung, dass Norman mit mir über seine Pläne sprechen würde, erfüllte sich nicht.
Im März gab es noch einmal eine kurze Schlechtwetterperiode aber sonst lief alles wie normal.
Einmal wagte ich einen Vorstoß und fragte Norman wie lange ich noch bleiben müsse. Er wich mir aber aus und vertröstete mich noch eine Weile. Das machte mich ziemlich traurig, zumal ich immer noch keine Idee für eine Flucht hatte. Um ehrlich zu sein, war mir die Sache mit der Flucht in letzter Zeit auch nicht mehr so ernst gewesen, weil ich trotz allem darauf vertraut hatte, dass im Frühjahr endlich ein neuer Pilot kommen würde. Außerdem wollte ich nicht gerne auf mein sauer verdientes Geld verzichten müssen.
Als sich bis Mitte April noch nichts getan hatte, machte ich bei Norman einen weiteren und diesmal etwas intensiveren Vorstoß. Diesmal reagierte er ziemlich genervt und gab mir wieder keine verbindliche Antwort.
Jetzt kam bei mir langsam Panik auf. Ich wusste, dass er in vier Wochen mit Jason nach Amerika fliegen würde und ich? Was würde mit mir geschehen? Hielt er seinen Abreisetermin geheim, um mich allein hier zurückzulassen? Bei dem Gedanken wurde mir speiübel. Es fiel mir schwer ihm das zuzutrauen aber wenn sein Vater dahinter steckte?
Der Gedanke, dass mir ein anderer Bewacher zugeteilt würde und ich weiter auf unbestimmte Zeit hier bleiben müsste, war für mich unerträglich und ließ mich fast verzweifeln.
Als mir in einer stillen Stunde diese Gedanken durch den Kopf gingen, habe ich meinen kleinen Teddy in die Hand genommen und aus Wut und Verzweiflung ganz bitterlich geweint.
Von Norman war ich so enttäuscht, dass ich es nicht mehr wagte, ihn auf meine Situation anzusprechen. Eine weitere Zurückweisung hätte ich kaum ertragen können.
Dass ich seinen Abreisetermin kannte, verschwieg ich nach wie vor.
Am nächsten Mittwoch war ich wieder bei Sam im Hangar. Ich machte mir auch Sorgen um ihn. Er hatte ziemlich stark abgenommen und man konnte nicht übersehen, dass ihm jeder Handgriff schwer fiel und Schmerzen verursachte.
Das war mir aber schon in den Wochen zuvor aufgefallen. Deshalb hatte ich auch einen Plan. So schwer es mir auch fiel aber ich war fest entschlossen in spätestens zwei Wochen mittwochs, wenn Norman in Lubumbashi war, zur Not auch gegen den Willen von Sam ein Flugzeug nehmen und abzuhauen.
Ich hatte auch schon über Einzelheiten nachgedacht und weil ich keine Karten hatte, wollte ich entlang der im Bau befindlichen Eisenbahnlinie nach Dares Alam, der Hauptstadt von Tansania fliegen, um dort zur deutschen Botschaft zu kommen.
Ich war mir allerdings nicht sicher, ob der Sprit bis dahin reichen würde.
Ich half Sam und nahm ihm die eine oder andere Arbeit ab. In meinen Gedanken war ich aber ganz woanders. Beim Malzkaffee in Sams Magazin fragte er mich, was mit mir los sei.
„Was fragst Du mich? Du sagst mir ja auch nicht was mit Dir los ist und das ist ja schon lange nicht zu übersehen, oder?“
Sam nahm meine Hand. Seine zitterte leicht.
„Weißt Du, ich bin ein alter Mann und langsam lassen meine Kräfte nach.“
Ich schaute ihm ins Gesicht.
„Sam, das sind doch nicht nur die Kräfte. Du hast stark abgenommen und Schmerzen hast Du auch. Warst Du wenigstens mal bei einem Arzt?“
Sam nahm einen Schluck aus seinem Becher als wolle er sich Mut antrinken. Dann schüttelte er leicht mit dem Kopf.
„Mir kann kein Arzt mehr helfen. Es ist Krebs.“
Als ich begriff was er gesagt hatte, musste ich schlucken. Krebs im fortgeschrittenen Stadium, dachte ich mir und das tat mir unendlich leid. Er war immer da und hatte auch in den letzten Wochen nie geklagt. Wenn ich ihn heute nicht so nachdrücklich gefragt hätte, wüsste ich noch immer nicht, dass es tatsächlich so schlecht um ihn stand.
Nach einer Weile des Schweigens nahm er wieder meine Hand.
„Jetzt habe ich Dir geantwortet und jetzt will ich eine Antwort von Dir. Was ist los?“
Ich holte tief Luft.
„Versprichst Du mir, dass Du mich nicht verrätst?“
Er drückte meine Hand.
„Na los mein Junge. Wir sind hier unter uns und ich verrate gar nichts.“
„Okay“, fing ich vorsichtig an. „Ich bin ziemlich verzweifelt. In vier Wochen geht Norman mit seinem Bruder nach Amerika und ich habe wahnsinnige Angst, dass ich hier bleiben muss. Er sagt mir nicht ob und wann ich nach Hause kann. Ich glaube sein Vater will mich nicht weg lassen und deshalb will ich vorher abhauen.“
Ich war mir nicht sicher ob es so gut war, dass ich mich offenbart hatte und wartete Sams Reaktion ab.
Es dauerte eine Weile bis er reagierte.
„Du meinst mit dem Flugzeug?“
Ich nickte.
„Ja. Das ist doch meine einzige Chance, oder?“
„Ich denke da hast Du recht“, meinte er. „Weißt Du schon wohin?“
Ich war schon froh, dass Sam keine Anstalten machte, mich von meinem Plan abzubringen.
„Ich bin mir noch nicht sicher. Normans Vater hat meine Papiere. Ich muss also dahin wo es eine deutsche Botschaft gibt. Ob es in Lusaka eine gibt weiß ich nicht aber in Dares Alam gibt es ganz bestimmt eine. Ich weiß aber nicht wie weit das ist und ob ich mit einer Tankfüllung so weit kommen kann, “ sprudelte es nun aus mir heraus.
Sam erhob sich mühsam und kramte in einer Schublade. Kurz darauf legte er eine alte zerfledderte Landkarte vor mir auf den Tisch und setzte sich wieder.
„In Nairobi in Kenia gibt es auch eine.“
Ich schaute zuerst auf die Karte und dann zu Sam.
„Kenia? Wie kommst Du auf Kenia?“ wollte ich wissen.
„Schau Dir die Karte an“, sagte er ruhig. „Eine andere habe ich nicht.“
Ich faltete sie vorsichtig auseinander. Es war eine sehr alte Karte und sie zeigte Kenia, Tansania und den nördlichen Teil von Sambia.
Ich war so überrascht von der Karte, dass ich ihn nur fragend anschaute. Ich wusste von seinen Erzählungen, dass er einen ganzen Teil seines Lebens in Kenia verbracht hatte und deshalb besaß er wohl diese Karte.
Sam hatte begonnen, sich eine Pfeife zu stopfen. Ich hatte mir im Laufe der Zeit angewöhnt, ihn dabei nicht zu stören, denn es war wie eine Zeremonie, die sehr viel Ruhe und Gelassenheit ausstrahlte.
Als er die ersten Rauchwolken in die Luft blies, beendete er das Schweigen.
„Ich habe meine Frau vor fast zwanzig Jahren in Kenia begraben und ich wünsche mir auch dort begraben zu werden.“
Er machte eine kurze Pause.
„Für mich ist es bald soweit. Wenn Du dich also entschließen würdest nach Kenia zu fliegen, kannst Du mich mitnehmen sonst schaffe ich die Reise nicht mehr.“
Was ich da hörte, musste ich erst einmal verdauen. Sam fühlte sich dem Tode nahe und ich wollte zurück in ein freies Leben. Was wir gemeinsam hatten, war der Wunsch nach Heimat.
Ich holte tief Luft.
„Ja Sam. Kenia. Das ist gut. Lass uns nach Kenia fliegen.“
Bei dem Gedanken, dass meine Fluchtpläne nun eine Chance bekamen, wurde ich ganz kribbelig. Ich schaute auf die Uhr. Es blieben uns noch zwei Stunden bis Steve und Norman aus Lubumbashi zurückkommen würden.
Sam gab mir ein Lineal und ich begann eine Flugroute auf die Karte zu zeichnen, nachdem er mir das Ziel, eine Farm etwa auf halber Strecke zwischen Nairobi und Mombasa, gezeigt hatte. Die Route ging nach Nordosten und als ich mit dem Maßstab die Entfernung ausrechnete, erschrak ich und rechnete noch einmal nach. Es blieb dabei. Die kürzeste Entfernung betrug 1.500 Kilometer und würde einer Flugzeit von achteinhalb Flugstunden entsprechen, wenn kein Wind die Fluggeschwindigkeit beeinflussen würde.
Enttäuscht legte ich das Lineal zur Seite.
„Das ist zu weit. Das schaffen wir nicht ohne unterwegs aufzutanken.“
Sam kratzte seinen Bart.
„Wie viel Sprit fehlt uns denn?“ wollte er wissen.
Ich rechnete noch einmal alles durch.
„Achtzig Liter und vierzig als eiserne Reserve“, war mein Ergebnis.
Wir waren uns einig, dass eine Zwischenlandung kaum in Frage kam. Einerseits konnte man nicht wissen, ob es auf einer kleinen Landepiste in Tansania überhaupt Sprit gab und andererseits war es mir zu riskant ohne Papiere zu landen, bevor wir am Ziel, nämlich in Kenia waren.
Nach einem weiteren Becher Malzkaffee hatte Sam eine Idee.
„Wir brauchen Zusatztanks“, meinte er gelassen.
„Ja, aber wie soll das gehen?“ fragte ich.
Sam grübelte.
„Stell Dir vor, wir befestigen sechs Kanister mit je 20 Litern Sprit im Laderaum. Dann brauchen wir nur eine Handpumpe und einen Schlauch und ein Absperrventil.“
Ich verstand immer noch nicht was er meinte.
Sam erklärte mir, dass er an einem der Flächentanks ein Anschlussstück für den Schlauch installieren würde. Von dort würde er den Schlauch durch die Tragflächenwurzel in den Laderaum führen. Das Absperrventil würde verhindern, dass Sprit aus dem noch vollen Tank durch den Schlauch abfließen würde. Wenn der Tank jedoch fast leer sei, könne man das Ventil öffnen und mit der Handpumpe am anderen Ende des Schlauches einen Kanister nach dem anderen in den Tank umfüllen.
Seine Idee klang abenteuerlich aber ich vertraute Sam. Wenn einer etwas von Flugzeugen verstand, dann war er es. Außerdem hatte ich ja selbst schon gelernt, dass man in der Not improvisieren konnte und musste.
Wir einigten uns darauf, dass er in der kommenden Woche alle notwendigen Teile vorbereiten würde. Am nächsten Mittwoch würde er bei der ‚Anny‘ eine ‚Generalinspektion‘ beginnen, die ohnehin bald fällig war. Somit würde es nicht auffallen, wenn sie bei der Gelegenheit auf „Langstrecke“ umgerüstet werden würde. Wenn alles klappte, wollten wir am übernächsten Mittwoch nach Kenia aufbrechen.
Bei dem Gedanken war ich schon ziemlich aufgeregt aber ich musste mich bis dahin zusammenreißen und durfte mir bei Norman nicht das Geringste anmerken lassen.
Als sich Steve von seinem Kurierflug aus Lubumbashi ankündigte, gingen wir in den Hangar. Ich rieb mir Altöl an die Finger, damit es so aussah, als hätte ich die ganze Zeit bei der Arbeit geholfen.
Wenig später traf ich Norman vor dem Hangar.
„Hallo Micha. Was habt ihr denn den ganzen Tag gemacht?“ fragte er gut gelaunt.
„Ölwechsel“, sagte ich, hob meine Hände und hielt ihm meine Handflächen vor das Gesicht.
Norman zog seine Augenbrauen herunter.
„Wenn Du mich damit anfasst, lege ich Dich auf der Stelle übers Knie.“
Eilig nahm ich meine Hände wieder runter und grinste.
„Dann doch lieber nicht.“
Ich half ihm die mitgebrachten Sachen in den Rover zu laden, die er anschließend zur Mine brachte.
Später in der Unterkunft zeigte er mir ein Buch, das ihm Jason für mich mitgegeben hatte aber er gab es mir erst, nachdem er sich davon überzeugt hatte, dass meine Hände zwischenzeitlich geschrubbt waren.
„Sollen wir heute unser Training im Luapula machen?“ fragte Norman.
„Oh ja, prima, “ stimmte ich zu. Mir war heute nach Schwimmen und zwischenzeitlich hatten wir eine andere Badestelle gefunden. Dort war es zwar etwas steiniger am Ufer aber schöner als an dem verbrannten Hang.
Eine halbe Stunde später waren wir im Wasser. Ich liebte es mit Norman im Fluss herumzutoben. Es war so erfrischend und erregend.
Ich war zu einer tieferen Stelle geschwommen und wartete, dass mich Norman einholen konnte. Kurz vorher wollte ich schnell in die andere Richtung schwimmen und tauchte mit dem ganzen Körper kurz nach unten, um etwas Schwung zu holen. Bei dieser Aktion stieß ich mit meinem linken Fuß gegen einen Stein unter Wasser. Es tat kurz weh aber ich achtete nicht darauf. Norman verfolgte mich und rief plötzlich:
„Hey Micha das Wasser ist ja ganz rot!“
Ich hielt an, obwohl ich es für einen seiner Tricks gehalten habe. Doch dann sah ich es selber.
Norman half mir an einer flachen Stelle ans Ufer. An der Innenseite meines linken Fußes klaffte eine Wunde, die stark blutete. Jetzt an der Luft spürte ich auch einen leicht brennenden Schmerz. Norman hielt die Wunde mit den Händen zu und schaute sich um.
„Du musst es einen Moment selber zuhalten. Ich hole schnell den Verbandkasten aus dem Wagen, “ sagte er aufgeregt und lief nackt und nass in Richtung Rover. Ich hielt den Fuß mit beiden Händen und begriff erst langsam was passiert war, als Norman ein Tuch fest um die Wunde wickelte und einen Verband anlegte.
Durch den Druck, der die Blutung stoppte, tat der Fuß ziemlich weh. Norman holte unsere Sachen, half mir meine Shorts anzuziehen und trug mich zum Rover. Er selbst, auch nur mit einer Shorts bekleidet lief noch mal zurück um die restlichen Sachen und den Verbandkasten zu holen und dann brauste er in Richtung Camp. An der Wache hielt er an und telefonierte nach dem Sanitäter, der in unsere Unterkunft kommen sollte.
Ich wollte dort selbst aussteigen aber das Auftreten tat so weh, dass mich Norman hinein trug und auf sein Bett legte.
Ich hoffte, dass es nicht so schlimm sei und versuchte meine Zehen zu bewegen. Das ging zum Glück aber es tat höllisch weh.
Nach einigen Minuten kam ein anderer Wagen. Es war der gleiche Sanitäter, der damals Steve versorgt hatte. Er sprach mit Norman französisch, schaute mich kurz an und setzte sich dann auf das Bett, um den Verband abzunehmen.
Da ich durch seinen breiten Rücken nichts sehen konnte und auch nicht verstand was sie sprachen, schloss ich die Augen und biss die Zähne zusammen. Kurz darauf kam Norman zu mir. Er zeigte mir ein Zäpfchen.
„Du musst Dich kurz umdrehen. Es ist gegen die Schmerzen. Er muss die Wunde desinfizieren, bevor er einen neuen Verband anlegt.“
Bei dem Wort ‚Desinfizieren‘ bekam ich schon Panik. Ich wusste nur zu gut, dass So was immer tierisch weh tut. Deshalb ließ ich mir von Norman auch ohne Widerrede das Zäpfchen in meinen, ihm wohlbekannten Hintereingang schieben aber Hoffnung, dass es schnell wirken würde, hatte ich nicht.
Nach einer Weile, vielleicht um die Wirkung des Zäpfchens abzuwarten, nahm der Sanitäter ein Tuch und eine Flasche. Er sagte etwas zu Norman. Der setzte sich nun auf die andere Seite des Bettes, fasste mich an den Schultern und sagte: „Es wird jetzt etwas weh tun. Ich muss Dich leider festhalten.“
Der Sanitäter fixierte mein Bein mit seinem Körpergewicht und dann ging es los.
Der plötzliche Schmerz war unerträglich. Ich schrie wie am Spieß, wollte mich aufbäumen und wegdrehen aber ich kam gegen die Kraft der beiden nicht an. Es kam mir vor, als tupfte der Typ die Wunde mit Salzsäure aus. Der beißende höllische Schmerz ließ erst etwas nach, als der Verband schon fertig war.
Norman wischte mir mit einen Handtuch den Schweiß und die Tränen aus dem Gesicht. Er sah auch ziemlich mitgenommen aus. Ich schloss wieder die Augen. Es schmerzte noch immer aber es brannte nicht mehr so wahnsinnig.
Der Sanitäter zog dann eine Spritze auf und Norman erklärte mir, dass es ein Antibiotikum wäre, um einer Entzündung vorzubeugen. Mir war jetzt alles egal. Ich ließ mich umdrehen die Spritze in mein Hinterteil stechen und dann blieb ich auf der Seite liegen und krallte mich in das Kopfkissen.
Warum musste mir das gerade jetzt passieren? Die ganze Zeit war ich gesund und ausgerechnet jetzt, wo meine ‚Abreise‘ kurz bevorstand, passierte mir so was. Ich konnte den Sanitäter noch nicht einmal fragen wie lange es dauern würde bis ich wieder laufen kann.
Meine Stimmung war mies. Norman hatte sich auf das Bett gesetzt und strich mir tröstend die Hand über den Kopf.
„Das heilt schon wieder. Tut es noch sehr weh?“
Ich nickte.
„Ich glaube das ist noch von dem teuflischen Zeug aber es geht schon.“
„Das muss ein ziemlich scharfer Stein gewesen sein“, meinte er.
„Du musst den Fuß ziemlich ruhig halten und darfst auf keinen Fall auftreten damit das richtig zusammenheilen kann.“
Ich seufzte, denn was Norman gesagt hatte, machte mir nicht besonders viel Mut. Zum einen war es mir ein Gräuel im Bett liegen zu müssen und zum anderen musste ich Sam am nächsten Mittwoch unbedingt helfen, um die ‚Anny‘ langstreckentauglich zu machen.
Während mir alle möglichen Gedanken durch den Kopf gingen, holte Norman das Abendessen von der Kantine. Ich hatte zwar keinen Appetit aber das würde er wohl nicht gelten lassen.
Am Abend begann mein Fuß unangenehm zu pochen. Ich war deshalb sehr unruhig im Bett. Norman verpasste mir ein Zäpfchen mit einem Schlafmittel, legte sich neben mich und gab mir einen Kuss. Seine warmen Hände streichelten sanft und beruhigend meine Brust und meine Arme bis ich eingeschlafen war.
Am nächsten Morgen schmerzte mein Fuß nicht mehr so stark. Mit Normans Kopfkissen gelang es mir einigermaßen bequem in dem Buch zu lesen, das er mir von Jason mitgebracht hatte. Nach dem Mittagessen wollte ich unbedingt raus und bat Norman, mich auf die Bank hinter der Unterkunft zu bringen. Der schüttelte aber den Kopf.
„Es ist besser wenn Du den Fuß schonst und im Bett bleibst.“
„Ach Norman bitte. Ich halte ihn auch ganz ruhig und trete nicht auf wenn Du mir hilfst, “ maulte ich.
Er schaute mich streng an.
„Hör auf Micha. Ich muss gleich rüber zur Mine und auf dem Rückweg mit Steve sprechen. Wenn Du mir nicht versprichst, dass Du ruhig liegen bleibst, binde ich Dich am Bett fest.“
Ich schaute ihn entsetzt an.
„Ist das Dein Ernst? Würdest Du das WIRKLICH TUN?“
Er antwortete nicht auf meine Frage aber sein verschmitztes Lächeln verriet mir, dass er so weit nicht gehen würde.
„Also, Du bleibst wo Du bist. Ich bin bald wieder zurück, okay?“
„Ja Sir“, antwortete ich widerwillig und griff nach dem Buch.
Ich war sauer. Als er weg war, versuchte ich auf einem Bein zum Bad zu hüpfen. Ich wollte nur wissen ob es geht. Nach den ersten zwei Hüpfern begann mein verletzter Fuß aber so sehr zu pochen, dass ich umkehrte und mich resigniert wieder hinlegte.
Norman blieb lange. Er kam so spät, dass er gleich das Abendessen mitbrachte.
Nach dem Essen erzählte er, dass Steve morgen nach Cameia fliegen würde. Er würde bis Lubumbashi mitfliegen und die Erledigungen machen.
Es passte mir überhaupt nicht, dass ich nicht fliegen konnte und stattdessen den ganzen Tag alleine im Bett zu liegen war in meiner Vorstellung der nackte Horror.
„Dann nimm mich doch wenigstens morgen früh mit zum Hangar“, bat ich.
Norman räumte das Geschirr zusammen und schüttelte mit dem Kopf.
„Micha Du spinnst. Den ganzen Tag im Hangar? Was soll das? Denke lieber dran, dass Dein Fuß wieder heilt.“
Diesmal gab ich nicht kampflos auf.
„Norman bitte. Überleg‘ doch mal. Du kannst mich doch nicht den ganzen Tag hier alleine lassen. Wenn ich mal aufs Klo muss und dabei hinfalle, dann liege ich den ganzen Tag hilflos im Flur und zu essen kriege ich dann auch nichts.“
Ich versuchte die ganze Dramatik in meine Stimme zu legen.
„Außerdem kann ich mich im Hangar auch auf die Pritsche legen und ich wäre nicht so allein.“
Norman holte tief Luft. Ich konnte ihm ansehen, dass er mit sich rang. Dann drehte er sich um und schlug mit der Hand auf die Tischfläche.
„Also gut, dann liegst Du eben den ganzen Tag auf der Pritsche aber beklage Dich ja nicht, dass Dir am Abend alle Knochen wehtun.“
Nachdem er mich erst etwas erschreckt hatte, strahlte ich zufrieden.
„Ich werde mich nicht beklagen. Danke Norman.“
Etwas später bekam er dafür auch einen dicken Kuss von mir.
Am nächsten Morgen trug mich Norman wie versprochen vom Auto zum Hangar und legte mich auf die Pritsche, die in der Nähe von Sams Magazin an der Wand stand.
Sam, der noch nicht wusste was mir passiert war, kam hinzu und Norman erklärte es ihm.
Draußen hörte ich den Wagen von Steve.
Norman verabschiedete sich von mir und wandte sich im Umdrehen an Sam.
„Pass ein bisschen auf ihn auf. Er darf noch nicht aufstehen.“
Als er weg war, schaute mich Sam an und brummte:
„Ist es wirklich so schlimm?“
Ich richtete mich auf und schüttelte den Kopf.
„Norman übertreibt immer. Hast Du irgendetwas, was ich als Krücken benutzen kann?“
„Mir wird schon was einfallen“, meinte Sam und schlurfte davon.
Eine halbe Stunde später kam er mit zwei Schaufelstielen zurück, an die er je einen Griff angeschraubt hatte.
„Hey, das ist ja super“, freute ich mich.
Vorsorglich wickelte ich einen sauberen Putzlappen um meinen blütenweißen Verband und dann machte ich erste Gehversuche mit den Krücken.
Erst war es ein wenig wackelig aber nach etwas Übung kam ich damit langsam voran. Es war ein gutes Gefühl, mich wieder selbstständig fortbewegen zu können. Außerdem hielt ich meinen verletzten Fuß ruhig und trat nicht damit auf.
Beim Malzkaffee zeigte mir Sam das Anschlussstück für den Schlauch an den Tank. Er hatte es aus einem Stück Wasserrohr und einer Unterlegscheibe zusammengeschweißt. Auf das Kupferrohr hatte er ein Außengewinde geschnitten. Mit einer weiteren Unterlegscheibe, einer Mutter und einer Lederdichtung konnte man daraus eine Verbindung zum Tank herstellen. Ein Absperrventil hatte er auch schon. Es war eigentlich auch für eine Wasserleitung gedacht aber Hauptsache es funktionierte.
Sam legte die beiden Teile sorgsam in seine Schublade.
Den Rest des Tages half ich ihm an der ‚Paula‘. Viel konnte ich ja nicht machen aber zum Anreichen von Werkzeugen und Teilen reichte es. Zwischendurch, wenn mein Fuß schmerzte, legte ich mich eine Weile hin und dann ging es wieder.
Am Abend, als sich Steve ankündigte, legte ich mich wieder auf die Pritsche und versteckte die Krücken darunter an der Wand.
Gleich nach der Landung schaute Norman nach mir und war erstaunt, mich gut gelaunt vorzufinden.
„Ich fahre noch schnell zur Mine und hole Dich gleich“, sagte er und verschwand.
Als ich später seinen Wagen hörte, nahm ich die Krücken und ging ihm entgegen.
Er blieb stehen, stemmte die Fäuste in die Seite und schüttelte den Kopf. Da es schon dunkel war, konnte ich seinen Gesichtsausdruck nicht sehen.
Ich war mir einer Strafpredigt ziemlich sicher aber das war mir egal.
„Ich hab mir doch gleich gedacht, dass Du nicht auf der Pritsche liegen bleibst“, hörte ich.
Ich sagte nichts und kam mit den Krücken zum Wagen. Er half mir beim Einsteigen und legte die Krücken auf die Ladefläche.
„Darüber reden wir noch“, sagte er und fuhr los.
An der Unterkunft wollte er mich aus dem Auto heben aber ich wehrte mich und verlangte die Krücken.
„Warum bist Du so unvernünftig?“
„Warum behandelst Du mich wie ein kleines Kind?“
Wir stritten heftig. Jedenfalls bekam ich meine Krücken und humpelte damit alleine los. Wie immer wenn es Zoff gab, wollte ich in mein Zimmer. Schon im Türrahmen legte Norman von hinten seine Hand auf meine Schulter und hielt mich zurück.
„Tut mir leid Micha. Ich hab’s doch gut gemeint, damit Dein Fuß bald wieder heile ist.“
„Mann – glaubst Du etwa das will ich nicht? Ich hab so aufgepasst. Guck Dir den Verband an. Er ist genauso weiß wie heute Morgen. Was nützt es wenn mein Fuß wieder heil ist und ich mich stattdessen wund gelegen habe?“
Jetzt musste Norman lachen. Mit einem Griff hatte er mich auf den Armen. Die Krücken fielen krachend zu Boden und ich fand mich auf seinem Bett wieder. Über mich gebeugt sah ich sein unwiderstehliches Lächeln.
„Wie wär‘s mit Frieden?“
„Wenn Du mir die Krücken neben das Bett legst?“
„Ja gleich“, sagte er und küsste mir zuerst auf die Stirn und dann auf den Mund.
Am Samstag ließ er mich noch nicht fliegen und am Sonntag hatten wir frei. Ich durfte wieder mit zur Kantine und sogar zum Training. Auf der Bodenmatte liegen und Hanteln stemmen konnte ich ja.
Am Sonntag schaute ich mir den Fuß beim Verbandwechsel ziemlich genau an. Ich war zufrieden. Es heilte und hatte sich nicht entzündet. Ich musste nur aufpassen, dass die Wunde nicht durch eine falsche Bewegung wieder aufplatzte. Eine Narbe würde bleiben aber das war nicht zu ändern.
„Bist Du sicher, dass Du morgen damit fliegen kannst?“ fragte Norman.
„Ja“, antwortete ich.
„Die Seitenruder brauche ich eigentlich nur beim Rollen auf dem Boden und da kannst Du mir ja mit den Pedalen auf der anderen Seite helfen.“
Das Fliegen klappte gut. Ich war froh, denn nichts war so ätzend wie die Langeweile im Camp.
Am Mittwoch war ich mit den Vorbereitungen der Flucht beschäftigt. Bis dahin hatte ich die Gedanken daran ganz gut verdrängen können aber jetzt wurde es ernst. Ich wagte es inzwischen kurze Entfernungen mit nur einer Krücke zu bewältigen.
Ich wurde gleich nach dem Start der Kuriermaschine von Sam mit dem Wagen abgeholt. Wir begannen mit dem schwierigsten Teil, der Montage des Verbindungsstückes an den Tank. Sam hatte die Verkleidungsbleche an der Tragflächenwurzel entfernt und vorsichtig ein Loch in die Stirnwand des Tanks gebohrt. Ich krabbelte mühsam auf die Tragfläche, um das Anschlussstück vom Tankinneren durch das Loch zu stecken. Trotz meiner dünnen langen Arme war der Einfüllstutzen zu eng. Ich kam im Tank nicht um die Kurve. Wir mussten den Einfüllstutzen also abbauen, damit ich mehr Platz bekam.
Erst jetzt kam ich mit meinem Arm hinein und die Länge reiche ganz knapp, um die Stirnwand des Tanks zu erreichen und das Loch zu ertasten. Ich hörte, wie sich das kurze Rohrstück bis zu der aufgeschweißten Scheibe mit Lederdichtung durch das Loch gegen die Tankwand schob. Ich hielt es so lange fest, bis Sam es mit einer weiteren Scheibe und einer Mutter verschraubt hatte.
Nach diesem anstrengenden Teil musste ich mir erst einmal den Bezingestank von meinem Arm schrubben.
Nach einer Kaffeepause schnitten wir die Schlauchstücke zurecht und befestigten sie mit Schellen an das neue Anschlussstück, an das Absperrventil und die Handpumpe.
Um zu testen, dass unsere Vorrichtung funktionierte und dicht war, betankten wir diesen Tank nun mit Kanistern aus dem Laderaum. Ich stoppte die Zeit und brauchte knapp zehn Minuten, um den Inhalt eines Kanisters in den Tank umzupumpen.
Als ich den Tank gefüllt hatte, leuchtete Sam den Schlauch mit den Anschlüssen ab und stellte fest, dass alles dicht war. Jetzt hatten wir eine weitere Pause verdient, bevor wir uns mit der Halterung für die Kanister im Laderaum beschäftigten.
Zwischendurch besprachen wir alle Einzelheiten und ich lernte die Checkliste auswendig, um nichts zu vergessen.
Als Norman am späten Nachmittag zurückkam, hatte ich ein etwas bedrückendes Gefühl im Bauch. Irgendwie fühlte ich mich ihm gegenüber ziemlich schäbig aber er ließ mir ja keine andere Wahl.
Er war auch ausgerechnet an diesem Abend so lieb zu zärtlich zu mir. Seit meiner Verletzung hatte er sich im Bett ziemlich zurückgehalten und heute löste er sein Versprechen ein, alles nachzuholen. Gleich nach dem Abendessen begann er mich bei Kerzenlicht langsam auszuziehen und meinen Körper mit der Zunge zu verwöhnen. Ich spürte wie heiß er war und ich zwang mich nur an ihn zu denken und es zu genießen.
Langsam kam er dem Ziel immer näher. Ich hatte die Augen geschlossen, spürte sein Gesicht an meinen Oberschenkeln, seine Zunge, die an meinen Eiern leckte und sie zärtlich umkreise als er sie erst einzeln und dann beide in seinen Mund saugte.
Er verstand es meisterhaft, mich auf den Gipfel der Gefühle zu treiben und dann da zu halten, bis ich fast um Erlösung bettelte.
Seine Zunge konnte mein bestes Stück nicht mehr steifer machen aber er spielte damit und holte sich die Lusttropfen von der prallen Eichel. Er liebte es, wenn ich dabei laut stöhnte und dann ließ er das gute Stück in seinen Mund und bearbeitete es, dass mir Hören und Sehen verging.
Es war ein Orgasmus erster Klasse. Als ich die Augen wieder öffnete, hockte Norman zwischen meinen Beinen, strahlte mich mit seinem Unwiderstehlichen Lächeln an und leckte sich die Lippen.
„Hmm, das war ja heute eine Riesenportion“, witzelte er.
Ich lächelte zurück und sagte:
„Dann Lass mich mal sehen, ob Du mir auch was aufgehoben hast.
Dagegen hatte er natürlich nichts einzuwenden und ich gab mein bestes, ihn auch so richtig zu verwöhnen, was mit einer reichlichen Portion seinerseits belohnt wurde.
Bei einem Glas Rotwein kuschelten wir und neckten uns ein wenig. Es dauerte nicht lange, bis wir wieder geil waren und uns gegenseitig die Schwänze verwöhnten. Anschließend waren wir uns einig, dass wir Boysahne noch lieber mochten als Rotwein.
Wir hatten aber auch danach noch nicht genug voreinander. Nach einer kurzen Pause begann Norman erneut zu schmusen. Ich natürlich auch, denn es war so schön mit ihm. Wir ließen uns Zeit, wir hatten ja auch Zeit und dann ergriff uns erneut das Verlangen. Norman legte meine Beine über seine Schulter. Ich wusste was er jetzt wollte und das fand ich geil. Mein bestes Stück zeigte wieder nach oben und sein Lächeln hatte etwas Besitz ergreifendes.
Er rieb seinen Schwanz mit Spucke ein und brachte ihn in Position. Während er langsam und gefühlvoll in mich eindrang, kitzelte ein Finger meine empfindliche Eichel.
Ohhh, diese beiden Gefühle gingen durch und durch. Was machte er heute nur mit mir. War es seine Art von Abschiedsvorstellung? Ich wusste es nicht und an diesem Abend wollte ich es auch nicht wissen.
Anders als sonst begann er mit ganz langsamen Bewegungen. Das erregte mich ungemein und gleichzeitig spielte er mit meinen Eiern und meinem Schwanz. Ich hatte immer das Gefühl ganz ihm zu gehören wenn er so in mir war. Heute war er aber so zärtlich und gab mir ein neues Gefühl von Glück und Geborgenheit. Sollte er doch etwas ahnen und mich damit von meinen Plänen abbringen wollen?
Für eine Sekunde war ich drauf und dran meine Fluchtpläne aufzugeben aber dann war ich wieder hier und bei diesem Moment.
Wenn Norman voll drin war, lächelte er mich an und ich lächelte zurück. Er könnte alles von mir haben wenn er nur wollte. Er durfte mich nur nicht alleine lassen und das war der wunde Punkt.
Diese Gedanken waren wie Blitze in meinem Gehirn. Sie kamen und gingen. Ich konnte sie nicht festhalten, nicht zu Ende denken und nicht aussprechen. Ich musste alles so geschehen lassen wie es geschah.
Norman begann leise zu stöhnen. Seine Stöße wurden allmählich schneller und fester. In gleicher Weise verfuhr seine Hand auch mit meinem Schwanz. Ich begann auch zu stöhnen und so steuerten wir unaufhaltsam unserem dritten Höhepunkt an diesem Abend zu.
Keuchend und erschöpft leckte Norman auf, was ich auf meinen Bauch und die Brust gespritzt hatte. Er wollte immer alles von mir. Am liebsten direkt aber heute ging es nur so. Er hatte es ja selbst so gemacht.
Zum Abschluss gab er mir einen langen Kuss.
Wir waren beide k.o. und er streckte sich auf sein Kissen. Kurz darauf müssen wir beide eingeschlafen sein.
Wir schliefen bis neun. Nach dem Frühstück fuhr Norman wie jeden Donnerstag zur Mine. Für mich war es die einzige Gelegenheit vor dem nächsten Mittwoch noch unbemerkt einen Abschiedsbrief an Norman zu schreiben.
Nach dem gestrigen Abend musste ich alle Kraft zusammennehmen, um nicht den ganzen Block voll zu heulen, bevor ich anfing zu schreiben:
Hallo Norman,
wenn Du diesen Brief findest, bin ich schon weit fort von hier. Bitte verzeih‘ mir aber ich konnte die Ungewissheit, ob und wann ich wieder nach Hause kann, nicht länger ertragen.
Ich habe durch Zufall mitgehört, als Du Frau van de Waal erzählt hast, dass Du in zwei Wochen mit Jason nach Amerika fliegen wirst. Es hat mir sehr weh getan, dass Du mir in der ganzen Zeit seitdem nichts davon gesagt hast und meine Angst, ohne Dich in Kabunda bleiben zu müssen, wurde von Tag zu Tag größer.
Wie Du sicher weißt, ist Sam sehr krank und er begleitet mich ein Stück auf meiner Reise, weil er den Wunsch hat, neben seiner Frau begraben zu werden.
Wenn Dir dein Vater wegen meiner Flucht Ärger macht, dann sage ihm endlich, dass es nicht fair war, wie er mit mir umgegangen ist. Ich wollte schon damals abhauen. Du weißt schon – vor Weihnachten aber da hatte ich noch nicht den Mut dazu und noch mehr Hoffnung, dass es endlich im Frühjahr klappt.
Lieber Norman, ich danke Dir für die schöne Zeit, die ich mit Dir zusammen sein konnte und für alles was Du für mich getan hast. Ich verspreche Dir, dass ich nichts tun und nichts sagen werde, was Dir irgendwie schaden könnte. Sobald ich nach Deutschland fliegen kann schicke ich Dir einen Brief über Kintu am Flughafen Lubumbashi und teile Dir mit, wo das Flugzeug steht.
Ich möchte die gute alte ‚Anny‘ nämlich nicht stehlen und meinen Teil dazu beitragen, dass sie wieder nach Kabunda zurückkommen kann.
Obwohl ich mich so sehr danach sehne wieder nach Hause zu kommen, bin ich sehr traurig. Ich werde Dich sehr vermissen, denn ich liebe Dich und werde die Zeit mit Dir nie vergessen. Wenn ich wieder in Deutschland bin und vielleicht wieder einen Job beim Radiosender bekomme, werde ich einen Song für Dich spielen. Dieser Song heist: ‚TO KNOW HIM IS TO LOVE HIM‘ von ‚THE TEDDY BEARS‘.
Bitte grüße Jason von mir. Ich wünsche Euch alles Gute, und alles was man für einen neuen Lebensabschnitt braucht um glücklich und zufrieden zu sein. Nimm zum Abschied meinen kleinen Teddy, den ich neben den Brief gelegt habe. Er hat die ganze Zeit auf mich aufgepasst und mich getröstet wenn ich traurig war. Er wird auch auf Dich aufpassen und der Gedanke, dass er bei Dir ist, tröstet mich ein wenig.
Leb‘ wohl mein lieber Norman. Ich drücke Dir ganz fest die Daumen, dass alles gut wird.
In Liebe, Dein
Micha
Als ich diesen Brief nach dem dritten Anlauf zu Papier gebracht hatte, steckte ich ihn in einen Umschlag und schob ihn unter die Matratze meines Bettes. Alles sträubte sich in mir und mir liefen die Tränen über das Gesicht.
Warum musste das Leben so hart sein? Warum gab es keine andere Lösung für uns?
Es tat so weh und ich durfte es Norman noch nicht einmal sagen.
Ich musste schnell ins Bad laufen und mein Gesicht waschen, als ich hörte wie er zurückkam.
Für den Rest des Tages hatte ich mich wieder unter Kontrolle.
Mit dem Flug nach Cameia begann für mich die letzte Woche in Kabunda. Es fiel unendlich schwer, mir nichts anmerken zu lassen. Ich erwischte mich immer wieder bei dem Gedanken es nicht zu tun und mit Norman zu reden.
Ich kam aber immer wieder zu dem Ergebnis, dass es zu riskant war und ich doch der Verlierer sein könnte.
Im Beisein von Norman benutzte ich immer noch beide Krücken, obwohl es eigentlich nicht mehr nötig war. Irgendwie gab es mir das Gefühl, dass er dadurch niemals auf den Gedanken kommen würde, dass ich abhauen könnte und außerdem konnte es nicht schaden meinen Fuß zu schonen. Man konnte ja nicht wissen, ob ich ihn schon bald brauchen würde.
Die Woche verlief für mich unendlich zäh und zermürbend. Norman war am Samstagabend und Sonntag wieder sehr lieb, um nicht zu sagen ‚liebebedürftig‘. Ich selbst war es auch aber ich fühlte mich nicht so gut dabei.
Es tat jetzt mehr weh, als es mir gut tat.
Am Montag nahm ich innerlich Abschied von Cameia und am Dienstag verließ ich Cabora Bassa mit Genugtuung, weil ich diesen Ort nie mochte.
An diesem Abend nahm ich auch innerlich Abschied von Norman. Er schmuste ahnungslos mit mir und ich hatte mir ein Zäpfchen mit dem Schlafmittel beiseite geschafft weil ich wusste, dass ich sonst vor Aufregung und Selenschmerz nicht würde schlafen können. Als ich mir sicher war, dass mir von dieser Seite keine Gefahr mehr drohte, schob ich es mir unbemerkt in den Hintereingang und schlief bald ganz friedlich ein.
Mittwoch, 29. April 1977 6 Uhr 10
Ich wurde wach, als Norman aufstand. Ich drehte mich zwar um wie immer aber diesmal zwang ich mich nicht wieder einzuschlafen und wartete stattdessen bis er zum Frühstück fuhr. Dann sprang ich auf und ging ins Bad. Ich war total kribbelig vor Aufregung. Nachdem ich mir einen Overall und die Pilotenstiefel angezogen hatte, packte ich meine Sachen in den Rucksack und nahm auch alle Kleidungsstücke mit, die ich von Norman bekommen hatte, sofern sie nicht in der Wäsche waren. Zum Schluss legte ich meinen Abschiedsbrief und meinen kleinen Teddy auf Normans Bett.
Das gab mir einen Stich und noch einmal gingen mir Gedanken durch den Kopf, ob es richtig war, was ich jetzt tat. Es war aber zu spät noch einmal über alles nachzudenken und wohlmöglich meine letzte Chance zu verpassen. Also ging ich vor die Tür und wartete bis ich die mit Steve und Norman nach Lubumbashi abfliegende Maschine hörte.
Es dauerte nicht lange, bis Sam mit dem Wagen vorfuhr. Ich lud meine Sachen ein und nahm zur Sicherheit auch beide Krücken mit.
„Na, alles in Ordnung?“ fragte Sam.
Ich nickte nur und er fuhr mich zunächst zur Kantine.
„Gib mir eine Viertelstunde“, sagte ich und ging zum Frühstücken hinein.
Kitty wunderte sich, dass ich an meinem freien Tag schon so früh war.
Ich erzählte ihr, dass ich Sam helfen wollte, einen neuen Motor in ein Flugzeug einzubauen und ich deshalb den ganzen Tag beschäftigt wäre. Deshalb war es auch kein Problem, sie um zwei Kannen Kaffee und ein dickes Lunchpaket zu bitten, was ich als Proviant für den Flug eingeplant hatte.
Ich bedankte mich bei ihr und gab ihr zum Abschied einen Kuss auf die Wange.
Sam hatte draußen gewartet und fuhr mit mir zum Hangar.
Die ‚Anny‘ war soweit vorbereitet. Ich musste nur noch die gefüllten Benzinkanister einladen, in die Haltevorrichtungen stellen und mit einem Gurt verzurren. Das war für Sam inzwischen zu schwer geworden. Dann warf ich meine Sachen daneben und gemeinsam zogen wir mein mir so lieb gewordenes Flugzeug nach draußen.
Ich half Sam beim Einsteigen und kurz darauf schnallte ich auch mich auf dem Pilotensitz fest.
Die Zeit bis der Motor warmgelaufen war kam mir vor wie eine Ewigkeit aber dann rollte ich auf die Piste. Noch einmal tief durchatmen und den Gashebel nach vorn.
Kapitel 6
Nach dem Abheben flog ich eine Linkskurve und schaute ein letztes Mal auf das Camp. Es lag so friedlich da. Ich sah den Hangar, die Unterkunft, die Kantine und sogar das kleine runde Plateau unseres Hügels. Mit einem kräftigen Durchatmen nahm ich den Kurs auf. Es war jetzt 8 Uhr 20.
Um nicht genau über den britischen Flugplatz ‚East Seven‘ zu fliegen, blieb ich etwas südlich. Man konnte ja nicht wissen, ob man mich dort beobachten würde. Da Steve gewisse Beziehungen zu den Briten pflegte, hätte er auf diese Weise vielleicht meinen Kurs erfahren können und das wollte ich vermeiden.
Nach knapp zwanzig Minuten überflogen wir die Grenze zu Sambia. Ich hatte meine gewünschte Höhe von 1.000 Metern über Grund erreicht. Die Sonne stand vor mir, es war keine Wolke zusehen.
Bestes Ausflugswetter, meinte Sam und ich konnte ihm nur zustimmen.
Auf der linken Seite konnte man schemenhaft die Wasserfläche des Lake Bangweulu erkennen. Unter uns breitete sich ein Sumpfgebiet aus wo sich Tausende Vögel tummelten.
Nach 85 Minuten Flugzeit hatten wir eine waldreiche Landschaft unter uns und entdeckten bei der kleinen Siedlung Chibutubutu eine in den Wald geschlagene Schneise. Das konnte nur die zukünftige Trasse der Eisenbahnverbindung von Dares Alam nach Lusaka sein. Unsere Fluggeschwindigkeit betrug 180 km/h und entsprach ziemlich genau meiner Flugplanung.
Durch die langsam höher steigende Sonne bildeten sich zaghaft die ersten Quellwolken am Horizont. Es würde also nicht mehr lange dauern, bis es in der Luft Turbulenzen geben würde. Ich sagte Sam, dass ich die Zeit noch nutzen wolle, um den Sprit aus den ersten beiden Kanistern in den Tank zu pumpen.
Um ihm das Kurshalten zu erleichtern, zeigte ich ihm einen Punkt am Horizont und überließ ihm den Steuerknüppel.
Auf allen Vieren kletterte ich über die Rückenlehne des Pilotensitzes in den Laderaum, öffnete das Ventil und pumpte den Inhalt von zwei Kanistern mit dem Handhebel in den Tank in der Tragfläche.
Nach zwanzig Minuten war ich damit fertig und zum ersten Mal an diesem Tag so richtig ins Schwitzen gekommen.
Als ich mich wieder auf meinem Pilotensitz angeschnallt hatte, musste ich erst einmal einen Becher Kaffee trinken.
Sam hatte das Flugzeug gut auf Kurs und Höhe gehalten. Zufrieden stellte ich fest, dass die Tankanzeigen wieder ‚voll‘ anzeigten.
In der nächsten Stunde überflogen wir zunächst ein steppenartiges Gelände und dann wieder ein Sumpfgebiet, welches sich bis kurz vor die Grenze zu Tansania erstreckt.
Kurz nach dem Überfliegen der Grenze musste ich höher steigen um einige Erhebungen zu überfliegen, die in der Karte mit etwas mehr als 2000 Meter über dem Meeresspiegel angegeben waren.
Während auf der linken Seite der Lake Rukwa auftauchte, machten sich die ersten Turbulenzen in Form von aufsteigenden warmen Luftblasen bemerkbar aber das war bei entsprechendem Sonnenstand völlig normal.
Rechts von uns erstreckte sich nun der Ruaha Nationalpark aber das erkannte ich nur auf der Karte.
Sam und ich beschlossen uns des Lunchpaketes anzunehmen und uns zu stärken, während unser Flugzeug mit gleichmäßigem Brummen über das Bahi-Sumpfgebiet flog.
Nach etwas mehr als fünf Stunden Flugzeit kam zum ersten Mal eine Stadt mit einem kleinen Flughafen in Sicht. Es war Dodoma und lag ein wenig östlich unseres Kurses. Hier kreuzten wir auch die Eisenbahn, die den Tanganyikasee weit im Westen mit der afrikanischen Ostküste in Dares Alam verbindet.
Über der anschließenden Massai-Steppe besserte sich die Sicht nach vorne, da die Sonne inzwischen hinter uns stand.
Erst schemenhaft aber dann immer deutlicher kam Afrikas höchster Berg, der Kilimanjaro und sein kleinerer Bruder, der Meru in Sicht. Der fast 6.000 Meter hohe Gipfel war in Wolken gehüllt aber man konnte deutlich erkennen, dass er eine Kappe aus Schnee und Eis trug.
Schon aus einiger Entfernung war der Anblick gewaltig. Ich beschloss die Zeit zu nutzen, um weiteren Sprit aus den Reservekanistern in den Tank zu pumpen, um damit fertig zu sein, wenn wir östlich am Kilimanjaro vorbeifliegen würden.
Ich beeilte mich damit aber ich musste mich mit einer Hand festhalten, da Sam die Turbulenzen nicht so gut ausgleichen konnte und ich sonst im Laderaum hin und her gerutscht wäre.
Nach etwas mehr als einer halben Stunde waren sämtliche Kanister leer und mir lief der Schweiß von der Stirn in die Augen.
Als ich mich wieder angeschnallt hatte, schien der Berg zum Greifen nahe. Der Gipfel war deutlich über uns. Am südlichen Fuß des Massivs war die Stadt Moshi zusehen und bald hatten wir die Grenze zu Kenia erreicht.
Ich musste nun einen nördlichen Kurs nehmen, um den Kilimanjaro östlich zu umfliegen. Obwohl ich nun schon fast acht Stunden im Flugzeug saß wurde mir bei diesen beeindruckenden Bildern wieder bewusst wie schön das Fliegen war.
Nördlich des Kilimanjaro kannte sich Sam aus. Er zeigte mir einige Orte und Farmen und schließlich die Straße und die Eisenbahn, die Nairobi mit der Hafenstadt Mombasa verbindet.
Zur besseren Orientierung flog ich nun tiefer an der Straße und Eisenbahn entlang, bis Sam einen unscheinbaren Weg entdeckte, der nach Norden abbog und zu einer abgelegenen Farm führte.
„Da ist es!“ rief er und zeigte auf das kleine Farmhaus. „Links vom Haus die Weide ist groß und eben. Darauf kannst Du landen.“
Ich flog erst einmal vorbei und schaute mir die Landefläche an. Es sah gut aus. In einem großen Bogen ging ich in den Landeanflug über und setzte die ‚Anny‘ wenig später sanft auf der Weide auf.
Sam zeigte mir eine Stelle an einer Baumgruppe. Dort wendete ich das Flugzeug und stellte nach acht Stunden und 35 Minuten Flugzeit den Motor ab.
Mit einem klack, klack, klack kam der Propeller zum Stehen. Ich streckte meine verkrampften Knochen und holte tief Luft nachdem ich die Tür geöffnet hatte. Bevor ich ausstieg schaute ich mich um. Es war niemand zusehen.
Ich half Sam beim Aussteigen. Er hatte Schmerzen aber er wollte es sich nicht anmerken lassen.
Von Ferne hörte ich Hufgetrampel und schaute mich um.
„Das ist Andrew, er hat wohl doch etwas gehört“, erklärte mir Sam.
Kurz bevor uns der Reiter erreicht hatte, richtete er ein Gewehr auf uns.
„Haut ab ihr Banditen!“ brüllte er aufgeregt.
Ich schätzte den Farmer auf etwa 50 Jahre. Er trug einen braunen Hut mit breiter Krempe und ziemlich speckige Kleidung.
Ich nahm irritiert die Arme hoch aber Sam ging ein paar Schritte auf ihn zu.
„Andrew, ich bin der alte Sam. Kennst du mich nicht mehr?“
Das gegerbte Gesicht des Farmers formte sich zu einem kritischen Blick. Dann nahm er langsam das Gewehr nach unten.
Die Begrüßung fiel nicht besonders herzlich aus und Andrew hielt es noch nicht einmal für nötig vom Pferd abzusteigen.
Nach einigem Wortwechsel, den ich nicht verstand, wendete Andrew sein Pferd. Wenigstens den blauen Leinensack mit Sams ganzer Habe nahm er mit aber ich musste meinen Rucksack selber tragen.
Andrew ritt voraus. Sam und ich folgten langsam zu den Gebäuden. Das hölzerne Farmhaus machte einen verwitterten Eindruck. So richtig verwahrlost war es aber auch nicht. Etwa hundert Meter neben dem Haus stand eine fast ebenso große Scheune mit Stall.
Als wir das Haus erreichten, hatte Andrew seine Frau gerufen. Eine kleine schmale Gestalt mit etwas wirren grauen Haaren, die eine verwaschene Schürze trug. Ihr Blick war mürrisch. Ich hatte das Gefühl, nicht sehr willkommen zu sein.
Was Sam betraf, schienen sie wohl irgendwie im Wort zu sein. Jedenfalls sollte er eine abgetrennte Kammer in der Scheune bekommen. Was mich betraf, ich sollte schleunigst das Flugzeug von ihrem Land entfernen. Damit war natürlich gemeint, dass ich selbst auch verschwinden sollte.
Sam erklärte ihnen, dass ich den Flieger wegbringen würde aber vorher müssten zehn Gallonen (etwa 40 Liter) Sprit herbei.
„Ich habe keinen Sprit und ich kann auch keinen besorgen“, gab ihm Andrew zu verstehen.
Die Art wie Andrew sich Sam und mir gegenüber verhielt machte mich ziemlich wütend. Ich zwang mich aber ruhig zu bleiben, denn wenn ich etwas gesagt hätte, wäre es auch nicht besser geworden.
Gegen Abend saß ich mit Sam vor der Scheune. Wir hatten schon vorher ausgemacht, dass ich die ‚Anny‘ zu einem kleinen Landeplatz in der Nähe des Tsavo-Nationalparks fliegen und dort abstellen würde. Jetzt ging es nur noch darum den nötigen Sprit zu bekommen.
Sam erklärte mir den Weg zu einem Ort, wo es Sprit geben müsste. Er meinte es seinen etwa 20 Kilometer. Er wollte mit Andrew sprechen, damit er mir eine Schubkarre leihen würde, auf der ich die Kanister transportieren könnte.
Ein Auto schien es auf dieser Farm nicht zu geben. Jedenfalls hatte ich nichts dergleichen entdeckt.
Die Aussicht, zwei Kanister Sprit mit einer Schubkarre über zwanzig Kilometer heranzuschaffen zu müssen, stimmte mich nicht gerade froh aber ich war bereit alles zu tun, um möglichst schnell von hier fort zu kommen.
Immerhin hatte uns die Frau des Farmers eine Kanne Tee und etwas zu essen nach draußen gebracht. Schlafen könnte ich in der Scheune im Stroh, hatte sie gesagt und ich hatte mir dabei gedacht: ‚Nur keine Angst, ich bleibe sowieso nicht länger als unbedingt nötig. ‘
Sam hatte sich nach dem Essen eine Pfeife angezündet.
„Bist du sicher, dass du hier bleiben willst?“ fragte ich ihn.
Sam schmunzelte.
„Ich komme schon zurecht. Die beiden sind keine Gesellschaft gewöhnt aber in ein paar Tagen sieht das schon anders aus.“
Ich hoffte es für ihn.
Um die Nacht auf dem Stroh zu überstehen, ging ich in der Dunkelheit zum Flugzeug und holte mir zwei Decken. Eine zum Unterlegen und eine zum Zudecken.
Ich war müde aber einschlafen konnte ich nicht.
Ich dachte an Kabunda. Norman musste meinen Abschiedsbrief bereits gefunden haben. Was mochte er jetzt wohl tun?
Ich hatte nicht gedacht, dass meine Sehnsucht nach ihm so stark sein würde. Obwohl es nicht kalt war, fror ich geradezu und zog mir die Decke über den Kopf. Ich kämpfte wieder mit meinen Zweifeln ob es richtig war, von Kabunda abzuhauen. Irgendwann hat mich dann der Schlaf besiegt.
Am nächsten Morgen hatte es Sam geschafft, eine alte hölzerne Schubkarre aufzutreiben. Sie hatte ein dünnes Speichenrad aus Holz, welches mit einem Eisenring beschlagen war. Während ich die Kanister darauf festband sagte mir Sam, ich solle bei dem Laden an der Hauptstraße wo es den Sprit gab nach einem William fragen, den er von der Air Force her kenne. Falls er noch da wäre, sollte ich ihn von ihm grüßen.
Um kurz nach acht Uhr machte ich mich auf den Weg. Am leichtesten ließ sich die Schubkarre auf der Mitte des ausgefahrenen Weges schieben. Zum Glück war es trocken und hart.
Nach einer Stunde hoffte ich etwa vier Kilometer hinter mir zu haben. Die Sonne stieg höher und es wurde ziemlich heiß. Die Landschaft war eben und karg. Weit und breit war kein Mensch zusehen. Ich setzte mich einen Moment auf die Schubkarre, wischte mir den Schweiß von der Stirn und nahm einen kräftigen Schluck Wasser aus einer der beiden Feldflaschen, die ich mir an den Gürtel meiner Jeans gebunden hatte.
Ich nahm mir vor, immer eine halbe Stunde zu gehen und dann eine kurze Pause zu machen. Obwohl es sehr anstrengend war, hielt ich es durch. Gegen Mittag war es unter der hoch stehenden Sonne eine elendige Plackerei. Mein noch nicht ganz verheilter Fuß hatte bis jetzt gut durchgehalten aber allmählich begann er zu schmerzen. Ich durfte gar nicht an den Rückweg denken, wenn die beiden Kanister gefüllt sein würden. Mir war nur klar, dass ich es an einem Tag hin und zurück unmöglich schaffen konnte und mir eine Übernachtungsmöglichkeit suchen müsste.
Endlich konnte ich am Horizont die Hauptstraße erkennen, auf der gerade ein Lastwagen vorbeizog.
Gegen zwei Uhr am Nachmittag hatte ich sie erreicht und auch schon das kleine Dorf mit dem Laden und der Tankstelle in Sicht.
Ziemlich erschöpft und nassgeschwitzt kam ich mit meiner Karre dort an. Es schien alles wie ausgestorben aber mittags strengt sich nur an, wer unbedingt muss.
Ich ging kurz entschlossen in den Laden und läutete an der Glocke. Es dauerte eine Weile bis ein etwa fünfzigjähriger Mann durch den Hintereingang hereinkam. Ich fragte nach Sprit und er nickte. Meine nächste Frage war, ob ich mit amerikanischen Dollar bezahlen könnte und diesmal nickte er etwas eifriger.
Bevor wir aber nach draußen gingen, fragte ich nach William. Er schaute mich total erstaunt an. Da er noch immer nicht sprach, erklärte ich einfach den Grund meiner Frage.
Er gab mir ein Zeichen ihm zu folgen. Auf dem Hinterhof unter einem Schatten spendenden Vordach saß ein alter weißhaariger Mann in einem Rollstuhl. Es sah aus als ob er schlief aber er hatte die Augen nur halb geschlossen und schien mich nicht zu bemerken.
Ich beschloss die direkte Ansprache zu wählen.
„Hallo William. Viele Grüße von Sam“, sagte ich laut.
Der Alte brummelte etwas Unverständliches aber ich gab noch nicht auf.
„Ich komme von SAM. Ihr kennt euch doch von der Royal Air Force!“
Kaum hatte ich die Worte ‚Royal Air Force‘ ausgesprochen, saß der Alte kerzengerade in seinem Rollstuhl. Ich war fast erschrocken, dass so plötzlich neues Leben in ihm erwachte.
„Wo ist mein alter Freund Sam?“ wollte er wissen.
Ich erzählte ihm, dass Sam auf der Farm sei, die ihm früher einmal gehört hatte und dass er krank sei und nicht mitkommen konnte.
Der Alte schwieg einen Moment und dann schrie er mit kratziger Stimme: „J-E-F-F-R-A-Y!!!
Der Mann aus dem Laden, der offensichtlich sein Sohn war, kam eilig herbei und schaute mich an, als hätte ich dem Alten etwas angetan.
„Jeffray“, wiederholte der Alte energisch, „mein alter Freund Sam ist wieder da. Hole den Wagen. Wir fahren zu Andrews Farm.“
Jetzt war ich total verblüfft. Jeffray benutzte die Gebärdensprache. Er war also offensichtlich stumm.
Als er sich umdrehte folgte ich ihm.
„Dann nehmt mich, den Sprit und die Karre bitte mit!“ rief ich hinter ihm.
Jeffray drehte sich kurz um und nickte. Er zeigte mir die Zapfsäule und gab mir Zeichen, die Handpumpe selbst zu bedienen.
Ich füllte die beiden Kanister, nahm einen Schluck Wasser aus dem Brunnen neben dem Laden und füllte meine beiden Feldflaschen wieder auf.
Jeffray hatte einen alten Wagen mit Führerhaus und Ladefläche aus der Remise geholt und mühte sich gerade ab, den Alten vom Rollstuhl auf den Beifahrersitz zu heben. Ich lud inzwischen die Kanister und die Schubkarre auf die Ladefläche.
Für den Sprit wollte Jeffray 40 Dollar haben. Ein Dollar pro Liter schien mir reichlich teuer aber ich hatte keinen Nerv mit einem Mann zu handeln, der nicht reden konnte. Außerdem war ich glücklich, dass mir der Rückweg mit beladener Schubkarre erspart blieb und ich eine Nacht und einen Tag gewonnen hatte. So reichte ich ihm die Dollars und schwang mich auf die Ladefläche.
Gegen fünf Uhr nachmittags waren wir bei Andrews Farm. Sam war sehr überrascht und freute sich über den unerwarteten Besuch.
Ich nutzte die Zeit bis zur Dunkelheit und beförderte die Kanister mit der Karre zum etwas abseits stehenden Flugzeug. Nach einer Stunde hatte ich den Sprit eingefüllt, den Ölstand geprüft und die ‚Anny‘ für den nächsten Morgen startklar gemacht.
Den Rest der Zeit nutzte ich um einen Brief über Kintu am Flughafen Lubumbashi an Norman zu schreiben. Damit hielt ich mein Versprechen, die Abholung der ‚Anny‘ möglich zu machen.
Ich wurde gerade rechtzeitig fertig und konnte Jeffray den Brief mitgeben, bevor er mit William die Rückfahrt antrat. Wie ich gesehen hatte, war sein Laden auch die Poststation für den kleinen Ort.
Nachdem ich mich an einem Bottich neben dem Brunnen gründlich gewaschen hatte, war meine Stimmung ganz gut.
Freitag, 01. Mai 1977
Nach einem kargen Frühstück schnürte ich meinen Rucksack zusammen und verabschiedete ich mich von Sam. Er wünschte mir viel Glück und ich dankte ihm für alles, was er für mich getan und was er mir beigebracht hatte. Ich gab ihm aus der Notausrüstung der ‚Anny‘ den Spirituskocher und sagte: „damit du nicht immer auf deinen Malzkaffee verzichten musst.“
Er klopfte mir auf die Schulter und lachte.
Ich hob nun meinen Rucksack in den Laderaum, stieg ein und ließ den Motor an.
Fünf Minuten später war ich in der Luft und winkte Sam ein letztes Mal mit den Tragflächen.
Bis zu meinem Ziel waren es 100 Kilometer, also nur etwas mehr als eine halbe Stunde Flugzeit. Ich brauchte mich nur südlich der Straße und Eisenbahn in Richtung Mombasa zu halten. Rechts von mir erstreckte sich eine Kette kleinerer Erhebungen und dahinter konnte man schemenhaft den Gipfel des Kilimanjaro erkennen. Mir gefiel diese Landschaft und ich hätte gerne noch einen Erkundungsflug gemacht aber mein Tankinhalt ließ keine größeren Umwege mehr zu.
Den Flugplatz des Tsavo Nationalparks fand ich ziemlich leicht.
Ich staunte nicht schlecht, als nach meiner Landung jemand aus einem kleinen Holzhaus kam und mir per Handzeichen eine Parkposition zuwies. Es war sonst kein weiteres Flugzeug zusehen.
Ich nahm mir Zeit meinen Rucksack auszuladen, Holzkeile vor die Räder zu legen und die ‚Anny‘ sorgfältig abzuschließen.
Währenddessen kam ein junger Kenianer zu mir und deutete auf die ersten beiden Zeichen des Flugzeugkennzeichens, welche den Staat der Zulassung bedeuten.
„Wo kommst du her?“ fragte der junge Bursche interessiert.
Ich erklärte ihm, dass die Zeichen 9P- zu Zaire gehören und konnte seinem Gesichtsausdruck entnehmen, dass er nicht genau wusste wo das überhaupt lag aber das gab er keinesfalls zu.
Er begleitet mich zu dem recht hübsch gestalteten Holzhaus und zeigte mir stolz seinen Dienstraum, in dem sogar zwei Funkgeräte standen. Nebenan befand sich ein Warteraum mit Sitzgelegenheiten. Wie er mir berichtete, ließen sich oft Touristen von Nairobi oder Mombasa hierher fliegen, um dann mit Rangern im Nationalpark auf Safaritour zu gehen.
Wie selbstverständlich bekam ich einen Becher Tee und wurde gefragt, aus welchem Grund ich hergekommen sei.
Ich erzählte, dass ich nach Nairobi wollte und der Flieger in zwei bis drei Wochen von einem anderen Piloten abgeholt würde. Ich gab ihm 20 Dollar, bat ihn den Schlüssel in Verwahrung zu nehmen und auf die Maschine acht zu geben. Sein Gesicht strahlte als er den Schein in Händen hielt. Ich hatte das Gefühl, dass ich mich auf ihn verlassen konnte aber um ganz sicher zu gehen, motivierte ich den Burschen damit, dass er noch einmal 20 Dollar von dem abholenden Piloten verlangen könne, wenn das Flugzeug in Ordnung bliebe.
Jetzt fragte ich wie weit es zum Bahnhof sei und er antwortete: „Nicht so weit.“
Ich konnte mir ein Grinsen nicht verkneifen, denn so genau wollte ich es ja nun auch wieder nicht wissen. Ich muss aber zu seiner Ehrenrettung hinzufügen, dass er mir den Tipp gab, eine Weile zu warten bis einer der Wagen aus dem Park zurückkäme. Für ein paar Dollar würde mich der Fahrer zum Bahnhof bringen und der Zug nach Nairobi käme sowieso erst am Abend.
Aus den zwei Stunden wurden vier aber ich hatte in Afrika gelernt geduldig zu sein.
Zuerst landete eine zweimotorige ‚Norman Islander‘, die neun Personen befördern konnte und offensichtlich Safarigäste zurückbringen sollte. Leider war ihr Ziel Mombasa. Nairobi stand heute nicht auf dem Plan, sonst hätte ich den Versuch gemacht mitfliegen zu können.
Wenig später kamen zwei große Rover und brachten die Gäste. Der Bursche vom Flugplatz sprach den ersten Fahrer an und vermittelte für zehn Dollar meine Fahrt zum Bahnhof.
Die Fahrt dauerte eine halbe Stunde und dabei erfuhr ich einige interessante Details über den Nationalpark.
Als ich vor dem kleinen gelb gestrichenen Bahnhof von Mtito-Andei stand, zeigte die Bahnhofsuhr vier Uhr nachmittags. Ich ging hinein, um eine Fahrkarte zu kaufen. Der Zug nach Nairobi sollte um ein Uhr in der Nacht hier eintreffen.
Der Bahnbeamte machte mir umständlich klar, dass ich nur in der dritten Klasse fahren könnte, weil ich keine Reservierung hätte und die könnte er mir mit dem Telegrafen frühestens für den Zug am nächsten Tag besorgen.
Ich nahm was ich kriegen konnte. Hauptsache ich kam bald nach Nairobi.
Da ich viel Zeit hatte, ging ich ein Stück an der Straße entlang. In dem obligatorischen Laden, der gleichzeitig auch Post- und Tankstelle war, kaufte ich mir etwas zu essen und ließ mich dann neben dem Bahnhofsgebäude an meinen Rucksack gelehnt nieder.
Zweimal wurde die Ruhe von Güterzügen unterbrochen, die von mächtigen Dampfloks gezogen, ohne Halt durch den Bahnhof rauschten.
Als es dunkel wurde, zog sich die Zeit sehr lange hin. Zweimal am Tag so lange warten müssen war auch für mich eine ziemliche Geduldsprobe. Gelegentlich fielen mir die Augen zu und ich merkte an den Zeitsprüngen auf der Uhr, dass ich etappenweise eingeschlafen war.
Kurz nach Mitternacht waren einige Einheimische zum Bahnhof gekommen und schauten mich neugierig an. Der Zug kam erst um halb zwei. Für afrikanische Verhältnisse erstaunlich pünktlich.
Die Wagen dritter Klasse waren ziemlich voll. Allerdings sah ich hier nur Einheimische. Sitzplätze gab es nur an den Seitenwänden. Da diese alle besetzt waren, saßen viele bereits auf dem Boden. Ich tat es deshalb auch und lehnte mich gegen meinen Rucksack. Die Kenianer starrten mich alle an. Das war mir sehr unangenehm.
Nachdem der Zug abgefahren war, begannen einige Männer, die auch auf dem Boden saßen, an den Hosenbeinen meiner Jeans zu zerren und auf mich einzureden. Ich verstand sie nicht und sie schienen auch mein Englisch nicht zu verstehen. Je mehr ich versuchte ihre Grabschhände abzuschütteln, desto eifriger wurden sie.
Ich bekam richtige Panik und wollte aufstehen aber in den anderen Wagen war es ja genauso voll.
Endlich kam der Schaffner, ebenfalls ein Kenianer. Ich reichte ihm meine Fahrkarte zum Lochen und gab ihm zu verstehen, dass mich die Leute doch in Ruhe lassen sollten. Er redete auch mit den Leuten und das hatte Erfolg. Jedenfalls bis er verschwunden war. Jetzt zerrten sie an meinem Rucksack.
Ich war ziemlich genervt aber zum Glück kam der Schaffner unverhofft noch einmal zurück. Als er sah, dass mich seine Landsleute noch immer nicht in Ruhe ließen, gab er mir ein Zeichen, dass ich mitkommen sollte.
Mir fiel ein Stein vom Herzen. Ich folgte dem Schaffner in einen Wagen zweiter Klasse und dort schob er mich in sein Dienstabteil mit zwei gegenüberliegenden Sitzplätzen. Einen bot er mir an, auf dem ich mich unendlich dankbar niederließ.
Der Schaffner sprach ganz gutes englisch und entschuldigte sich für seine Landsleute. Sie seien es einfach nicht gewohnt, dass Weiße in der dritten Klasse fahren und glaubten wohl, dass mit mir etwas nicht in Ordnung sei.
Ich dachte mir, dass sein Kollege am Bahnhof das auch hätte wissen müssen aber dann hätte ich wahrscheinlich heute gar nicht mitfahren können.
Bis zum nächsten Halt des Zuges entwickelte sich ein beiläufiges Gespräch. Als ich erfuhr, dass er aus Nairobi kam, fragte ich ihn nach der deutschen Botschaft. Er zeichnete mir den Weg auf einem Zettel auf.
Den Rest der Fahrt schlief oder döste ich vor mich hin.
Die Ankunft in Kenias Hauptstadt war um halb zehn. Ich ließ mir mit dem Aussteigen viel Zeit weil ich das Gedrängel so vieler Menschen noch nicht ertragen konnte.
Als einer der Letzten verließ ich den Zug. Dem hilfsbereiten Schaffner hatte ich zehn Dollar gegeben und mich verabschiedet.
Vor dem imposanten Bahnhofsgebäude schaute ich mich um und zog den Zettel mit der Wegbeschreibung aus der Tasche.
Das quirlige Treiben der Menschen war nicht was ich brauchte. Ich war müde und noch zu sehr an die Ruhe in Kabunda gewöhnt.
Ich beschloss mir ein Taxi zu nehmen und mich zur Botschaft bringen zu lassen.
Im Taxi wäre ich bald eingeschlafen. Jedenfalls riss mich der Fahrer in die Realität zurück, als er vor dem Botschaftsgebäude angekommen war.
Es war eine schöne große Villa im englischen Stil und stammte wohl aus der Zeit der Jahrhundertwende. Ich hatte jetzt aber keinen Blick dafür.
Mit dem Rucksack an einer Hand ging ich durch ein schmiedeeisernes Tor zum Eingang. Dort musste ich mich zunächst beim Pförtner melden.
Schon nach den ersten Worten musste ich erneut anfangen und auf die deutsche Sprache umstellen. Ich nannte meinen Namen und bat jemanden zu sprechen, weil mir mein Pass gestohlen worden sei.
Der Pförtner telefonierte, gab meinen Namen und mein Anliegen durch, bevor er mich in die große Empfangshalle einließ, wo ich warten sollte.
Ich setzte mich einfach auf meinen Rucksack und hätte mich am liebsten irgendwo hingelegt, um zu schlafen.
Kurze Zeit später hörte ich ein Geräusch auf der Treppe und schaute mich um. Ein junger Mann in dunklem Anzug kam mit schnellen Schritten auf mich zu. Mit einem freundlichen Lächeln sagte er im Näher kommen: „Michael Brunner. Willkommen in der deutschen Botschaft in Kenia.“
Ich war etwas irritiert. Das klang, als hätte er mich schon erwartet aber vielleicht machte man das bei Landsleuten in einer Botschaft weit weg von Deutschland immer so.
Ich erwiderte die Begrüßung per Handschlag. Dabei schaute er mich an.
„Bitte folgen Sie mir in mein Büro“, vernahm ich und folgte seinem Handzeichen.
Ich schätzte ihn auf etwa 28 oder 29 Jahre. Eigentlich viel jünger, als ich mir Botschaftsangestellte vorgestellt hatte.
Im ersten Stock wurde ich in ein kleines Büro geführt und nahm ihm gegenüber vor seinem Schreibtisch Platz.
Er schaute mich wieder an und stellte sich schließlich vor.
„Ich bin übrigens Markus Lüders und habe gehört, dass man Ihnen den Pass gestohlen hat. Sind Sie deswegen hier?“
Ich nickte.
„Ja. Ich will nach Deutschland zurück und das geht ja nicht ohne Pass – oder?“
Jetzt nickte er.
„Wann und wo hat man Ihnen den Pass gestohlen?“
Ich musste mich überwinden denn ich wusste, dass ich ein schlechter Lügner war.
„Gestern Nachmittag hier in Nairobi“, gab ich an.
„Und? Brauchen Sie für den Rückflug auch Geld?“ fragte er wie selbstverständlich.
„Nein“, sagte ich. „Wenn tausend Dollar für ein Ticket reichen brauche ich kein Geld. Soviel habe ich noch.“
Er blickte kurz auf. „Haben Sie den Diebstahl der Polizei gemeldet?“
Ich schüttelte den Kopf.
„Glauben Sie, dass das hier überhaupt einen Sinn hat?“
Er grinste.
„Vielleicht ja, vielleicht nein. Ich frage nur der Ordnung halber.“
Jetzt kamen einige Fragen nach meinem Geburtsdatum, Geburtsort, Adresse in Deutschland und so weiter.
Markus Lüders legte nun seinen Stift beiseite und schaute mich an.
„Wie lange sind Sie schon in Nairobi?“
„Seit gestern Morgen“, log ich weil mir nichts Besseres einfiel.
„Und wo haben Sie übernachtet?“
Jetzt hatte er mich in die Enge getrieben. Ich kannte nichts und niemand in dieser Stadt. Was sollte ich sagen?
Ich beschloss so zu reagieren, dass ihn das nichts anging.
„Warum fragen Sie? Ist das so wichtig? Ich hab doch nichts verbrochen.“
An seinem Blick bemerkte ich, dass ich überreagiert hatte.
Ohne die Miene zu verziehen, griff Lüders in seinen Schreibtisch, holte eine Mappe hervor und reichte sie mir.
„Kennen Sie das?“
Ich nahm die Mappe und schlug sie auf. Die erste Seite war ein Briefkopf des Auswärtigen Amtes in Bonn, adressiert an alle Botschaften und Konsulate der Bundesrepublik Deutschland in den afrikanischen Staaten und im Nahen Osten.
Auf seine Aufforderung blätterte ich weiter. Auf Seite zwei war ein halbseitiges Foto von mir. Ich kannte es wieder. Meine Mutter hatte es an meinem 19. Geburtstag in unserem Garten gemacht.
Erschrocken las ich darunter meinen Namen, mein Geburtsdatum, eine kurze Personenbeschreibung und den Text:
„Michael Brunner ist am Sonntag, den 28. Mai 1976 nach Lusaka geflogen, um ohne Begleitung von dort aus eine etwa sechsmonatige Erkundungsreise durch Afrika zu machen. Mit einem Brief, datiert am 07. Juni 1976 teilte er seinen Eltern mit, dass er sich in Ndola in Sambia aufhalte und nach Lubumbashi (Zaire) weiterreisen wolle. Seitdem verliert sich seine Spur.
Da sich der junge Deutsche, den seine Eltern als zuverlässig bezeichnen und der sich seit Jahren theoretisch mit allen ihm zugänglichen Themen über Afrika beschäftigt haben soll, seither nicht mehr gemeldet hat, haben ihn seine Eltern als vermisst gemeldet.
Sie werden daher ersucht, entsprechende Nachforschungen nach dem Verbleib von Michael Brunner anzustellen, entsprechende Stellen zu informieren und mir bei Ergebnissen jedweder Art sofortige Mitteilung zu machen.“
Ich musste zweimal lesen bis ich den amtlichen Text begriffen hatte. Meine Hand zitterte.
„Das ist doch nicht wahr“, sagte ich. „Ich habe doch immer geschrieben. Acht oder neun Mal.“
Immer wenn es in meinem Bauch heftig zu pochen begann, dann war etwas Schlimmes im Busch und genau dieses Pochen spürte ich jetzt.
Lüders streckte sich gegen seine Stuhllehne.
„Herr Brunner, mit So was spaßen wir nicht.“
Sein Ton wurde ziemlich amtlich. Mir wurde erst heiß, so dass mir der Schweiß auf die Stirn trat und dann wurde mir eiskalt.
Deutsche Behörden spaßen nicht. Das hatte ich schon als Kind gelernt. Aber wenn es so war, dann hatten meine Eltern fast ein Jahr lang Angst um mich und genau das hatte ich nicht gewollt. Ich hatte meine Briefe Norman…
Ich kam gar nicht dazu den Gedanken zu Ende zu denken. In meinem Körper machte sich eine entsetzliche Leere breit und stieg von den Beinen nach oben. Meine Kehle war wie zugeschnürt. Ich konnte kaum atmen. Mein Kopf wurde ganz leicht. Was ich sah verschwamm vor meinen Augen und die Worte von Lüders waren ganz weit weg. Am Ende fiel ich in ein total schwarzes Loch.
Als ich wieder zu mir kam, wurde ich von blütenweißer Bettwäsche geblendet. Ich kniff die Augen zusammen, schaute an einer graugrünen Wand empor und drehte mich langsam um.
Dort sah ich Markus Lüders auf einem Stuhl vor meinem Bett sitzen und ließ meinen Kopf wieder auf das Kissen fallen.
„Was ist passiert und wo bin ich hier?“ wollte ich wissen.
Lüders räusperte sich.
„Wir sind hier im britischen Militärhospital in Nairobi. Du bist vom Stuhl gefallen wie ein nasser Sack. Der Arzt sagte es sei ein Kreislaufkollaps. Könnte auf Erschöpfung oder außergewöhnliche nervliche Belastung zurückzuführen sein. Er hat Dich untersucht und organisch nichts festgestellt. Dann hat der dir eine Spritze gegeben und jetzt hast Du 30 Stunden geschlafen.
„Oh, so lange?“ wunderte ich mich. „Tut mir leid, wenn ich Ihnen solche Umstände gemacht habe.“
„Schon gut“, meinte Lüders. „Der Botschafter hat mir den Auftrag gegeben, mich um Dich zu kümmern.“
Ich erinnerte mich jetzt wieder was ich vor meinem Zusammenbruch erfahren hatte und seufzte.
„Haben Sie noch mehr solcher Nachrichten für mich?“
Lüders rückte mit dem Stuhl etwas näher heran und schüttelte den Kopf.
„Was hältst Du davon, wenn Dir auch Du zu mir sagst? Ich heiße Markus.“
Das hatte ich von einem Botschaftsangestellten zwar nicht erwartet aber ich hatte nichts dagegen.
„Okay, ich bin der Micha.“
Er lächelte.
„Es tut mir übrigens leid, dass ich Dir die Sache mit der Vermisstenmeldung so um die Ohren gehauen habe.“
Bei dem Gedanken daran schossen mir wieder Tränen in die Augen.
„Das hab ich nicht gewollt. Ich weiß doch, dass ich geschrieben habe und ich verstehe nicht warum keiner der Briefe angekommen ist.“
Markus versuchte meine Aufregung zu dämpfen und ergriff meine Hand.
„Ich habe gestern Abend nachgedacht. Du bist nicht der Typ, der seine Familie in Angst und Schrecken versetzt.“
Ich seufzte. Wenigstens einer, der mir das nicht zutraut, dachte ich.
Markus fuhr nach einer Pause fort: „Allerdings habe ich keine Ahnung wo Du die ganze Zeit warst und was passiert ist.“
Ich überlegte und schaute zur Decke. Dann begann ich Markus ganz allgemein und ohne Einzelheiten zu erzählen, dass ich die meiste Zeit den Job als Pilot in Zaire gemacht hatte. Selbst dafür, wie ich nach Kenia gekommen war, fiel mir eine schlüssige Erklärung ein.
Markus war ziemlich beeindruckt, dass ich Pilot war und das lenkte sein Interesse von weiteren Einzelheiten über mein Leben im Camp weitgehend ab.
Nach mehr als einer Stunde kamen der Arzt und eine Schwester, um mir Blut abzunehmen. Ich hielt meinen Arm hin und fragte wie lange ich noch im Hospital bleiben müsse. Der Arzt meinte, dass es noch eine Woche dauern würde. Sie wollten sicher gehen, dass ich mir keine Tropenkrankheit eingefangen hatte, die meine Abwehrkräfte geschwächt haben könnte.
Markus hatte das Gespräch mitbekommen und meinte in Anspielung auf meinen Slang anschließend: „Man hört ganz deutlich, dass Du eine Weile mit Amerikanern zusammen warst.“
„Ja, kannst Du mir ruhig glauben“, reagierte ich trotzig.
Er lachte aber wurde bald wieder ernst.
„Willst Du mit Deinen Eltern telefonieren und ihnen sagen was los ist?“
Im ersten Moment wollte ich ja sagen aber dann verließ mich doch der Mut.
„Ich glaube das kann ich nicht“, sagte ich langsam. „Wenn ich nach allem was ich jetzt weiß die Stimme meiner Mutter oder meines Vaters höre, weiß ich nicht mehr was ich sagen soll. Ich glaube es ist besser wenn ich ihnen erst mal schreibe und versuche zu erklären … Wie weiß ich auch noch nicht aber beim Schreiben kann mich keiner unterbrechen, oder?“
Markus nickte.
„Kann ich verstehen. Versuche es so wie Du es für richtig hältst. Ich kann Dir jedenfalls versprechen, dass ein Brief sofort mit der Diplomatenpost nach Deutschland befördert wird.“
Ich bat ihn, mir einen Block und einen Umschlag zu besorgen und in dem Moment wo das Abendessen gebracht wurde, versprach er am nächsten Tag wiederzukommen und verabschiedete sich.
Nach dem Essen lag ich allein in dem kleinen Zimmer. Nur eine kleine Lampe spendete ein weiches Licht.
Nichts war so wie ich es mir vorgestellt hatte. Je mehr ich darüber nachdachte was in der Botschaft geschehen war, desto trostloser wurde meine Stimmung.
Bei dem Gedanken, dass meine Eltern, meine Brüder und zumindest mein bester Freund so lange in quälender Ungewissheit waren, bekam ich schreckliche Angst.
Was sollte ich Ihnen sagen? Wie erklären, dass ich keine Ahnung davon hatte? Konnte ich ihnen jemals wieder vor die Augen treten?
Am schlimmsten aber war der Gedanke, dass ich Norman die Briefe gegeben hatte, die nie angekommen waren. Norman, meine große Liebe. Norman, für den ich alles getan habe was ich konnte. Norman, dem ich bis zuletzt vertraut habe. Wie konnte er mir das antun?
Ich wehrte mich innerlich gegen die Vorstellung, die ganze Zeit nur sein Arbeitstier und Lustobjekt gewesen zu sein. Aber was war ich sonst für ihn? Ein Abenteuer in seiner sonst ziemlich eintönigen Zeit? Eine willkommene Abwechslung bis zu dem Zeitpunkt, wo er Kabunda für ein anderes Leben verlassen würde…?
Es tat so entsetzlich weh. Ich fühlte mich verraten, benutzt, abgrundtief gedemütigt und konnte nichts dagegen tun.
Mir liefen dicke Tränen über das Gesicht und dann begann ich zu schluchzen. Um nicht gehört zu werden vergrub ich mein Gesicht in das Kopfkissen und weinte mich in einen unruhigen Schlaf.
Am nächsten Vormittag kam Markus Lüders zu Besuch. Der Anblick seines mitgebrachten Briefpapiers ließ mich nichts Gutes ahnen.
Er setzte sich und schaute mich an.
„Na Micha, hast Du gut geschlafen?“
„Nein“, antwortete ich grimmig.
Sein Blick wurde strenger.
„Du bist schlecht gelaunt und hast nichts gefrühstückt“, stellte er fest.
Er hatte sich also bei der Stationsschwester erkundigt.
Nichts sagen war auch eine Antwort aber mir fiel nichts Besseres ein.
Markus seufzte leise.
„Was ist los? Du wolltest doch heute einen Brief an Deine Eltern schreiben.“
„Mann, weißt Du wie schwer das ist?“ versuchte ich ihm klarzumachen.
Er nickte.
„Ja das weiß ich. Aber ich weiß auch wie sehr Deine Eltern und Geschwister darauf warten. Der Botschafter hat mich schon gefragt, ob ich Deine Eltern angerufen hätte. Wenn Du nicht schreiben willst muss ich das heute tun aber ich fände es besser, wenn Du den ersten Schritt machst.“
Ich wäre jetzt am liebsten weggelaufen aber er hatte recht. Ich musste das tun – egal wie schwer es auch war.
In diesem Moment kam die Schwester und brachte ein Tablett. Markus nahm es und stellte es auf mein Bett.
„So, jetzt frühstücken wir erst einmal. Ohne etwas im Magen geht es natürlich nicht.“
Seine Worte erinnerten mich an Norman und deshalb tat ich was ich bei Norman auch getan hätte. Ich setzte mich auf und frühstückte. Aber diesmal mit Markus.
Seine lockere Unterhaltung lenkte mich ein wenig ab. Dadurch besserte sich auch meine Laune.
Ich hätte mich am liebsten noch weiter mit ihm unterhalten aber als der Kaffee ausgetrunken war, stand Markus auf und legte mir das Briefpapier auf das Bett.
Ich schaute ihn an und seufzte.
Mit einem aufmunternden Lächeln sprach er mit Mut zu. „Na los Micha, das schaffst Du schon. Ich komme heute Nachmittag und hole den Brief ab – okay?“
Ich nickte mit zusammengepressten Lippen und er ließ mich mit dem Schlamassel allein.
Mit Überwindung setzte ich mich an den Tisch. Wie um Zeit zu schinden, begann ich erst mal mit dem Briefumschlag, den ich wie ein Drittklässler in Schönschrift mit der Adresse meiner Eltern verzierte.
Jetzt war der Block dran – ohne Pardon.
Nach drei vergeblichen Anläufen, der Block hatte zum Glück 50 Blatt, versuchte ich noch einmal meine Gedanken zu sammeln und erinnerte mich an den Brief, den ich vor Weihnachten geschrieben hatte. Er sollte mein Vorbild sein.
„Hallo liebe Eltern, hallo meine Brüder,
es fällt mir nicht leicht, Euch heute diesen Brief zu schreiben. Ich habe es selber nicht geglaubt aber die acht oder neun Briefe, die ich Euch in den vergangenen zehn Monaten geschrieben habe, sind nicht bei Euch angekommen.
Ihr müsst mir glauben, dass ich das nicht geahnt habe. Mir ist nichts passiert bis ich hier in Nairobi in der deutschen Botschaft erfahren habe, dass ich als vermisst gemeldet bin.
Das hat mich so umgehauen, dass ich nach einem Kreislaufkollaps im Krankenhaus liege aber keine Sorge, ich bin nicht wirklich krank. Es tut mir entsetzlich leid, dass Ihr Euch so lange große Sorgen um mich gemacht habt.
Ich weiß nicht warum meine Briefe nicht angekommen sind. Ich habe immer geschrieben, dass es mir gut geht und was ich gemacht habe. Jetzt habe ich große Schuldgefühle und weiß nicht recht wie ich Euch unter die Augen treten soll. Das ist sehr schwer für mich aber ich kann wohl in einer Woche wieder nach Deutschland fliegen.
Ich habe in Lubumbashi einen Job als Pilot bekommen und der hat länger gedauert, als ich geplant hatte. Alles andere muss ich Euch später erzählen.
Markus Lüders von der Botschaft kümmert sich um mich und hat mir versprochen, dass dieser Brief mit der Diplomatenpost zu Euch kommen wird.
Ich frage mich immer wieder ob ich nach dem ganzen Kummer, den Ihr wegen mir erleiden musstet, wieder nach Hause kommen kann. Das belastet mich sehr und noch zwei Tage zuvor habe ich mich riesig darauf gefreut.
Ich melde mich sobald ich weiß, wann ich in Deutschland ankommen kann. Bitte verzeiht mir wenn Ihr könnt. Ich hab Euch sehr lieb wie die ganze Zeit über, wo ich sehr oft an Euch gedacht habe.
Ganz herzliche Grüße, bitte auch an Patrick
Euer Micha
Ich las den Brief drei oder vier Mal. Ganz zufrieden war ich damit nicht aber was Besseres fiel mir nicht ein.
Ich konnte es kaum erwarten bis Markus am Nachmittag endlich kam.
Als er sich auf den Stuhl gesetzt hatte, reichte ich ihm den Block mit meinem Brief.
„Warum hast Du ihn nicht in den Umschlag gesteckt?“ fragte er.
„Ich möchte Deinen Rat hören, ob ich das so lassen kann“, antwortete ich.
Markus las den Text und nickte anschließend.
„Ja Micha, Lass ihn so. Ich finde das hast Du gut gemacht. Wenn ich rechtzeitig zurück bin, kann er heute Abend noch im Flugzeug sein. Übrigens, ich habe mich erkundigt. Du kannst in vier Tagen mit der Lufthansa von hier nach Frankfurt fliegen.“
„In vier Tagen?“ Ich war überrascht aber irgendwie auch froh.
Markus wusste sogar die Ankunftszeit in Frankfurt und deshalb schrieb ich es noch unter meinen Brieftext bevor ich dem Umschlag verschloss.
Die nächsten Tage waren ein ständiger Wechsel zwischen Langeweile und Betriebsamkeit. Vormittags musste ich noch einige Untersuchungen über mich ergehen lassen und nachmittags kam Markus. Mal nahm er mich mit in die Stadt um ein Passfoto für meinen neuen Ausweis zu besorgen, mal brachte er mich zu einem Friseur, denn ich wollte bei meiner Ankunft einen ganz ordentlichen Eindruck machen.
Am Tag vor meiner Abreise brachte mich Markus in sein Büro in der Botschaft. Er sagte mir, dass mein Vater am Vormittag angerufen habe und wolle zu einer vereinbarten Zeit noch einmal anrufen, um mich sprechen zu können.
Ich war ziemlich aufgeregt.
Bei einer Tasse Tee starrte ich immer auf das schwarze Telefon auf einer Ecke des Schreibtischs.
Fast genau um vier Uhr klingelte es. Obwohl ich den Anruf erwartete, erschrak ich fast. Markus nahm den Hörer ab. „Hallo Herr Brunner. – Ja, Ihr Sohn ist jetzt hier, einen Moment bitte.“
Markus reichte mir den Hörer und ließ mich in seinem Büro allein.
„Hallo Paps, „ sagte ich und spürte wie mein Herz dabei klopfte.
„Hallo Micha, mein Junge. Bist Du es wirklich?“
Ich hatte das Gefühl, dass mein Vater auch ganz aufgeregt war.
„Ja Paps. Es tut mir so leid was passiert ist.“
„Du glaubst ja gar nicht was hier los war, als wir Deinen Brief gestern bekommen haben. Das Auswärtige Amt hat extra einen Fahrer damit zu uns geschickt. Wir sind so froh, dass Dir nichts passiert ist.“
Nach einem kurzen Wortwechsel übergab er den Hörer an meine Mutter. Ich hörte wie sie weinte, als sie meine Stimme gehört hatte. Sie versuchte es sich nicht anmerken zu lassen aber ich kannte sie ja und fand es ganz verständlich.
Ich hatte das Gefühl, dass meine Eltern überglücklich waren und es kaum erwarten konnten wenn ich morgen nach Hause kommen würde.
Ich war ziemlich erleichtert als ich den Hörer aufgelegt hatte.
Kurze Zeit später kam Markus wieder herein.
„Na, weißt Du jetzt wie sehr Deine Eltern auf Dich warten?“
„Ja“, gab ich zu.
„So, und jetzt wartet der Herr Botschafter auf Dich.“ Markus gab mir ein Zeichen ihm zu folgen.
In einem Seitenflügel folgte ich ihm in das Vorzimmer. Die Vorzimmerdame öffnete uns die Tür und Markus schob mich in ein geräumiges und edel eingerichtetes Büro.
„Darf ich Ihnen Herrn Michael Brunner vorstellen?“ fragte Markus.
Der Botschafter, ein älterer Herr, so um die sechzig in dunkelblauem Anzug, erhob sich und reichte mir die Hand.
„Guten Tag Herr Brunner. Es freut mich, dass es Ihnen wieder gut geht.“
Nach der Begrüßung bat er Markus und mich Platz zu nehmen.
Der Botschafter machte einen sehr sympathischen Eindruck auf mich.
„Wie ich hörte, hatten Sie bereits Kontakt zu Ihren Eltern?“
„Ja“, antwortete ich. „Sie sind sehr froh, dass ich morgen wieder nach Hause komme und ich freue mich auch schon darauf.“
Er schenkte mir ein wissendes Lächeln. „Hat Ihr Aufenthalt in Afrika abgesehen von dem aufgetretenen Missverständnis Ihren Vorstellungen entsprochen?“
Ich nickte. „Ja. Ich habe viel gesehen und viel gelernt. Ich glaube ich mag Afrika jetzt noch viel mehr als vorher.“
„Nun, das freut mich.“ Er griff in seine Schreibtischschublade, nahm einen Reisepass heraus und legte ihn aufgeklappt auf den Schreibtisch.
„Damit Sie nun wohlbehalten wieder nach Hause reisen können, übergebe ich Ihnen hiermit ein Ersatzdokument für Ihren gestohlenen Reisepass.“
Markus reichte mir einen Stift und zeigte mir wo ich den Pass und die Empfangsbescheinigung unterschreiben musste.
Der Botschafter erhob sich und reichte mir die Hand. „Herr Brunner, es hat mich gefreut Sie kennen gelernt zu haben, ich wünsche Ihnen einen guten Heimflug, alles Gute und richten Sie Ihren Eltern bitte meine herzlichen Grüße aus.“
Ich bedankte mich für den Pass, die Betreuung der letzten Tage und verabschiedete mich.
Auf dem Flur musste ich erst einmal kräftig durchatmen. Meinen neuen Pass verstaute ich sorgfältig in meinem Brustbeutel.
Auf dem Rückweg zum Hospital half mir Markus mit seiner Ortskenntnis noch ein paar afrikanische Souvenirs zu kaufen, die ich mit nach Hause nehmen wollte.
Am Abend packte ich meine Sachen und hatte Mühe den Rucksack zu schließen. Es war meine letzte Nacht in Afrika und ich war ziemlich aufgeregt. Vor dem Einschlafen gingen mir viele Dinge durch den Kopf. Vor allem dachte ich an Norman. Obwohl ich ihm die Sache mit den Briefen nicht verzeihen konnte, vermisste ich ihn. In den letzten Tagen hatte ich das Gefühl verdrängen können aber jetzt war es wieder da. Ich versuchte die Gedanken abzuschütteln aber es gelang mir nicht.
Schließlich bin ich doch eingeschlafen und wurde am sehr frühen Morgen von der Krankenschwester geweckt.
Ich war kaum mit dem Frühstück und Anziehen fertig, da kam auch schon Markus. Er hatte mir versprochen, mich zum Flughafen zu bringen.
Ich verabschiedete mich von den Krankenschwestern und verließ mit Markus das Hospital.
Die Fahrt zum Flughafen dauerte eine halbe Stunde. Es war noch dunkel und es herrschte kaum Verkehr. Wir unterhielten uns über seine und meine Pläne.
Am Flughafen suchten wir den Schalter der Lufthansa. Hier war mein Ticket hinterlegt. Es kostete umgerechnet 580 Dollar. Ich bezahlte und da ich noch eine Stunde Zeit hatte, tranken wir gemeinsam noch einen Tee.
Nach dem Aufruf der Maschine nach Frankfurt verabschiedete ich mich von ihm und bedankte mich. Er hatte sich um mich gekümmert wie um einen Freund.
Hinter der Ticketkontrolle drehte ich mich noch einmal um und wir winkten uns zu. Wenig später saß ich in einer riesigen DC 10, die mit mir um 6 Uhr 30 in den afrikanischen Himmel aufstieg.
Kapitel 7
Ich saß im hinteren Teil der nur mäßig besetzten Maschine am Fenster. Abgesehen von wenigen Quellwolken hatte ich eine gute Sicht auf die afrikanische Landschaft unter mir. Die Perspektive aus 10.000 Metern war aber längst nicht so reizvoll wie die von mir geflogenen Höhen zwischen 500 und 1.000 Metern.
Etwas wehmütig nahm ich Abschied von diesem großartigen Kontinent und versprach mir selbst, dass ich eines Tages wiederkommen werde.
Ich wurde jäh aus meinen Gedanken gerissen, als eine der Stewardessen das Mittagessen servierte.
Nach dem Essen spürte ich eine innere Unruhe. Wieder nach Hause zu kommen hatte ich mir so oft gewünscht aber was würde mich erwarten, nachdem ich so lange als vermisst gegolten hatte?
Noch ehe ich mir darüber weitere Gedanken machen konnte, stand die Stewardess erneut vor meiner Sitzreihe. „Herr Brunner?“
Etwas verwirrt darüber, dass sie offensichtlich meinen Namen kannte, drehte ich mich zu ihr um. Meine Reaktion war ein verwunderter Blick.
Sie lächelte freundlich. „Flugkapitän Fuchs Lässt fragen, ob Sie das Cockpit besuchen möchten.“
Auch damit hatte ich nicht gerechnet aber ich vermutete, dass Markus bei der Lufthansastation in Nairobi etwas eingefädelt hatte, um mich auf dem Flug etwas ablenken zu lassen.
„Ja gern“, sagte ich kurz entschlossen und schob mich langsam aus der Sitzreihe. Die Stewardess ging voraus und öffnete die Tür zum Cockpit.
„Hier ist Herr Brunner“, sagte sie und schob mich hinein.
Der Flugkapitän drehte sich zu mir um. „Ah, da ist ja unser junger Kollege.“
Mit einem freundlichen Blick reichte mir der etwa fünfzigjährige Kommandant der DC 10 die Hand. Zuerst stellte er sich und anschließend den Copiloten und den Flugingenieur vor.
Zuerst wollte er von meiner Fliegerei in Afrika wissen. Ich gab bereitwillig Auskunft und beschränkte mich dabei auf die Dinge, die für einen Piloten interessant sein konnten.
Schließlich sagte er an seine beiden jüngeren Kollegen gewandt: „Sehen Sie meine Herren, das nenne ich eine solide Grundlage für unseren Beruf.“
Das etwas gequält wirkende Lächeln der beiden war mir ziemlich peinlich.
Ich hatte den Eindruck, dass mich der Flugkapitän am liebsten gleich bei der Flugschule seiner Fluggesellschaft abgeliefert hätte aber ich zog mich damit aus der Affäre, dass ich erst einmal studieren wollte.
Nun erklärte er mir die Besonderheiten im Cockpit seiner DC 10. Das interessierte mich natürlich und allmählich näherten wir uns bereits den Alpen.
Entgegen der üblichen Gepflogenheiten bot mir der Flugkapitän den Notsitz hinter ihm an, um während des Landeanfluges auf Frankfurt im Cockpit bleiben zu können.
Das ließ ich mir natürlich nicht zweimal sagen und beobachtete das Team mit großem Interesse bis die Triebwerke an der Abstellposition abgeschaltet wurden.
Ich wollte mich nun bedanken und verabschieden aber er verwickelte mich noch in ein Gespräch bis die Crew das Flugzeug verließ.
Als ich meinen Rucksack aus dem Gepäckfach holte, waren sämtliche Passagiere bereits ausgestiegen und ich machte mich eilig auf den Weg zum Ausgang, wo der Kapitän und zwei Männer in graugrünen Uniformen standen, denen ich wiederum vorgestellt wurde.
Ich bekam zunächst einen Schreck aber dann wollten sie nur meinen Pass sehen und wünschten mir eine gute Weiterreise.
Als ich mich auf der Flugzeugtreppe umschaute, traf mich fast der Schlag. Unter der riesigen Tragfläche der DC 10 parkte die kleine rot-weiße Maschine meines Fliegerclubs, mit der meine Afrikareise begonnen hatte und neben ihr stand mein bester Freund Patrick.
Nachdem ich einen Augenblick ungläubig stehen geblieben war, stürmte ich die Treppe hinunter, ließ meinen Rucksack auf das Vorfeld fallen und begrüßte Patrick mit einer festen Umarmung.
Ich war von der Begrüßung so gerührt, dass ich mir erst einmal ein paar Tränen aus den Augen wischen musste, bevor ich etwas sagen konnte.
„Patrick, wie kommst Du denn hierher?“ waren meine ersten Worte.
Er schmunzelte. „Ich hab Dich damals weggebracht und da muss ich Dich doch auch wieder abholen, oder?“
Ich deutete auf die ungewöhnliche Parkposition. „Wie hast Du das nur geschafft?“
Ich sah sein typisches Grinsen und Schulterzucken. „Beziehungen eben. Mein Chef war ein Studienkollege des Flughafendirektors.“
Dieser Patrick, dachte ich. Er war immer schon ein Organisationstalent und für diese Überraschung würde ich ihm wohl für ewig dankbar sein.
Er verstaute meinen Rucksack auf den Rücksitzen und fragte ob ich selbst nach Hause fliegen wollte.
Ich war aber so aufgewühlt, dass ich ihn bat zu fliegen.
Routiniert manövrierte Patrick die kleine Maschine auf dem Labyrinth von Rollwegen zur Startbahn. Bis zum Verlassen des Frankfurter Luftraums war er mit dem Sprechfunk beschäftigt. Erst jetzt hatten wir Gelegenheit ein paar Worte zu wechseln.
„Wie geht’s Dir, alter Junge?“ wollte er wissen.
„Ach weißt Du, das ist alles eine lange Geschichte. Und wie ist es bei Dir? Fliegst Du schon?“
Patrick nickte. Wir waren uns einig, dass wir uns sehr viel zu erzählen hatten.
Um mich ein wenig auf meine Ankunft vorzubereiten fragte ich: „Weißt Du wie es meinen Eltern geht?“
Patrick nickte. „Es war eine ziemlich schwierige Zeit für sie aber seit sie von Dir gehört haben, sind sie ganz aus den Häuschen.“
Ich seufzte hörbar und er klopfte mir auf die Schulter. „Keine Sorge, sie werden Dir sicher nicht den Kopf abreißen. Deine Familie wartet am Flugplatz und freut sich auf Dich.“
„Du Patrick? Kannst Du heute Abend zu mir kommen?“
„Ja aber ich will nicht, dass Deine Familie zu kurz kommt.“
Ich schaute ihn bittend an. „Es gibt ein paar Dinge über die ich vorerst nur mir Dir reden kann.“
„Okay, aber erst nach dem Abendessen so gegen acht“, meinte Patrick.
Da auf dem kleinen Flugplatz meist nur am Wochenende geflogen wird, waren wir das einzige Flugzeug und nach der Landung sah ich nur meine Eltern und meine Brüder am Zaun stehen.
„Bis später“, verabschiedete ich mich von Patrick als er den Motor abstellte und hob meinen Rucksack, um möglichst schnell auszusteigen.
Ich ließ die dramatische Begrüßung einer weinenden Mutter, eines sichtlich ergriffenen Vaters und meiner erwartungshungrigen Brüder geduldig über mich ergehen und war selbst ziemlich gerührt von diesem Augenblick.
„Kommt, lasst uns erst einmal nach Hause fahren“, bestimmte Dad und wir folgten ihm zum Wagen.
Hinten zwischen meinen Brüdern sitzend, wurde ich sofort mit tausend Fragen bedrängt. Zum Glück halfen mir meine Eltern und mahnten zu mehr Geduld.
Meine Brüder waren gewachsen. Das war mir ebenso aufgefallen wie eine Reihe neuer Häuser, die das Bild meines Heimatortes verändert hatten.
Als wir zuhause ankamen, war es fünf Uhr nachmittags. Deshalb gab es zuerst Kaffee und Kuchen. Meine Mutter war noch immer ganz aufgeregt.
„Geht es Dir wirklich gut und bist Du gesund?“ wollte sie wissen.
Ich schaute an mir herunter. „Sehe ich unterernährt oder krank aus?“
„Ach Junge, ich hab mir doch solche Sorgen um Dich gemacht.“
So war sie, meine Mam. Bevor ihr wieder Tränen kamen, umarmte ich sie und das tat uns beiden gut.
Am Kaffeetisch war es erst einmal still. Dad hatte meinen Brüdern mit strengem Blick Ruhe verordnet und so bedrängte mich niemand.
Schließlich begann ich von selbst zu erzählen und schilderte in groben Zügen wo ich gewesen war und was ich erlebt hatte. Natürlich beschränkte ich mich dabei auf das Wesentliche und klammerte auch meine besondere Beziehung zu Norman aus. Zu einem Coming Out war ich in diesem Moment noch nicht fähig.
Wir saßen lange zusammen bis meine Mutter begann, das Abendessen vorzubereiten.
Ich ging in mein Zimmer und fand es genauso vor, wie ich es vor etwa elf Monaten verlassen hatte. Es war ein komisches Gefühl, mich wieder auf mein Bett zu setzen. Nach einer Weile packte ich meinen Rucksack aus. Den besten meiner dunkelblauen Overalls hing ich auf einem Kleiderbügel an die Wand und stellte meine Pilotenstiefel davor. Daneben befestigte ich meine ziemlich zerfledderte Fliegerkarte mit Reißzwecken und legte das Heft mit meinen Flugbucheintragungen auf ein benachbartes Regal. Das war mir wichtig und diese Dinge sollten in meinem Reich einen festen Platz haben.
Vor dem Abendessen verteilte ich die mitgebrachten Souvenirs und dann gab es mein Leibgericht, Königsberger Klopse.
Nach dem Essen kamen die ersten konkreten Fragen. Ich beantwortete sie so gut es ging aber es war uns allen klar, dass es in den nächsten Tagen noch viel Gesprächsstoff geben würde.
Um kurz vor acht schaute ich auf die Uhr. „Seid ihr mir böse wenn ich mich gleich in mein Zimmer zurückziehe? Ich habe Patrick eingeladen.“
„Nein“, sagte mein Vater. „Redet ihr zwei Mal ausführlich. Patrick ist ja eine ganz treue Seele.“
„Ja“, bestätigte meine Mutter. „Er hat jede Woche angerufen und nach Dir gefragt.“
Wenig später klingelte es und ich zog mich mit Patrick, einer Kanne Tee und einer Flasche Rotwein in mein Zimmer zurück.
Natürlich entdeckte er sofort was ich dort ausgestellt hatte und bewunderte zuerst meine Fliegerklamotten.
„Und da bist Du geflogen?“ Er studierte jetzt die Karte an der Wand.
Ich reichte ihm das Heft. „Das ist mein Flugbuch. Du hast sicher ein schöneres.“
Er nahm es, setzte sich in den Sessel und blätterte es interessiert durch. Dabei bekam er ganz große Augen. „Über 1.600 Stunden bist Du geflogen? Das ist ja Wahnsinn.“
Ich reichte ihm einen Wasserbehälter aus Aluminium und einen Kaffeebecher aus Blech. „Das habe ich Dir mitgebracht. War mein Bordgeschirr.“
Er schaute mich ungläubig an.
Ich hatte das gleiche noch einmal für mich und so füllte ich die beiden Becher mit Tee.
„Cheers“, sagte ich und wir stießen mit den Bechern an.
Patrick legte mein Flugbuch auf den Tisch. „Das muss ich mir bei Gelegenheit mal näher anschauen.“
Jetzt begann ich zu erzählen und diesmal ließ ich nichts weg. Patrick hörte mir gespannt zu und unterbrach mich kein einziges Mal. Als ich ihm die ganze Wahrheit erzählt hatte, waren fast drei Stunden vergangen.
Ich war ziemlich aufgewühlt aber trotzdem erleichtert. Er kannte jetzt meine total verzwickte Gefühlslage, insbesondere was Norman betraf.
Patrick wusste wie mir zumute war. Er stand auf, setzte sich neben mich auf das kleine Sofa und legte mir einen Arm auf die Schulter.
„Armer Micha, das hast Du nicht verdient“, sagte er leise. „Nicht Du. Nicht mein bester Freund.“
Ich legte meinen Kopf an seine Schulter. Es war so gut, dass er da war und mich tröstete. Ich musste mich auch nicht schämen, dass ich jetzt weinte.
Patrick hielt mich fest.
„Oh Micha, dass Du da abgehauen bist war sehr mutig aber es war richtig und das beste was Du machen konntest. Du musst jetzt versuchen ihn zu vergessen.Es ist zwar nicht leicht aber ich und alle Deine Freunde werden Dir dabei helfen. Du findest bestimmt eine neue Liebe, da bin ich mir ganz sicher.“
Langsam beruhigte ich mich wieder und schenkte uns beiden Rotwein in die Becher.
„Weißt Du, in Nairobi im Krankenhaus wollte ich ihn hassen aber das ging irgendwie nicht. Ich muss immer wieder an ihn denken und jedes Mal ist das Gefühl, dass er mir fehlt, stärker als alles andere.“
Patrick nahm einen Schluck Rotwein. „Micha ich kenne Dich verdammt gut. Du bist eine ehrliche Haut und deshalb ist Deine Liebe so stark. Wenn ich auch auf Jungs stehen würde, würde ich alles dafür tun um Dich zu kriegen.“
Jetzt musste ich ein wenig lachen.
„Danke Patrick aber es ist nun mal nicht so und im Übrigen möchte ich auf so eine Freundschaft wie wir sie haben nicht verzichten.“
„Ja, da hast Du recht,“ pflichtete mir Patrick bei, „aber mal was anderes. Wirst Du deinen Eltern von Deiner Beziehung zu Norman erzählen?“
Jetzt kam er an den Punkt, wo ich auch seinen Rat brauchte.
„Ich weiß nicht wie lange ich das ertragen kann wenn ich es nicht tue aber ehrlich gesagt, habe ich auch etwas Angst davor. Was würdest Du an meiner Stelle tun?“
„Hmm“, meinte Patrick. „So wie ich Deine Eltern kenne, werden sie es schon verkraften und zu Dir halten. Ich glaube ich würde es tun.“
Ich bedankte mich für seinen Rat und dann wollte ich auch wissen wie es ihm in der Zeit ergangen war.
Er erzählte mir von seiner Pilotenausbildung bei den Transportfliegern, die ihm Spaß mache und dass er im Herbst für einige Monate zum Training nach Kanada gehen würde. Außerdem erfuhr ich, dass er seit einem halben Jahr eine feste Freundin hat und mit ihr zusammen in der Einliegerwohnung seines Elternhauses wohnt.
Letzteres war eine echte Neuigkeit für mich. Patrick also in festen Händen. Hoffentlich hatte er mehr Glück damit wie ich.
„Kenne ich sie?“ fragte ich voller Neugier.
„Ich glaube eher nicht. Sie heißt Cornelia und stammt nicht direkt von hier. Komm uns am Wochenende besuchen. Ihr werdet Euch bestimmt gut verstehen.“
Um kurz vor zwei Uhr in der Nacht machte sich Patrick auf den Heimweg. Es war ein langer Abend aber er war mir sehr sehr wichtig.
Am nächsten Morgen schlief ich lange und am Nachmittag stellte ich mich wie versprochen den Fragen meiner Brüder. Sie waren einfach neugierig und wollten wissen was ich alles gesehen hatte.
Am Abend saß ich dann mit meinen Eltern allein im Wohnzimmer. Auch sie wollten etwas mehr wissen und mir war klar, dass wenn ich mich outen würde, dann müsste es jetzt sein.
Ich war ziemlich nervös und meine Mutter merkte das. „Was ist los mein Junge? Warum bist Du so unruhig?“
Ich nahm all meinen Mut zusammen. „Mam, Dad, ich war immer ehrlich zu Euch und das will ich auch bleiben. Ich muss Euch deshalb etwas sagen was mir sehr schwer fällt weil Ihr vielleicht enttäuscht von mir sein werdet.“
Mein Vater schaute mich fragend an. „Machs nicht so spannend Micha. Hat es was mit den Briefen zutun, die nicht angekommen sind?“
Ich schüttelte den Kopf. „Nein Dad. Die habe ich wirklich geschrieben. Es ist nur…, ich habe mich in Kabunda richtig verliebt.“
Meine Eltern schauten erst gegenseitig sich und dann mich an. Bevor einer etwas sagen konnte fuhr ich fort: „Ich habe mich in Norman verliebt, mit dem ich die ganze Zeit zusammen war. Es tut mir leid aber Euer ältester Sohn ist schwul.“
Jetzt war es heraus und ich wagte nicht meine Eltern anzusehen. Die Zeit in der niemand etwas sagte erschien mir quälend lang. Als erster ergriff mein Vater das Wort: „Micha, das waren vielleicht nur die besonderen Umstände weil Du keinen Kontakt zu Mädchen hattest.“
Ich schüttelte den Kopf. „Nein Dad, das war schon vorher so. Ich weiß es schon mindestens seit drei Jahren.“
Jetzt war wieder eine Pause.
„Und? War dieser Norman auch …?“ er sprach dieses Wort nicht aus.
„Ja Dad. Wir hatten eine sehr glückliche Zeit miteinander und ich vermisse ihn sehr.“
„Hast Du gestern Abend mit Patrick darüber gesprochen?“ wollte meine Mutter wissen.
„Ja Mam. Patrick ist mein bester Freund und er weiß es auch schon lange. Vielleicht hätte ich es Euch schon früher erzählen sollen aber da war ich noch nie richtig verliebt.“
dass mein Vater jetzt aufstand und in die Küche ging, irritierte mich ziemlich. Meine Mutter ergriff hingegen beruhigend meine Hand und drückte sie.
Als mein Vater kurze Zeit später zurückkam, hatte er nicht meine Jacke in der Hand um mich hinauszuwerfen, sondern er brachte drei gut gefüllte Cognacschwenker und verteilte sie mit den Worten: „Ich glaube jetzt brauchen wir drei erst mal einen Schnaps.“
Egal was er dachte, in einem hatte ich mich nicht getäuscht. Meinen Dad haute so leicht nichts um. Bevor er aber das Glas erhob sagte er: „In einem waren Deine Mutter und ich immer einig. Wir wollten und wollen alles dafür tun, dass unsere Kinder Vertrauen zu uns haben und das scheint uns zumindest bei unserem Ältesten gelungen zu sein, nicht wahr Frau Brunner?“
Auch meine Mutter schien erleichtert und mit diesem Schluck Cognac war das Gröbste überstanden. Mir fiel eine zentnerschwere Last von der Seele.
„Danke Dad“, sagte ich anschließend.
Er schaute mich prüfend an. „Moment mein Sohn. Freue Dich nicht zu früh. Es fällt mir nicht leicht, Dein Bekenntnis zu akzeptieren aber ich werde mich bemühen. Dafür musst Du mir versprechen, dass Du nicht Händchen haltend oder knutschend mit einem Mann durch Deinen Heimatort gehst.“
Jetzt musste ich schmunzeln. „Okay Dad, das verspreche ich gerne und ich werde auch kein Handtäschchen tragen oder was sonst noch so in diesen blöden Witzen erzählt wird.“
So, jetzt war dieser Teil erledigt und ich konnte das, was sie interessierte so erzählen wie es wirklich war.
Viel später in meinem Bett war ich sehr stolz auf meine Eltern. Trotz allem, was sie wegen mir durchgemacht haben mussten und heute von mir erfahren hatten, war und blieb ich ihr geliebter Sohn. Ich hatte allen Grund zufrieden zu sein aber etwas fehlte zu meinem Glück und das war der, den ich noch immer über alles liebte.
Am Samstagnachmittag ging ich wie verabredet zu Patrick und klingelte an der Wohnung im Erdgeschoß. Ich muss wohl etwas überrascht geschaut haben, als mir Patricks Freundin öffnete. Sie lachte mich freundlich an und sagte spontan: „Hallo Micha, ich bin die Conny. Komm doch rein.“
Sie war etwa so groß wie ich, schlank, hübsch mit langen dunklen und leicht gewellten Haaren.
„Wieso hast Du mich gleich erkannt?“ wollte ich wissen.
„Erstens habe ich außer Dir niemanden erwartet und zweitens hat mir Patrick schon Fotos gezeigt und jede Menge von Dir erzählt“, antwortete sie lächelnd und bat mich ins Wohnzimmer.
Da ich die Wohnung noch nicht kannte, schaute ich mich kurz um. Die Einrichtung war hell, freundlich und trotzdem gemütlich. Es gefiel mir und das sagte ich auch gleich.
Conny erklärte mir, dass Patrick noch kurz zum Flugplatz gefahren sei und auf dem Rückweg Kuchen mitbringen würde. In der Zwischenzeit setzte sie sich zu mir in die Sitzgruppe und begann eine nette Unterhaltung zum ersten Kennenlernen.
Irgendwie war mir Conny sofort sympathisch. Sie war so natürlich, nett und aufgeschlossen. Man konnte das Gefühl haben, als würde sie mich schon lange kennen.
Wenig später kam Patrick und nach dem Kaffeetrinken ließ uns Conny allein. Ich hatte mein Flugbuch und die Karte mitgebracht, denn Patrick war ganz heiß darauf alles über meine Fliegerei zu erfahren.
Dabei vergaßen wir die Zeit bis uns Conny schließlich zum Abendessen in die Küche bat.
Es roch sehr gut und es gab Schweinelenden in Rotweinsoße, Kartoffeln und Rotkohl.
„Hmm, gut kochen kannst Du wohl auch“, sagte ich anerkennend.
Conny bedankte sich für das Kompliment und Patrick lachte. „Wenn’s ums Kochen geht darfst Du dich mit Micha nicht anlegen. Da kann man leicht den kürzeren ziehen.“
„Ach wirklich?“ gab sich Conny erstaunt. „Dann kannst Du uns ja mal was Afrikanisches kochen.“
„Ja, wenn Du mir verrätst wo ich hier Impala-Steaks, Maniok, und entsprechende Gewürze kriege, kein Problem“, gab ich zurück.
Damit hatten wir aber ein Thema und bei meinen Berichten über das Essen in Afrika kam ich zwangsläufig zu den schönen Grillabenden auf dem Hügel. Ich erzählte von den schönen Erlebnissen mit Norman und war am Ende sehr traurig.
„Was ist los? Warum bist Du plötzlich so still?“ fragte Conny.
Patrick schaute zu mir und sagte: „Micha hat ziemlichen Liebeskummer, stimmt‘s? Tut es immer noch so weh?“
Ich nickte.
Conny schaute mitfühlend. „Was haltet Ihr davon, wenn wir nachher in eine Disco fahren. Das lenkt ein bisschen ab und es gibt vielleicht noch andere Jungs…“
„Ich will keine anderen Jungs“, sagte ich entschieden. „Ich glaube ich gehe besser nach Hause und vermiese Euch nicht den Abend.“
„Tut mir leid Micha. Das mit den Jungs habe ich nicht so gemeint, “ entschuldigte sich Conny sofort.
„Ja ich weiß. Mach Dir deshalb keine Sorgen. Ich glaube ich kann die Musik und die vielen Leute noch nicht ertragen und ich will gerne noch ein bisschen alleine sein, “ erklärte ich.
„Bist Du sicher? Wir können auch gerne hier bleiben, “ bot Patrick an.
Ich bemühte mich zu lächeln. „Genießt Euer Wochenende und danke für alles.“
Mit einem kleinen Umweg ging ich nach Hause und verkroch mich leise in mein Zimmer.
Auch in den nächsten Tagen blieb ich die meiste Zeit dort. Ich hatte nicht vermutet, dass es mir so schwer fallen würde, mich wieder an das Leben in Deutschland zu gewöhnen. Statt nach draußen zu gehen, was mir in Kabunda oft gefehlt hatte, las ich in meinen Afrika-Büchern und träumte vor mich hin. Ich dachte an Sam, an Jason, an die Farm und immer wieder an Norman. Meine Sehnsucht nach ihm machte mich fast krank aber ich sprach nicht darüber.
Meine Eltern versuchten zaghaft mich aufzumuntern aber zum Glück gingen sie mir nicht permanent auf die Nerven.
Am Wochenende kam Patrick zu mir und wollte mich abholen und zum Flugplatz fahren. Ich wollte nicht, obwohl er alles versuchte um mir gut zuzureden.
Am Abend kam er noch mal vorbei.
„Micha, unsere Vereinskameraden warten auf Dich. Sie möchten dass Du wiederkommst und sie möchten gerne von Dir hören was Du als Pilot in Afrika erlebt hast, “ beschwor er mich.
„Bitte Patrick, lasst mir noch etwas Zeit. Ich kann das noch nicht.“
Er setzte sich neben mich und legte eine Hand auf meine Schulter. „Und das alles wegen Norman? Der Typ der sich so verhalten hat, dass Du von selber abgehauen bist? Micha – wach endlich auf! Das bringt doch alles nichts.“
Ich fühlte mich jetzt bedrängt und rutschte von ihm weg. „Das verstehst Du nicht. Lass mich doch – bitte.“
Patrick seufzte laut. „Okay Micha. Fünfzehn Jahre lang haben wir uns prima verstanden. Wir haben uns alles gesagt. Einer hat dem anderen geholfen und jetzt auf einmal soll ich Dich nicht mehr verstehen?“
„Offensichtlich nicht“, sagte ich trotzig.
Patrick sprang auf. Er hatte Mühe sich unter Kontrolle zu halten. „Mann, ich will Dir helfen aber Dir ist nicht zu helfen.“ Seine Stimme bebte. „Von mir aus mauer Dich doch ein in Deinem Zimmer – und keine Angst, ich werde Dich nicht mehr stören!“
Mit diesen Worten verließ er mein Zimmer und schlug wutentbrannt die Tür von außen zu.
Rums, das hatte gesessen. Ich zuckte zusammen und hatte Patrick noch nie so wütend erlebt. Was hatte ich ihm denn getan?
War es zu viel verlangt, dass ich meine Ruhe haben wollte, zumindest noch eine Zeit lang? Ich wusste es nicht aber sein Abgang tat mir schon ziemlich weh.
Nach dem Abendessen fragte mich meine Mutter: „Hattest Du vorhin Streit mit Patrick?“
Ich nickte. Es war mir unangenehm, dass es offensichtlich im ganzen Haus zu hören war.
Sie schaute mir in die Augen. „Du, ich will mich ja nicht einmischen aber tue ihm bitte nicht unrecht. Du bedeutest ihm sehr viel. Als Du weg warst hat er immer wieder gesagt, der Micha ist clever, der Lässt sich nicht unterkriegen. Egal was passiert ist, der kommt wieder, das weiß ich weil ich ihn kenne. Das hat er mehr als einmal gesagt und uns Mut gemacht. Manchmal glaube ich er kennt Dich besser als ich, jedenfalls hat er recht gehabt.“
„Sag mal Mam, bin ich im Moment sehr schwierig?“ erkundigte ich mich vorsichtig.
„Schwierig ist nicht das richtige Wort“, sagte sie ruhig. „Du kapselst Dich ab, Lässt keinen an Dich heran, bist anders als früher und das macht uns ein bisschen Sorge.“
“Dann stimmt es vielleicht doch, “ dachte ich laut.
„Was denn?“ hakte Mutter nach.
„Ach Patrick hat mir vorhin ein paar unangenehme Wahrheiten gesagt. Das muss ich erst mal verdauen.“
Den ganzen Abend dachte ich darüber nach, was Patrick gesagt und mir zum Teil an den Kopf geschleudert hatte. Ich kannte ihn schließlich auch so gut wie kein anderer und ich hatte keinen Zweifel, dass er mich niemals bewusst verletzen würde.
Okay, er hatte ja recht. Mich selbst einzusperren war keine Lösung und das andere, war auch nicht so verkehrt.
Allerdings hatte er mich ganz schön niedergemacht aber hätte ich ihm zugehört, wenn er mir dabei auf die Schulter geklopft hätte?
Es ist wohl wie bei einer Spritze. Die tut auch erst weh bevor sie hilft.
Ich konnte die ganze Nacht kaum schlafen und machte mir Sorgen wie ich den Krach zwischen Patrick und mir wieder glätten konnte.
Am Sonntag nach dem Frühstück überwand ich mich bei ihm anzurufen. Conny war am Apparat.
„Hallo Conny, ist Patrick da?
„Nein, er ist auf dem Flugplatz.“
„Hm, ist er sehr sauer auf mich?“
„Also, er hat nicht darüber gesprochen aber wenn Du mich fragst, er ist nicht besonders gut drauf.“
„Ist wohl meine Schuld, tut mir leid. Ich muss mit ihm reden. Kann ich später mal vorbeikommen?“
„Ja, am besten so um halb vier zum Kaffee. Er fährt erst heute Abend in die Kaserne.“
„Danke Conny und – sage ihm bitte nicht, dass ich angerufen habe.“
Jetzt musste ich also noch fünf Stunden warten und um die zu überbrücken, ging ich nach dem Mittagessen im Wald spazieren. Die frische Luft tat mir gut aber den leichten Druck in der Magengegend wurde ich damit auch nicht los.
Als ich gegen halb vier vor der Haustür stand, holte ich erst mal tief Luft und klingelte. Ich kam mir ziemlich klein vor, als Patrick die Tür öffnete.
„Darf ich reinkommen?“ fragte ich reumütig.
„Ja“, antwortete er knapp.
Wir blieben im Flur stehen.
„Bitte Patrick, sag mir wo Canossa ist. Ich will dahingehen und Dich um Verzeihung bitten.“
„Canossa ist hier“, sagte er und deutete in das Wohnzimmer.
Ich setzte mich und schaute ihn vorsichtig an. „Ich – ich hab mich blöd benommen und will mich bei Dir entschuldigen.“
Patrick verzog keine Miene. „Ach, gibt es bei Dir irgendwelche neuen Erkenntnisse?“
Er weidete meine Reue sichtlich aus aber was blieb mir übrig?
„Ja, du hast recht mit allem was Du mir an den Kopf geworfen hast. Ich hab die ganze Nacht nicht geschlafen und darüber nachgedacht.“
„Gut – sehr gut sogar“, sagte Patrick mit einer Spur von Schadenfreude. „Dann bin ich ja wenigstens nicht der einzige, der deswegen schlecht geschlafen hat.“
Warum ließ er mich bloß so hängen? Ich bekam fast Panik weil er keine positive Reaktion zeigte.
„Es tut mir wirklich leid und ich hoffe, dass Du mir verzeihst“, sagte ich und stand auf, um zu gehen.
Patrick reagierte blitzschnell und stellte sich mir in dem Weg. „Warte Micha. Glaubst Du im Ernst, dass ich Dich jetzt so gehen lasse?“ Mit einem verschmitzten Grinsen breitete er die Arme aus.
Ich schluckte. „Du willst mich wohl heulen sehen, was?“
Er umarmte mich jetzt wirklich. „Nein das will ich nicht. Ich wollte nur sehen, ob Du das ernst meinst was Du gesagt hast.“
„Und – was glaubst Du? Würde ich meinen besten Freund belügen?“ Ich war fast ein bisschen beleidigt.
„Nein, nein, nein“, wiegelte er ab. „Wir haben nur gerade unseren ersten richtigen Streit begraben.“
Wir schauten uns kurz an uns dann mussten wir beide lachen.
„Und was ist am nächsten Samstag? Kommst Du mit zum Flugplatz?“ wollte er wissen.
„Ja“, sagte ich, „die sollen ruhig mal hören, dass Fliegen auch harte Arbeit sein kann.“
Patrick lächelte zufrieden. „Na dann komm mit in die Küche. Conny wartet schon mit dem Kaffee auf uns.“
In der nächsten Woche wagte ich mich tatsächlich nach draußen. Die meisten Leute im Dorf begrüßten mich sehr freundlich und ich ertrug ihre Fragen mit stoischer Gelassenheit. Abends war ich dann ziemlich erschöpft.
Ich musste zugeben, dass Patrick recht hatte. Ich kam nicht mehr so oft zum Nachdenken und insgesamt ging es mir besser.
Am Donnerstag fuhr ich sogar nach Köln, um meine ersten Fühler nach einem Studienplatz auszustrecken. Dabei nutzte ich die Gelegenheit im Funkhaus hereinzuschauen.
Ich musste feststellen, dass inzwischen einige neue Leute dort tätig waren aber ich traf auch den zuständigen Sendeleiter. Der war immer noch der gleiche und er freute sich über meinen spontanen Besuch.
Nicht sofort aber in den Ferien stellte er mir eine Möglichkeit in Aussicht, wieder meine alte Tätigkeit im Radio aufnehmen zu können.
Ich kam relativ zufrieden wieder nach Hause.
Am Freitagnachmittag erschien Patrick. Er hatte einen Bekannten ausfindig gemacht, der in seiner Firma Fotokopien auf Folien machen konnte. Das war damals noch total neu und ich wusste gar nicht, dass es so was gab.
Patrick meinte, das wäre ideal für meinen Vortrag. Wir sollten die interessantesten Seiten aus meinem Flugbuch und Ausschnitte der Karte auf Folien kopieren lassen und uns einen Projektor dafür ausleihen. Außerdem wäre eine große Afrika-Karte aus der Schule ganz hilfreich.
Er war eben das geborene Organisationstalent und so schleppte er mich gleich mit, um alles zu erledigen.
Am Samstag gab es für mich kein Entrinnen. Patrick holte mich am Mittag ab und fuhr mit mir zum Flugplatz. Das große Hallo war mir fast peinlich aber ich war einer der Aktiven und nach langer Zeit endlich wieder da. Sie drängten mich fast ins Flugzeug und ehrlich gesagt, ich war ganz heiß darauf wieder zu fliegen.
Am Abend wurde wie üblich draußen gegrillt und dann versammelten sich alle im Clubhaus. Es waren viele da. Einige neue Mitglieder kannte ich noch nicht aber es waren auch welche dabei, die schon damals nur noch selten gekommen waren.
Patrick hatte alles vorbereitet und übernahm die Einleitung.
„Ja liebe Freunde, Ihr habt ja gesehen, unser Fliegerkollege Micha ist wieder da. Na ja, Ihr wisst ja, dass er mein bester Freund ist und deshalb hat er mirschon viel von seiner Afrika-Reise erzählt. Dass er da ziemlich bald zum Buschpiloten geworden ist, hätte wohl keiner für möglich gehalten. Als ich dann aber sein Flugbuch gesehen habe, wollte ich es kaum glauben. Über 1.600 Flugstunden hat er in nur etwas mehr als zehn Monaten gemacht. Das ist viel mehr als mancher von uns in seinem ganzen Leben zusammenbringt. Okay, mit was und unter welchen Bedingungen er das geflogen hat, soll er Euch lieber selbst erzählen. Komm Micha, jetzt bist Du dran.“
Unter allgemeinem Beifall nach vorne zu gehen war schon ein etwas mulmiges Gefühl für mich aber reden konnte ich ja ganz gut.
Ich berichtete also über meine Fliegererlebnisse und was man sonst noch dazu wissen musste. Dank der Karte und der Folien konnte ich das relativ gut nachvollziehbar darstellen. Obwohl ich private Details aussparte, dauerte mein Vortrag fast zwei Stunden und es war die ganze Zeit über eine gespannte Aufmerksamkeit zu spüren.
Als ich zum Ende gekommen war, bekam ich sehr viel Beifall und einige hatte ich sehr nachdenklich gemacht.
Patrick holte mich an seinen Tisch wo auch meine besten Kumpels saßen und reichte mir eine Flasche Bier. Er zwinkerte mir zu und das sollte heißen, dass ich meine Sache gut gemacht hatte.
Es wurde noch ein schöner Abend und allmählich fühlte ich mich bei meinen Fliegerkollegen wieder heimisch.
Bis zum Beginn meines Studiums waren noch drei Monate Zeit. Einen kleinen Job beim Radio hatte ich in Aussicht und ein oder zweimal pro Woche erledigte ich Reklameflüge für eine Bekannte, die große Plakatbanner für verschiedenste Firmen herstellte, welche zu bestimmten Zeiten irgendwo durch die Luft gezogen werden sollten. Damit verdiente ich etwas Geld und das brauchte ich dringend weil ich auf keinen Fall meinen Eltern auf der Tasche liegen wollte.
In der übrigen Zeit ging ich oft durch die Wälder der bergigen Landschaft meines Heimatortes. Ich mochte die Ruhe und die Stimmung der Natur mehr denn je. Es gab einige Stellen mit guter Aussicht, wo ich mich stundenlang hinsetzten und träumen konnte.
Besonders eine Stelle am oberen Teil eines Berghanges hatte es mir angetan. Dort hatte man bei gutem Wetter eine sehr weite Sicht. Diese Aussicht erinnerte mich sehr an den Hügel im Camp von Kabunda.
Manchmal ertappte ich mich dabei, dass ich mich umdrehte, um nach Norman zu sehen.
Ich zwang mich dann aufzubrechen und hoffte, dass diese tiefe Sehnsucht in mir irgendwann einmal nachlassen würde.
Etwa zwei Wochen später saß ich in meinem Zimmer und Las ein Buch. Draußen regnete es in Strömen. Ganz am Rande nahm ich wahr, dass es geklingelt hatte und später rief mich meine Mutter.
Etwas widerwillig legte ich das Buch zur Seite, ging zur Tür und rief nach unten: „Ja Mam, was gibt’s?“
„Post für Dich, ich glaube aus Amerika!“
Als ich ‚Amerika‘ hörte, bin ich die Treppe fast mehr hinunter geflogen als gerannt. In wenigen Sekunden stand ich in der Küche und bekam einen großen dicken Umschlag gereicht.
Ich nahm ihn in die Hand und schaute auf die in großen Druckbuchstaben geschriebene Adresse. Enttäuscht stellte ich fest, dass es nicht Normans Handschrift war. Seufzend drehte ich den Umschlag um und fand den Absender. Es war Jason – ein Brief von Jason. Damit hatte ich überhaupt nicht gerechnet. Von ihm so ein dicker Brief? Selbst beim Fühlen hatte ich keine Ahnung. Trotzdem war ich extrem neugierig, beschloss aber den Brief mit in mein Zimmer zu nehmen und ihn erst dort zu öffnen.
Ich stieg also nach oben, setzte mich an meinen kleinen Schreibtisch und kramte nach dem Brieföffner. Endlich hatte ich das widerspenstige Ding auf und zog den Inhalt heraus.
Je mehr ich zusehen bekam, desto größer wurden meine Augen. Da waren mein Reisepass, meine Fluglizenzen und was ich kaum fassen konnte, alle meine Briefe, die ich in Kabunda an meine Eltern geschrieben hatte.
Ich war so fassungslos, dass ich alles noch einmal in die Hand nahm, den Reisepass durchblätterte, die verschlossenen Briefumschläge zählte und dann war da außer dem Briefpapier noch ein Zettel. Ich drehte ihn um und brauchte eine Weile bis ich begriff was das war. Es war ein Scheck der Citybank of New York über 25.080 Dollar.
Ich zitterte am ganzen Körper, konnte das ganze einfach nicht fassen.
Es dauerte eine ganze Weile bis ich den Briefbogen zur Hand nahm, um ihn zu lesen.
„Lieber Micha,
kennst Du das Gefühl, dass man jemandem schreiben will und muss und bei all dem was geschehen ist nicht weiß wie man anfangen soll?
Mir geht es jetzt so aber ich will und muss es versuchen.
Ich hoffe, dass die Adresse in Deinen Papieren richtig ist und dann siehst Du an meinem Absender, dass ich inzwischen bei meinen Großeltern bin.
Die letzten Tage in Afrika waren ziemlich turbulent. Ich habe natürlich mitgekriegt war passiert war und nach allem was ich inzwischen in Erfahrung bringen konnte ist mir klar geworden warum Du abgehauen bist. Ich hätte wahrscheinlich das gleiche getan und habe die ganze Zeit gehofft, dass alles für Dich gut geht.
Mein Bruder und mein Erzeuger haben fürchterlich gestritten aber ich war ja auch noch da und Du kannst Dir denken gegen wen ich war.
Jedenfalls habe ich nicht locker gelassen, bis ich alles zusammen hatte, was ich Dir mit diesem Brief schicke. Die Papiere gehören Dir, das Geld hast Du Dir wirklich sauer verdient und dann kam der Hammer. Ich meine damit die Briefe. Ich habe sie gefunden – Deine Briefe an Deine Eltern. Sie lagen einfach da, neben Deinen Papieren im Tresor. Es hat mir so wahnsinnig leid getan und bitte glaube mir, ich schäme mich sehr dafür.
Was immer Du auch fühlst und denkst – eines musst Du mir glauben: Norman wusste jedenfalls nicht, dass Deine Briefe nicht abgeschickt worden sind.
Okay Micha, das war’s was ich Dir mitteilen wollte.
Ach ja, noch etwas: Egal was passiert ist. Für mich bist Du ein guter Freund. Die kurze Zeit, die wir zusammen verbracht haben, werde ich wohl nie vergessen. Ich würde mich sehr freuen, wenn Du mir kurz schreiben würdest, dass alles bei Dir angekommen ist.
Alles Gute und herzliche Grüße
Jason
Alle meine Gefühle standen Kopf. Ich las den Brief drei- oder viermal. Zum einen hatte ich nicht damit gerechnet jemals wieder etwas von Jason zu hören und jetzt hatte ich nicht nur einen Brief, sondern auch die Adresse von ihm.
Zum anderen fand ich es großartig wie er sich für mich eingesetzt hatte, um mir all die Sachen zu schicken, die ich in seinem Brief gefunden hatte. Ja Jason war auch für mich ein Freund, den ich nicht vergessen werde.
Allerdings war ich zum Teil erleichtert und zum Teil enttäuscht wegen Norman. Ich war bereit Jason zu glauben, dass sein Bruder nicht wusste was mit meinen Briefen geschehen war. Ich erinnerte mich wie er kurz vor Weihnachten meinen Brief mit nach Lubumbashi nahm und erklärte, die Sekretärin seines Vaters wüsste sicher wie er am schnellsten nach Deutschland kommen könnte. Wahrscheinlich hatte er ihr die Briefe immer gegeben und konnte nicht ahnen was damit geschah.
In diesem Punkt hatte ich ihm in meinen Gedanken Unrecht getan aber das konnte er ja nicht wissen.
Enttäuscht war ich deshalb, weil ich in Jasons Zeilen keinen Hinweis darauf fand, ob Norman nun mit ihm in Amerika war. Warum hatte er nicht selbst geschrieben oder wenigstens einen Gruß ausrichten lassen?
Ich konnte mir kaum vorstellen, dass er von Jasons Brief nichts wusste. Schließlich hatten die Brüder immer ein sehr gutes und vertrauensvolles Verhältnis zueinander.
Irgendwie stieg das Gefühl in mir hoch, dass Norman mich aus seinem Gedächtnis gestrichen hatte und es seinem Bruder überließ was der für richtig hielt. Das tat mir ziemlich weh aber eine andere Erklärung fand ich nicht.
Um mich etwas abzulenken, nahm ich die neun verschollen geglaubten Briefe, ging damit in die Küche und legte sie auf den Tisch.
Meine Mutter schien zu ahnen wie mir zumute war. Sie zog ihre Schürze aus, stellte mir einen großen Pott Kaffee hin und setzte sich zu mir an den Küchentisch.
Ich deutete auf den Stapel und erklärte ihr von wem ich die Post bekommen hatte.
„Ach Micha“, sagte sie. „Glaubst Du es wäre besser gewesen, wenn Du nichts mehr davon gehört hättest?“
„Ich weiß nicht Mam. Jason ist ein lieber Kerl. Ich freue mich, dass er das für mich getan hat.“
Sie legte ihre Hand auf meine. „Aber es reißt bei Dir alte Wunden auf, nicht wahr?“
Ich nickte und nahm einen großen Schluck Kaffee.
Wir hatten nicht viel Zeit zum Reden. Meine beiden Brüder kamen von der Schule und es war Zeit zum Mittagessen.
Anschließend ging ich wieder nach oben. Auf meinem Schreibtisch lag der Scheck. Ich nahm ihn in die Hand und betrachtete ihn. 25.080 Dollar, das war für mich sehr viel Geld aber ich konnte mich nicht so richtig darüber freuen.
Mir kam wieder in den Sinn wie Norman am Tag nach unserer ersten Liebesnacht aus Lubumbashi zurückgekommen war und zu mir sagte: „Ich habe mit meinem Vater ausgehandelt, dass Du für jeden Tag an dem Du fliegst 120 Dollar bekommst.“
Nun hatte ich den Lohn tatsächlich bekommen aber nicht von ihm, sondern von Jason.
Ich konnte das nächste Wochenende kaum abwarten und gleich am Freitagabend ging ich zu Conny und Patrick. Ich hatte ein großes Bedürfnis, mit ihnen über Jasons Brief zu reden. Das taten wir auch ziemlich ausführlich an diesem Abend.
Wir kamen zu dem Ergebnis, dass es das Beste sei, wenn ich bei der Antwort ebenso wenig auf Norman einginge wie es Jason getan hatte. Ich sah ein, dass Conny und Patrick recht hatten. So würde ich Jason nicht in Verlegenheit bringen und mir wahrscheinlich eine weitere schmerzliche Enttäuschung ersparen.
Mit dem Antwortbrief nahm ich mir Zeit bis zum Montag, da ich das Wochenende bei schönem Wetter auf dem Flugplatz verbrachte.
Hallo Jason,
Dein Brief war eine riesige Überraschung, mit der ich ehrlich gesagt nicht gerechnet hatte.
Ich freue mich, dass Du jetzt in Amerika bist. Du hast Dich ja darauf gefreut und ich hoffe, dass es Dir dort gut geht und alles klappt.
Ja, ich betrachte Dich auch als einen guten Freund. Was Du für mich getan und mir geschickt hast, bedeutet mir sehr viel und ich weiß gar nicht wie ich Dir dafür danken soll.
Ich bin gerade dabei, mich wieder an das Leben in Deutschland zu gewöhnen. Es ist nicht so leicht wie ich immer gedacht habe aber jetzt geht es jeden Tag besser.
Ich wünsche Dir alles Gute und viel Erfolg bei Deinem Studium.
Außerdem noch einmal DANKE für alles.
Dein Freund
Micha
Es war ein kurzer Brief aber was sollte ich sonst noch schreiben? Ich wollte ihn auch nicht nötigen wieder zu antworten. Ich hielt es für das beste, den Kontakt nicht weiter künstlich aufrecht erhalten zu wollen und den Brief deshalb für ausreichend.
In den nächsten Tagen wurde ich immer unzufriedener. Überall wo ich hinkam und Freunde oder Bekannte traf, hatten sie entweder ihre Freundin dabei oder sprachen davon. Ich kam mir vor als sei ich der einzige, der solo diese Welt ertragen musste. Selbst Achim, ein etwas jüngerer Fliegerkollege, den ich schon lange vor meiner Afrikareise als meinen heimlichen Traumtypen bewunderte, hatte inzwischen weibliche Begleitung. So ein Mist, dabei wünschte ich mir so sehr einen Freund, den ich so lieb haben konnte wie Norman oder wenigstens so wie die anderen ihre Freundin.
Auch was den Sex anbelangte, litt ich zusehends an Entzugserscheinungen und hatte keine Idee was ich außer einsamer Handarbeit dagegen tun konnte.
Meine einzige Hoffnung war die Großstadt Köln.
Unter dem Vorwand, mich schon mal nach einem Zimmer für mein bevorstehendes Studium umsehen zu wollen, fuhr ich kurzerhand nach Köln. Meinen Eltern erzählte ich, dass ich bei einem Fliegerkollegen übernachten würde, der dort wohnt aber in Wahrheit nahm ich mir ein Hotelzimmer.
Es fiel mir nicht leicht sie zu belügen aber ich konnte ihnen ja schlecht erklären, aus welchen anderen Gründen ich dorthin wollte.
Da ich mich in dieser Zeit in Köln noch nicht gut auskannte, besorgte ich mir im Hauptbahnhof einen Stadtplan und suchte in der Bahnhofsbuchhandlung fieberhaft nach dem einzigen Männermagazin, das es damals öffentlich zu kaufen gab.
So sehr ich auch suchte, ich fand es nicht und dabei hatte ich so gehofft, es wenigstens hier bekommen zu können.
Es kostete mich zwar sehr viel Überwindung aber ich wartete ab bis ich der einzige an der Kasse war und fragte den Verkäufer nach dem Magazin. Der schaute mich kurz an und mit einem Anflug von Lächeln griff er unter die Kassentheke und gab es mir in die Hand.
Ich muss beim Bezahlen wohl leicht rot geworden sein, denn der Verkäufer wünschte mir viel Spaß damit.
Nun suchte ich mir in der Nähe vom Dom ein nicht zu teures Hotel. Offensichtlich war es nicht üblich, dass ein junger Bursche wie ich ein Hotelzimmer mit Frühstück für 85 Mark nahm. Jedenfalls wurde ich von dem älteren Herrn an der Rezeption prüfend angeschaut, musste meinen Ausweis vorlegen und den Zimmerpreis im Voraus bezahlen.
Zuerst prüfte ich das breite Bett, dann blätterte ich in dem Magazin und strich mir zwei oder drei Kontaktanzeigen an. Alle anderen kamen aus den verschiedensten Gründen für mich nicht infrage. Irgendwo fand ich sogar zwei Adressen von Lokalen in Köln, wo sich schwule Männer trafen.
Das war ja schon mal etwas, dachte ich mir um machte mich auf, um in der Fußgängerzone eine neue Jeans, ein paar hübsche T-Shirts, einen Sommerpullover und ein Paar neue Schuhe zu kaufen.
Bei meinem Einkaufsbummel sah ich viele hübsche Jungs aber mehr als unauffällig beobachten konnte und traute ich mich nicht.
Am Abend kleidete ich mich mit den neuen Klamotten ein und machte mich auf den Weg zu einer der beiden Kneipen. Ich ging zu Fuß in Richtung Ebertplatz und war ziemlich gespannt, was mich wohl erwarten würde.
Ich musste ziemlich genau hinschauen, denn der Eingang der Kneipe war ziemlich unscheinbar. Mutig und erwartungsvoll ging ich hinein.
Die Einrichtung war ziemlich dunkel. Links war eine Theke und rechts erstreckte sich der Raum mit Tischen und Stühlen. Es war nicht viel los. An drei oder vier Tischen saßen einige Typen. Soweit ich es erkennen konnte, waren sie alle schon jenseits der Dreißig. Von meiner Altersklasse keine Spur.
Trotz dieser ersten Enttäuschung stellte ich mich an die Theke und bestellte mir ein Glas Tee. Der Typ hinter der Theke, auch so Mitte Dreißig, musterte mich kurz und fragte: „Bist wohl neu hier, oder?“
Ich nickte. „Ja, bin sozusagen auf der Durchreise und wollte mal sehen was hier so los ist.“
Sehr gesprächig war der Typ nicht und so nippte ich an meinem heißen Tee.
Kurz darauf stand ein großer kräftiger Mann an einem der Tische auf und kam zur Theke. Kaum hatte er sich neben mich gestellt, griff seine Hand an meinen Hintern und ließ sie eindeutig zwischen meine Oberschenkel gleiten.
Ich verschluckte mich fast und drehte mich ziemlich heftig von ihm weg.
Er zuckte mit den Schultern. „Na mein Süßer, warum so schreckhaft?“
Ich war wirklich erschreckt und verunsichert dazu. Schließlich nahm ich mich zusammen und sagte: „Ich stehe nicht auf ältere Typen.“
„Na dann eben nicht, “ meinte er und verzog das Gesicht zu einer geringschätzigen Mine.
Ich fühlte mich nun von allen beobachtet und wollte nur noch weg. Hastig trank ich den Tee aus, legte das Geld auf die Theke und verließ fluchtartig das Lokal.
Draußen atmete ich erst einmal kräftig durch. Das war der totale Flop. Entsprechend enttäuscht trat ich den Rückweg an.
Warum musste mir Sowas passieren? Wenn schon niemand in meinem Alter da war, hatte ich wenigstens auf ein nettes Gespräch und ein paar Tipps für Köln gehofft.
Während ich grübelte ob ich jetzt noch die andere Adresse versuchen sollte oder wollte, näherte ich mich über den Breslauer Platz dem Hauptbahnhof. Irgendwie hatte ich mal gehört, dass sich auf dieser Seite des Bahnhofs Jungs herumtreiben, die auf Freier warten.
Der Gedanke lenkte mich ab. Ich hatte zwar nicht vor, selbst als Freier aufzutreten aber man konnte ja mal sehen ob meine Information stimmte und was das für Jungs waren.
Ja tatsächlich, da drückten sich ein paar Typen in der Nähe des Eingangs herum. Ich ging langsam vorbei und blieb etwas abseits stehen, um die Szene einen Moment beobachten zu können.
Nach einer Weile bemerkte ich aber einen Mann, der mich beobachtete und bevor mich noch einmal jemand so plump anmachen konnte, beschloss ich forschen Schrittes in den Bahnhof zu gehen.
Während ich dabei einen Pfeiler umrundete, stieß ich ziemlich unsanft mit jemandem zusammen.
Ich spürte einen Schlag gegen die Stirn und griff nach meiner Nickelbrille, die herunterzufallen drohte. Danach half ich demjenigen auf die Beine, den ich umgerannt hatte. Es war ein Junge, der etwa in meinem Alter oder etwas jünger und ziemlich gleich groß war wie ich. Deshalb hatten sich auch unsere Köpfe in Stirnhöhe getroffen. Er hatte schulterlange braune Haare, trug ein dunkelblaues T-Shirt, etwas speckige Jeans und Turnschuhe.
Während ich mich bei ihm entschuldigte, sah ich, dass er oberhalb der Schläfe blutete. Zum Glück hatte ich ein Taschentuch dabei und reichte es ihm. Er schien ein bisschen benommen und so half ich ihm das Blut abzutupfen, wo ihn meine Brille erwischt hatte.
Getreu meinem Motto ‚kein Schaden ohne Nutzen‘ bestand ich darauf, dass er mit mir ins Hotelzimmer kommen sollte, wo ich ein Pflaster und wenn nötig auch eine Kopfschmerztablette für ihn hätte.
Der Junge nickte und – oh Wunder – er folgte mir.
Da ich den Zimmerschlüssel in meiner Hosentasche hatte, brauchte ich die Rezeption nicht zu bemühen und kam mit meiner Begleitung unbemerkt in den Aufzug.
Im Zimmer angekommen deutete ich auf den Stuhl und ging ins Bad, um ein Handtuch mit warmem Wasser anzufeuchten. Während ich ihm das restliche Blut abwischte stellte ich fest, dass es nur ein harmloser Kratzer war.
„Wie heißt Du überhaupt“, wollte er wissen.
„Ich heiße Micha und Du?“
„Ich heiße Peter. Sag mal, lebst Du immer so feudal?“ Er schaute sich dabei im Zimmer um.
Ich schaute ihn an und er gefiel mir. „Nein“, sagte ich. „Es ist das erste Mal, dass ich ein Hotelzimmer habe und es ist auch nur für eine Nacht.“
Ich hatte eine große Flasche Cola dabei und holte die beiden Zahnputzgläser aus dem Bad.
„Weshalb bist Du denn hier?“ fragte er weiter.
Zuerst wollte ich ihm auch die Nummer mit der Zimmersuche aufbinden aber dann dachte ich, was soll’s. „Also um ehrlich zu sein, ich wollte versuchen nette Jungs zu finden. Ich bin nämlich schwul und auf dem Land passiert da gar nichts.“
Wenn er jetzt die Flucht ergreifen würde, hatte ich das einkalkuliert aber er blieb ruhig sitzen und trank einen Schluck Cola.
„Und? Wie ist es gelaufen?“
Ich erzählte jetzt mein Erlebnis in der Kneipe und Peter grinste, ohne einen Kommentar abzugeben.
Stattdessen fragte er: „Kann ich bei Dir kurz duschen?“
„Klar, kein Problem“, antwortete ich.
Statt im Bad zu verschwinden, was ich jetzt erwartet hatte, stand er auf und zog sich vor meinen Augen vollständig aus.
Ich konnte gar nicht fassen, dass ich jetzt immer mehr von seinem hübschen jugendlichen Körper zusehen bekam.
Schließlich zog er auch seinen Slip aus, richtete sich auf und schaute mich lächelnd an.
Ich war total durcheinander. Da stand plötzlich ein hübscher Junge vor mir, total nackt und lächelt mich an.
„Willst Du mit mir duschen?“ fragte er.
Ich brauchte einen Moment bis ich begriffen hatte was er meinte.
Klar wollte ich und mit einem Kribbeln im ganzen Körper begann ich mich auch auszuziehen.
Wenige Minuten später standen wir gemeinsam in der Duschkabine unter dem warmen Wasserstrahl.
Peter begann mich einzuseifen und brachte damit mein Blut in Wallung. Seine Hände berührten mich so zart an jeder Stelle meines Körpers von oben langsam nach unten.
Als er mein Hinterteil erreichte und dann ganz gefühlvoll meinen Sack und meinen Schwanz einseifte und massierte, musste ich die Augen schließen und stöhnen.
Als es am schönsten war, ging er tiefer in die Hocke und widmete sich meinen Beinen bis zu den Füßen. Noch in der Hocke, spreizte Peter meine Beine ein wenig, fuhr mit dem Gesicht an der Innenseite meiner Oberschenkel nach oben und nahm meine Eier zwischen seine Lippen. Es war unbeschreiblich geil wie jetzt seine Zunge mit meinen Eiern zu spielen begann.
Mein Stöhnen spornte ihn an bis er meinen Schwanz in seinen Mund nahm und die Eichel mit der Zunge umspielte. Das war der Moment, wo ich es nicht mehr zurückhalten konnte und Peter saugte alles was er kriegen konnte auf.
Ich wäre jetzt am liebsten zusammengesackt aber Peter richtete sich auf, umfasste meinen Oberkörper und gab mir einen leidenschaftlichen Kuss.
Jetzt revanchierte ich mich und verwöhnte seinen Körper genauso wie er meinen verwöhnt hatte.
Dabei fiel mir erst so richtig auf, dass er unten total rasiert war. Kein Härchen war da im Weg und das törnte mich zusätzlich an.
Peter genoss meine Behandlung und ich hatte auch keine Mühe, seinen Liebessaft zu bekommen.
Nach gegenseitigem Abtrocknen und Haare föhnen zog ich meine Eroberung auf das Bett, wo wir uns küssten und unsere weichen Körper aneinander rieben und kuschelten.
Wir waren so geil, dass wir noch zweimal gegenseitig unsere Boysahne tauschten und dann erschöpft auf dem Bett lagen.
Nach einer Weile stand Peter wortlos auf und begann sich anzuziehen.
„Willst Du nicht hier schlafen?“ fragte ich enttäuscht.
Er schüttelte den Kopf und sagte: „Tut mir leid aber ich muss noch Geld verdienen.“
„Was, jetzt noch?“ fragte ich erstaunt.
Er nickte und als er sich das T-Shirt in die Hose stopfte, sagte er: „Es war schön mit Dir aber denke dran wo Du mich getroffen hast.“
Erst langsam wurde mir klar, was er damit meinte. Er war also einer von denen, die am Bahnhof auf Freier warteten. Ich wollte es einfach nicht wahrhaben. Peter, dieser hübsche junge Boy geht mit irgendwelchen Männern und…
Ich wollte das gar nicht zu Ende denken.
„Sag mir was Du brauchst, dann kannst Du doch auch bei mir bleiben“, bot ich ihm ganz spontan an.
Peter schaute mich lächelnd an und schüttelte den Kopf. „Nein Micha, Du brauchst dafür nicht zu bezahlen. Du findest bestimmt Deinen Traumboy und einen Stricher hast Du nicht verdient.“
Ich wollte noch etwas sagen aber er legte einen Finger auf meinen Mund und küsste mich auf die Stirn. „Danke für alles und viel Glück.“
Mit diesen Worten stand er auf und verschwand ohne sich umzudrehen aus dem Zimmer.
Ich wollte hinterher aber an der Tür fiel mir ein, dass ich nackt war. So ließ ich mich auf das Bett fallen und meinen Tränen freien Lauf.
Ich bereute den Abend und das was ich erlebt hatte nicht, aber Peter tat mir leid. In meinen Augen war er zu schade für das, was er offensichtlich tat.
In der Nacht konnte ich kaum schlafen. Zum ersten Mal dachte ich darüber nach was es bedeuten musste, sich für andere zu prostituieren.
Mein einziger Trost bestand darin, dass Peter mein Angebot nicht angenommen hatte und mit einem Lächeln gegangen war. Sein Körper war unversehrt und so wie ich ihn erlebt hatte, suchte er keine Hilfe.
Trotzdem konnte ich nicht begreifen, dass er nach diesem Erlebnis mit mir hinaus in die Nacht ging, um irgendeinem anderen für Geld zu Diensten zu sein.
Am Nachmittag des nächsten Tages fuhr ich wieder nach Hause. Am Hauptbahnhof hatte ich mich noch einmal umgeschaut aber um diese Tageszeit war es wohl kein Wunder, dass ich ihn dort nicht sah.
Was ich in Köln erlebt hatte, beschäftigte mich noch einige Tage. Am Wochenende sprach ich mit Patrick und Conny darüber und wieder einmal waren sie mir eine seelische Stütze.
Ich schrieb nun auf die beiden Anzeigen, die ich mir in dem Gay-Magazin angestrichen hatte und wartete eine Woche später jeden Tag ungeduldig auf den Briefträger.
Dann endlich kam ein Brief für mich aber es war kein Brief den ich erwartet hatte, sondern ein Brief von Jason aus Amerika.
Kapitel 8
Als ich den Brief anschaute, war ich zuerst darüber enttäuscht, dass ich noch immer keine Reaktion auf meine Zuschriften erhalten hatte. Dabei hatte ich mir bei den Formulierungen solche Mühe gegeben.
Mit einem Seufzer ging ich in mein Zimmer. Ich war nun doch neugierig, was Jason bewogen hatte, mir noch einmal zu schreiben.
Lieber Micha,
ich bin so froh, dass Dich mein erster Brief erreicht hat und dass Du wieder wohlbehalten zuhause bist.
Ich kann gut verstehen, dass die ersten Tage und Wochen nicht leicht für Dich waren und hoffe, dass es jetzt besser geht.
Mir fällt es auch nicht leicht, mich an mein neues Leben hier zu gewöhnen aber im Unterschied zu Dir muss es erst mein neues Zuhause werden.
Ich vermisse meine Freunde aus dem Internat in Lubumbashi sehr und vielleicht kann ich erst jetzt so richtig verstehen, wie es Dir damals ergangen ist.
Ich denke oft an Dich und die wenigen Tage, die wir gemeinsam verbracht haben.
In den Gesprächen mit meinen Großeltern habe ich erfahren, dass meine Großmutter in Deutschland geboren und aufgewachsen ist. Sie war so alt wie ich heute, als sie mit ihren Eltern nach Amerika ausgewandert ist. Sie hat es mir erzählt, um mir Mut zu machen und ich wollte natürlich vieles von ihr wissen – über Deutschland und so.
Dabei habe ich an Dich gedacht und angefangen sie zu überreden, mir einmal ihre Heimat zu zeigen.
Erst wollte sie überhaupt nicht aber so langsam habe ich meine Großeltern doch rumgekriegt.
Ja und stell Dir vor, im Juli fliege ich mit ihnen nach Deutschland und wir werden in der Stadt Wuerzburg in einem Hotel wohnen.
Ich hoffe, das ist nicht zu weit von Dir weg, denn ich würde Dich so gerne wieder sehen, wenn ich in Deutschland bin.
Was denkst Du? Wird das möglich sein? Hättest Du auch Lust dazu?
Ich freue mich so sehr darauf. Schreib mir doch bitte ob das möglich ist. Du kennst Dein Land doch besser als ich und ich kann die Sprache nicht.
Ich denke seit ein paar Tagen an nichts anderes mehr und warte auf Deine Antwort.
Viele Grüße von Deinem Freund
Jason
Als ich den Brief zu Ende gelesen hatte, musste ich lächeln und schüttelte ungläubig den Kopf.
Dieser Jason, diese beharrliche treue Seele. Könnte ich seine Bitte ausschlagen nachdem, was er für mich getan hatte?
Nein, natürlich nicht. Klar wollte ich ihn wieder sehen. Ich mochte ihn sehr und Würzburg war zwar nicht gerade um die Ecke aber auch nicht aus der Welt.
Ich las den Brief noch einmal und begann instinktiv zu rechnen. Seine Großmutter war also 18 Jahre alt, als sie Deutschland verlassen hat. Wenn sie bei der Geburt von Jasons Mutter und Jasons Mutter bei seiner Geburt so um die 22 Jahre alt gewesen wäre, dann wäre das so etwa 1935 gewesen.
Da ich durch mein vieles Lesen wusste was in dieser Zeit in Deutschland passiert war, konnte ich seiner Großmutter das anfängliche Zögern nicht verdenken. Es lag somit nahe, dass sie zu denen gehörte, deren Eltern, wenn sie denn jüdischer Abstammung waren, rechtzeitig die heraufziehende Gefahr erkannt und sich in Sicherheit gebracht hatten.
Ich weiß nicht warum mir diese Gedanken kamen aber ich hatte unlängst einen Bericht über dieses Thema gelesen.
Ohne aber den Faden weiterzuspinnen, fiel mir in diesem Zusammenhang auf, dass Jason seinen Bruder wieder mit keinem Wort erwähnte.
Was war mit ihm? Die Frage quälte mich fast. War er überhaupt noch in Amerika oder war er womöglich doch oder wieder in Zaire?
Ich ertappte mich, dass meine Gedanken wieder auf ihn kamen und im Stillen hoffte ich bei einem Treffen mit Jason näheres zu erfahren. Ich zwang mich, bis dahin zu warten.
Noch am gleichen Tag schrieb ich ihm zurück:
Lieber Jason,
Dein Brief hat mich überrascht aber ich freue mich sehr auf Deinen Besuch in Deutschland.
Klar will ich Dich treffen. Ich hätte keine ruhige Minute wenn ich wüsste, dass Du ganz in der Nähe bist und ich Dich nicht sehen und sprechen kann.
Bitte schreibe mir wann und in welchem Hotel Du bist. Ich werde kommen und wenn es geht, werde ich Dir meine Heimat zeigen.
Hoffentlich ist Eure Zeit nicht zu knapp. Mein Studium fängt ja erst im August an und deshalb ist es kein Problem für mich.
Ich freue mich sehr, Dich zu sehen.
Bis bald, Dein Freund
Micha
Als ich den Umschlag zugeklebt hatte, saß ich an meinem kleinen Schreibtisch und begann zu träumen. Ich sah Jason ganz deutlich wie wir auf der Farm gemeinsam im Swimmingpool herumtobten, wie wir im Camp hinter der Unterkunft auf dem trockenen Gras lagen und wie wir in der Silvesternacht auf dem Hügel das neue Jahr begrüßt hatten.
Ich sah neben ihm aber auch bald Norman und erhob mich mit einem tiefen Seufzer, um den Brief zur Post zu bringen.
Zwei Tage später bekam ich einen Brief, den ich auf meine Anzeigenzuschrift erwartet hatte.
Der Absender hieß Martin, war 23 Jahre alt und wohnte in der Nähe von Wuppertal. Er schrieb nur kurz, dass er mich gerne kennen lernen würde und hatte seine Telefonnummer beigefügt.
Irgendwie war ich aufgeregt, denn ich wollte die Chance nutzen und ihn am Abend anrufen.
Damit ich das nicht zuhause im Flur tun musste, womöglich vor den Ohren meiner Eltern oder Brüder, ging ich zu Conny.
Als ich ihr den Grund meines Besuches erklärt hatte, drückte sie mir lächelnd das Telefon in die Hand und sagte: „Nimm es mit ins Wohnzimmer. Ich bin in der Küche und bügele.“
Nun saß ich allein im Zimmer, hatte das Telefon auf dem Schoß und kramte den Zettel mit der Nummer aus meiner Hosentasche.
Ich zögerte noch eine Weile und wählte schließlich die Nummer.
Nach vier oder fünf Freizeichen meldete sich eine angenehm klingende Stimme. Es war Martin.
Ich war ein bisschen gehemmt aber Martin redete und lud mich auf der Stelle ein, am Samstag gegen Abend zu ihm zu kommen. Er beschrieb mir den Weg und dann war das Gespräch auch schon zu Ende.
Ein bisschen erleichtert trug ich das Telefon zurück in den Flur und ging in die Küche.
„Na, hat es geklappt?“ wollte Conny wissen.
Ich nickte. „Ja, wir haben uns am Samstagabend bei ihm verabredet.“
Nach einer kurzen Unterhaltung bot mir Conny sogar ihr Auto an, damit ich nicht umständlich mit dem Zug fahren musste. Am Samstagabend würde sie es sowieso nicht brauchen und am Sonntag würde sie Patrick mit seinem Wagen zum Flugplatz fahren und da könnte ich ihm ja ihren Wagen zurückgeben.
Ich war ja so dankbar, dass mein bester Freund eine so liebe Freundin hatte und gab ihr zum Abschied einen Kuss auf die Wange.
Ich fuhr also am Samstag wie verabredet hin und am Sonntag gegen Mittag zurück.
Am Flugplatz traf ich Patrick und wir verzogen uns mit einem Kaffee in eine stille Ecke.
Er schaute mich an. „Du siehst ein bisschen müde aus. Ist das ein gutes Zeichen?“
Ich musste lächeln, denn ich sah ihm an, dass er vor Neugierde zu platzen drohte.
„Also erst hat er mich in eine Disco geschleift und mit allen möglichen Kumpels gequatscht und als wir dann ziemlich spät in seine Wohnung kamen, hat er mich total ausgepowert.“
Patrick schaute ungläubig. „Ausgepowert? Du meinst im Bett?“
Ich nickte. „Ja, was dachtest Du denn. Der hatte alles drauf. Mir tut jetzt noch der Hintern weh.“
Patrick räusperte sich. „Ja, äh, so genau will ich es nun auch wieder nicht wissen. Aber erzähl mal. Ist er hübsch? Wollt ihr Euch wieder treffen?“
„Hmm“, begann ich, „er ist etwas kleiner als ich, sieht nicht schlecht aus aber ich glaube wir passen nicht zusammen. Nur Sex und dumme Sprüche, das reicht mir nicht. Ich will einen Freund, den ich lieb haben kann und der mich lieb hat – verstehst Du?“
„Ja“, sagte Patrick mit einem Seufzer. „Was anderes hast Du auch nicht verdient. Bist Du jetzt enttäuscht?“
Ich schüttelte den Kopf. „Nein, bin ich nicht. War ja einen Versuch wert und ich müsste lügen, wenn ich in seinem Bett nicht auch meinen Spaß gehabt hätte.“
Jetzt grinste Patrick. „Ach Micha. Gut, dass Du es so siehst. Du findest bestimmt noch Deinen Traumprinzen.“
Am Nachmittag absolvierte ich einige Rundflüge mit Leuten, die zum ersten Mal in einem Flugzeug saßen. Es machte mir immer Spaß, solchen Leuten die Faszination des Fliegens zu zeigen. Ihnen die Augen dafür zu öffnen, dass dieser Blick auf die Landschaft etwas Besonderes ist, woran man noch lange denken kann. Das und nicht etwa abrupte Flugmanöver, mit denen man seine vermeintlichen Flugkünste unter Beweis stellen will, war mein Rezept, um die Leute vom Fliegen zu begeistern.
Es dauerte noch zehn Tage, bis ich einen weiteren Brief von Jason bekam.
Hallo Micha,
danke für Deinen Brief. Du glaubst gar nicht wie sehr ich mich auf diese Reise freue und vor allem Dich dabei wieder zu sehen.
In der nächsten Woche ist es schon so weit und am 5. Juli kommen wir in Wuerzburg an. Wir werden im Hotel Bayerischer Hof wohnen.
Rufe doch einfach da an und hinterlasse eine Nachricht für mich wann Du kommst. Ich werde dann am Eingang auf Dich warten.
Du bist auch eingeladen dort zu übernachten, damit wir ein bisschen Zeit füreinander haben.
Ich kann es schon kaum erwarten und bin ziemlich aufgeregt.
Bis bald. Dein Freund
Jason
Also noch zehn Tage, dachte ich mir und spürte auch schon ein angenehm aufregendes Gefühl.
Ich stellte mir vor, eine Nacht in Würzburg zu bleiben und mit Jason vielleicht am nächsten Tag zu mir nach Hause zu fahren. Ich wollte ihm gerne meine Familie, meinen Flugplatz und natürlich Patrick und Conny vorstellen. Ich wusste zwar nicht wie lange seine Großeltern die Reise geplant hatten aber ein Wochenende würden sie ihn hoffentlich entbehren können.
Ich sprach mit meinen Eltern darüber und sie hatten nichts dagegen, dass ich Jason zu uns einladen würde. Ganz im Gegenteil. Sie waren sogar neugierig, den Jungen kennen zu lernen, von dem ich so viel Gutes erzählt hatte.
In den nächsten Tagen dachte ich oft an das bevorstehende Treffen und an den inzwischen achtzehnjährigen Sonnyboy.
Ich ertappte mich sogar dabei, dass ich dachte, wenn schon nicht Norman, dann wenigstens er. Ja, um ehrlich zu sein, Jason war einer, in den ich mich sofort hätte verlieben können. Aber dann zwang ich mich auch gleich den Gedanken fallen zu lassen. Nach allem was ich von ihm wusste, war er nicht schwul und außerdem lebte er auf einem anderen Kontinent. Ich musste also vernünftig sein um mir eine weitere schmerzhafte Enttäuschung zu ersparen und ihn wenigstens als guten Freund in Erinnerung behalten zu können.
Langsam rückte der Tag näher. Ich hatte bis dahin noch ein paar Flüge mit Werbebannern einer Möbelhauskette zu erledigen. Das war immer ziemlich anstrengend aber anstrengende Flüge war ich ja zur Genüge gewohnt.
Am Donnerstagmorgen stieg ich an unserem Dorfbahnhof in einen Schienenbus und wurde bei der Fahrt an die Zeiten erinnert, wo ich mit diesem Zug jeden Morgen zur Schule gefahren bin. Einige Schüler kannte ich natürlich und sie fragten mich, ob ich noch mal die Schulbank mit ihnen drücken wollte.
Als ich noch zu ihnen gehörte, hätte ich mit Sicherheit nein gesagt aber heute war ich mir nicht so sicher. Ich sagte trotzdem nein. Studieren könnte ja auch ganz schön werden, hoffte ich wenigstens.
Ich fuhr diesmal einige Stationen weiter und stieg dort in einen Schnellzug um, der über Würzburg nach München fuhr.
In einem der damals üblichen Abteilwagen machte ich es mir gemütlich und kam kurz nach Mittag in Würzburg an.
Laut Stadtplan war es nicht weit zum Hotel und ich machte mich auf den Weg. Kurz bevor ich das Hotel erreichte, kam mir Jason bereits entgegen gelaufen.
Ich erkannte ihn sofort. Er trug die damals noch typisch amerikanischen Chucks von Converse, Jeans, ein buntes T-Shirt und sein unwiderstehliches Lächeln im Gesicht.
Bei seiner stürmischen Umarmung wäre ich beinahe umgefallen. Sie war jedenfalls heftiger als ich erwartet hatte.
Nach dieser herzlichen Begrüßung gingen wir in die Halle des Hotels und setzten uns auf eine Sitzgruppe mit Tisch. Jason orderte Tee für uns beide und begann zu erzählen.
Wir redeten über eine Stunde und irgendwann musste und wollte ich etwas über Norman erfahren.
Jasons Augen blickten etwas verlegen. „Ja, äh – ich weiß noch jemanden, der dringend etwas wissen will aber das könnt Ihr euch ja auch selber sagen.“
Ich schaute ihn fragend an, weil ich das nicht begriffen hatte.
Jason schaute zum Boden wie ein kleiner Junge, der etwas angestellt hat und sagte: „Bitte Micha. Tue mir den Gefallen und spreche wenigstens mit ihm.“ Dann deutete er in die Mitte der Halle.
Ich schaute mich um und da traf mich fast der Schlag. Dort in der Hotelhalle stand NORMAN!
Ich hatte keine Ahnung wie lange er schon dort stand und ich bekam Gänsehaut, feuchte Augen und weiche Knie, alles auf einmal.
Ich ahnte, dass er auf eine Reaktion von mir wartete und stand langsam auf, um mit wackeligen Schritten auf ihn zuzugehen. Jetzt kam auch er auf mich zu und auf halbem Weg standen wir uns gegenüber.
„Hallo Micha“, sagte er leise. Ich konnte nichts sagen und wir umarmten uns innig und fest. Mir rollten die Tränen aus den Augen und es war mir völlig egal was die anderen Leute in der Halle von uns dachten.
Langsam lösten wir uns aus der Umarmung und Jason geleitete uns an den abgelegenen Tisch. Er hatte noch zwei Portionen Tee für uns bestellt und ließ uns dann allein.
Eine Weile herrschte Schweigen. Ich konnte noch immer nichts sagen. Wir schauten uns einfach nur an.
Dann fragte Norman: „Wie geht es Dir?“
„Ganz gut“, antwortete ich. „Und Dir?“
„Besser“, meinte er. „Vorhin hatte ich noch Angst. Angst, dass Du mich hassen würdest und mich stehen lässt.“
Ich wollte, dass er weiterredet und schwieg deshalb.
Er senkte den Kopf. „Ich habe das alles nicht gewollt. Ich habe damals nicht mit Dir über meine Probleme mit meinem Vater geredet. Das war mein größter Fehler aber ich habe ihn erst bemerkt, als es schon zu spät war.“
Norman sprach leise und saß da wie ein reuiger Sünder.
Ich holte tief Luft. „Bist Du extra deswegen mitgekommen, um mir das zu sagen? Warum hast Du mir nicht geschrieben?“
Er schüttelte leicht den Kopf. „Es ist noch etwas. Können wir nach draußen gehen?“
„Ja“, sagte ich und fragte mich was er wohl meinte.
Wir gingen ein Stück zum alten Hafen am Main und setzten uns auf eine Mauer.
Er senkte wieder den Kopf und sagte: „Ich bereue noch etwas. Ich habe Dir nicht gesagt wie sehr ich Dich liebe.“
Das war jetzt wie ein elektrischer Schlag für mich. Da ich nicht wusste was ich sagen soll, fuhr er fort: „Ich habe es erst begriffen als ich Deinen Abschiedsbrief gelesen habe. Ich war schon die ganze Zeit in Dich verliebt aber so richtig gefühlt habe ich es erst als ich gelesen hatte was Du mir da geschrieben hast.“
Norman wartete jetzt auf eine Reaktion von mir. Ich ergriff seine Hand und spürte wie er sie dankbar an meine drückte.
Es war ein Gefühl, als fließen Ströme der Verständigung von einem zum anderen.
Mir standen wieder Tränen in den Augen. „Es war so schwer abzuhauen. Ich habe Dich mehr vermisst als alles andere. Jeden Tag hast Du mir gefehlt. Selbst in Nairobi, als ich das mit den Briefen erfahren hatte. Ich konnte es einfach nicht glauben.“
Norman sprang nun von der Mauer, zog mich mit sich, drückte meinen Kopf an seine kräftige Brust und flüsterte: „Ich wusste es ja auch nicht aber ich befürchtete, dass Du mich dafür hassen würdest. Das ist auch der Grund warum ich mich nicht getraut habe, Dir zu schreiben. Ich habe mich geschämt und mir Vorwürfe gemacht.“
Ich hielt mich eine Weile an ihm fest. Ich glaube wir mussten jetzt beide erst einmal unsere Gedanken und Gefühle in den Griff kriegen.
Etwas später schlenderten wir am Ufer des Mains entlang und ich stellte ihm die Frage, die mich in Kabunda so lange beschäftigt und schließlich zur Flucht bewogen hatte.
„Norman bitte sag mir was passiert wäre, wenn ich nicht abgehauen wäre. Dann wäre ich doch heute noch dort, oder?“
Norman blieb stehen. „Micha ich weiß jetzt, dass Du das befürchtet hattest. Es stimmt auch, dass mein Vater Dich noch nicht weglassen wollte. Ich hatte deswegen ziemlichen Streit mit ihm aber ich habe Dir deshalb nichts gesagt, weil ich Dir keine Angst machen wollte. Ich wusste ja nicht, dass Du den geplanten Zeitpunkt kanntest, zu dem Jason und ich nach Amerika fliegen wollten. Ich habe bis zuletzt nach einer Lösung gesucht aber eins war mir die ganze Zeit klar. Ich hätte Dich niemals alleine in Kabunda zurückgelassen.“
Ich holte tief Luft. „Ist das wirklich wahr Norman?“
Er nickte. „Du kannst Jason fragen. Ich hatte ihn schon darauf vorbereitet, dass sich unsere Abreise vielleicht verschieben würde oder dass er schon mal alleine zu unseren Großeltern fliegen sollte aber am gleichen Abend kam ich zurück und fand nur noch Deinen Abschiedsbrief.“
Jetzt zog Norman den kleinen Teddy aus seiner Hosentasche und zeigte ihn mir. „Schau, den habe ich seitdem immer bei mir.“
Bei Anblick des kleinen Teddys war ich ziemlich gerührt und ich fragte mich warum das alles so blöd gelaufen war.
„Da haben wir ja wohl beide ziemlichen Mist gemacht“, stellte ich fest.
„Ja das haben wir“, meinte Norman. „Und ich ganz besonders. Lass uns versprechen, dass wir in Zukunft über alles reden, okay?“
Ich nahm seine Hand und schaute ihn an. „In Zukunft? Was ist unsere Zukunft Norman? Wir lieben uns aber Du in Amerika und ich in Deutschland – das halte ich nicht aus.“
Er lächelte. „Ich auch nicht. Ich will, dass wir zusammen sind – wir beide Du und ich.“
Warum macht er es uns so schwer, dachte ich und ließ den Kopf hängen.
Norman nahm meinen Kopf ganz sanft zwischen seine Hände und hob ihn soweit an, dass er mir in die Augen sehen konnte und fragte: „Hast Du immer noch vor in Köln zu studieren?“
„Ja“, antwortete ich.
Norman lächelte nun wieder. „Dann habe ich es auch vor.“
„Wie? Was hast Du vor?“ fragte ich ungläubig.
Sein Blick bekam etwas Schelmisches. „In Köln studieren. Ich habe über die Botschaft gefragt und es würde gehen.“
Mein Herz begann heftig zu klopfen. „Bitte Norman, mach keine Witze.“
Er schüttelte den Kopf. „Ich mache keine Witze. Ich dachte wir beide in der gleichen Stadt, in der gleichen Uni, in der gleichen Wohnung und im gleichen Bett. Ich will da sein wo Du bist.“
Jetzt ließ er mein Gesicht los und ging einen Schritt zurück. Für mich war das alles zu viel. Meine Gefühle fuhren mit mir Achterbahn und ich musste mich erst mal setzen.
Norman ließ mich nicht aus den Augen. Ich spürte die Spannung in ihm, die man nur hat, wenn man auf eine ehrliche Frage eine ehrliche Antwort erwartet.
Ich kniff kurz die Augen zu. Dann sagte ich: „Komm her Norman, kneif mich mal und sag mir, dass das alles kein Traum ist.“
Jetzt lachte Norman, sprang neben mich auf die Mauer, fasste meine Schultern und gab mir einen Kuss auf den Mund. „Micha, willst Du, dass ich bei Dir bleibe?“
Ich sprang jetzt von der Mauer, stellte mich mit ausgebreiteten Armen auf die Promenade und rief: „Ja ich will es!“
Sofort war Norman bei mir. Wir umarmten uns, er wirbelte mich herum, setzte mich wieder ab und gab mir einen langen Kuss.
Die irritierten Blicke einiger Passanten störten uns nicht.
Dann schlug Norman vor zurück zum Hotel zu gehen. Obwohl es nicht nötig war beeilten wir uns. Wir wollten uns nahe sein, je eher desto besser.
Kaum waren wir in Normans Zimmer angekommen, verschmolzen unsere Körper zu einem nicht enden wollenden Kuss. Hastig und voller Begierde zerrten wir uns gegenseitig die Kleidung vom Leib und warfen uns auf das große Doppelbett.
Wie lange hatte ich das vermisst. Normans Duft, die weiche Haut seines starken Körpers, seine Leidenschaft und seine Zärtlichkeit.
Gegen Abend knabberte ich an Normans Ohr. „Was meinst Du? Sollen wir mal nach Jason sehen? Er will sicher wissen was mit uns los ist.“
Norman hob mich auf sich. „Ja, Du hast recht. Wir sollten ihn nicht zu lange warten lassen.“
Langsam zogen wir uns wieder an und gingen zum Zimmer gegenüber.
„Ah, darf ich annehmen, dass es ein gutes Zeichen ist, Euch beide gleichzeitig zu sehen?“ fragte er und deutete uns hereinzukommen.
Norman nahm mich demonstrativ in den Arm und berichtete seinem Bruder, dass zwischen ihm und mir alles in Ordnung wäre.
„Waauu“, gab Jason von sich. „Das muss ja groß gefeiert werden. Ich hab vorsorglich schon einen Tisch im Restaurant bestellt.“
„Kann ich dabei mal Eure Großeltern kennen lernen?“ fragte ich.
Jason räusperte sich und setzte seinen Hundeblick auf.
Als ich ihn so sah, ahnte ich schon etwas.
Jason zog mich auf den zweiten Stuhl an dem kleinen Hotelzimmertisch und schaute mich mit diesem Blick an. „Bitte verzeih mir meine kleine Notlüge Micha.“
„Willst Du damit sagen, dass Eure Großeltern gar nicht hier sind?“ fragte ich ungläubig und versuchte meinem Blick etwas Strafendes zu geben.
Jason nickte. „Ach bitte versteh doch. Mein großer Bruder war total krank vor Liebeskummer und traute sich nichts zu tun. Mir blieb doch nichts anderes übrig als irgendetwas zu erfinden, damit ich Euch wieder zusammenbringe.“
Ich musste innerlich grinsen.
„Na warte“, sagte ich und stand auf, um den überraschten Jason zu packen und auf sein Bett zu legen.
„Du hast mich ja ganz schön reingelegt“, erklärte ich mein Tun und begann ihn ordentlich durchzukitzeln.
Jason wand sich und strampelte aber ich hielt ihn mit einer Hand fest und bearbeitete seine Rippen. Er lachte und jaulte bis ihm die Tränen in den Augen standen. Dann beugte ich mich über ihn, gab ihm einen Kuss auf die Wange und sagte: „Danke Jason. Du bist nicht nur ein guter Freund, sondern auch der liebste Schwager, den ich mir wünschen kann.“
Jetzt lachte er wieder und Norman tat ziemlich erleichtert weil er nicht wusste, ob er bei meiner Attacke gegen seinen Bruder eingreifen sollte oder nicht.
Kurze Zeit später gingen wir gemeinsam ins Hotelrestaurant und gönnten uns ein fürstliches Abendessen, das wir mit gutem Rotwein und ausgelassener Stimmung genossen.
Jeder von uns dreien war auf seine Weise erleichtert und glücklich. Jason hatte geschafft, was ich nicht einmal zu hoffen gewagt hatte.
Während des Essens warfen sich Norman und ich immer wieder verliebte Blicke zu, berührten uns kurz mit den Knien und manchmal auch mit den Händen.
Jason entging das natürlich nicht und er grinste jedes Mal ziemlich unverschämt über den Tisch.
Beim Dessert begannen wir ausgelassen über die gemeinsamen Erlebnisse in Kabunda und auf der Farm zu erzählen. Es waren schöne Erinnerungen und hoffentlich ein guter Start für die Zukunft.
Wir beschlossen am nächsten Tag gemeinsam zu mir nach Hause zu fahren, das Wochenende dort zu verbringen und anschließend in Köln nach der kleinen Wohnung zu sehen, die ich bereits in Aussicht hatte.
Noch am gleichen Abend rief ich zuhause an, damit sich meine überraschten Eltern schon mal auf meine beiden Gäste einstellen konnten.
Es war ein traumhaft schöner Abend und ich konnte noch immer nicht so recht begreifen, dass der heutige Nachmittag mein Leben nach Kabunda völlig verändern würde.
Jason hatte wohl nicht ohne Grund dafür gesorgt, dass sein Bruder ein Doppelzimmer hatte. Das ging mir kurz durch den Kopf, als ich mit Norman zusammen unter die Bettdecke schlüpfte.
Wie lange hatte ich mich danach gesehnt diesen Körper, die weiche Haut, den Duft und die Zärtlichkeit zu spüren. Jetzt war der Traum in Erfüllung gegangen und ich war plötzlich der glücklichste Mensch auf dieser Erde.
Am nächsten Morgen machten wir uns nach dem Frühstück auf den Weg zum Hauptbahnhof. Die Sonne strahlte uns an, was einen schönen Sommertag versprach.
Im Schnellzug bekamen wir ein Abteil für uns alleine. Ich erzählte den beiden was ich über die vorbeiziehende Landschaft wusste und beantwortete die vielen Fragen, die sie mir über Deutschland stellten.
Am Nachmittag kamen wir in meinem Heimatort an. Norman war ganz begeistert von dem winzigen Bahnhof, dessen einziger Bediensteter mich natürlich kannte und beim Aussteigen begrüßte.
Den halben Kilometer bis zu unserem Haus gingen wir zu Fuß. Dabei konnte ich ihnen das kleine Dorf zeigen.
Zuhause erwartete uns bereits die ganze Familie. Mein Vater hatte extra früher Feierabend gemacht und darüber freute ich mich.
Bei der Begrüßung war meine Familie noch etwas unsicher. Das lag auch daran, dass meine Eltern als Kriegskinder keine Gelegenheit gehabt hatten Englisch zu lernen. Ich gab mir aber alle Mühe zu übersetzen und der Charme, den die beiden ausstrahlten sorgte dafür, dass sich die Situation sehr bald lockerte.
Meine Mutter hatte einen Kuchen gebacken und lotste uns zum Kaffeetrinken in die gute Stube.
Ich ermunterte meine Brüder die Gelegenheit zu ergreifen und ihr Schulenglisch anzuwenden, was sie nach anfänglichem Zögern auch taten.
Jason ergriff sofort die Initiative und befasste sich mit ihnen, während Norman und ich mit meinen Eltern ins Gespräch kamen.
Nach der ersten Runde des Kennenlernens organisierten wir die Unterbringung. Da wir kein Gästezimmer hatten, quartierte ich Jason in meinem Zimmern ein. Norman und ich zogen in unser Gartenhaus. Dort stand ein Sofa, welches sich in eine doppelte Schlafgelegenheit verwandeln ließ.
Das taten wir gemeinsam und Norman bestand auf einem gemeinsamen Probeliegen. Beim Liegen blieb es jedoch nicht. Erst grinsten wir uns zufrieden an, dann folgte ein leidenschaftliches Geknutsche bis wir ein leichtes Räuspern hörten.
Es war meine Mutter, die uns Bettzeug brachte. Wir sind wohl beide ein bisschen rot geworden aber sie lächelte nur und ging zurück ins Haus.
Am Abend wurde vor dem Haus gegrillt. Mein Vater bestand darauf, dass die beiden Amerikaner gutes deutsches Bier kennen lernen sollten.
Er wurde ganz lustig und wir hatten einen leichten Schwips, als wir gegen Mitternacht den Weg in die Betten fanden.
„Du hast eine nette Familie“, sagte Norman, als er mich an sich zog und streichelte.
Ich fand das auch und ich war sehr stolz, dass sie Norman und Jason so herzlich aufgenommen haben.
Es war nun Samstag. Mein Vater lieh mir sein Auto und ich zeigte den beiden die Gegend und die nächstgelegene Kleinstadt. Am Nachmittag kamen wir auch zum Flugplatz und ich nutzte die Gelegenheit, ihnen die Landschaft mal von oben zu zeigen. Ich flog nach Koblenz, dann am Rhein entlang bis Köln und wieder zurück. Sie waren ganz beeindruckt wie viel es dabei zu sehen gab.
Nach der Landung trafen wir auch Patrick. Der war total überrascht, wen ich ihm da vorstellte. Bei einem Kaffee erzählte ich ihm von meiner Überraschung in Würzburg und ich sah ihm an, dass er sich mit mir freute.
„Kommt doch heute Abend zu uns“, schlug Patrick vor. „Ich rufe Conny an. Das muss doch gefeiert werden.“
Norman schaute mich fragend an. Ich übersetzte ihm die Einladung und er nickte lächelnd.
Conny begrüßte uns gut gelaunt, als wir später zu dritt vor der Tür standen. Sie zwinkerte mir zu und bat uns herein.
Sie hatte zum Abendessen Kartoffelsalat und Frikadellen gemacht. Patrick holte eine Flasche Rotwein und setzte sich zu uns auf die Terrasse.
Die Unterhaltung war einfacher für mich, da Conny und Patrick ganz gut englisch sprachen. Ohne dass es meine Absicht war, ging es bei dem Gespräch hauptsächlich um Norman und mich. Conny und Patrick fanden es ganz toll, dass wir beide in Köln studieren und zusammen wohnen wollten.
Nach dem Essen waren Norman und ich zum Zuhören verurteilt. Conny und Patrick erzählten Jason von meinem Liebeskummer nachdem ich aus Afrika zurückgekehrt war. Jason tat das gleiche und erklärte seine Bemühungen, wie er seinen großen Bruder von dieser ‚Krankheit‘ befreien wollte.
Norman und ich ließen sie reden und kuschelten uns in die Ecke der Sitzbank. Ich saß fast auf seinem Schoß und wir hielten uns gegenseitig fest. Dabei schaute er mir so verliebt in die Augen, dass ich mich nicht mehr beherrschen konnte und ihm einen Kuss gab.
„Guckt mal, die beiden Turteltäubchen. Sind sie nicht süß?“ meinte Conny. Jason und Patrick drehten sich zu uns um und grinsten. Ich nahm meinen Liebsten aber noch fester in den Arm und sagte: „Jetzt wisst Ihr wenigstens warum wir so gelitten haben.“
Jason wandte sich wieder an seine Gesprächspartner. „Ich bin froh, dass es geklappt hat. Ich mag sie beide sehr. Nur schade, dass ich sie bald kaum noch sehen kann.“
„Willst Du nicht auch in Deutschland studieren?“ fragte Patrick.
Jason schüttelte den Kopf. „Wenn ich hier verliebt wäre, vielleicht aber ich bin ja in Amerika nicht alleine.“
Nach einem ruhig verlebten Sonntag fuhr ich mit Norman und Jason am Montag nach Köln. Zuerst erkundeten wir ein bisschen die Stadt. Am Nachmittag schauten wir uns kurz die Uni an und um 16 Uhr hatte ich mich mit dem Vermieter der Wohnung verabredet.
Es war ein typisches Stadthaus, nur etwa zehn Minuten vom Hauptbahnhof entfernt. Die Wohnung befand sich im obersten Stock und war etwa 50 Quadratmeter groß. Ein winziger Flur, ein Wohn- und ein Schlafraum, eine kleine Küche und ein Bad mit Dusche und WC. Ein Teil der Möbel gehörte zur Wohnung und das war mir eigentlich ganz recht.
Norman schien sie ganz gut zu gefallen. Ich musste dem Vermieter nun aber klarmachen, dass wir zu zweit einziehen wollten.
Als ich merkte, dass er davon nicht so begeistert war, versuchte ich ihm zu erklären, dass es sich um eine kleine Wohngemeinschaft handeln würde, weil Norman noch kein Deutsch könnte und ich ihm in dem fremden Land zu Seite stehen wolle.
Schließlich willigte der Vermieter ein, verlangte dafür aber 50 Mark mehr Miete. Damit er es sich nicht noch einmal anders überlegen konnte, unterschrieben wir gleich den Mietvertrag ab 1. August und bekamen die Zusicherung, dass wir eine Woche vorher mit dem Einrichten beginnen konnten.
Auf dem Rückweg zu meinem Heimatdorf beschlossen wir ein neues Bett und einen neuen Kleiderschrank zu kaufen. Alles andere konnten wir so lassen wie es war.
Am Abend sagte Norman, dass er am Freitag mit Jason zurück nach Amerika fliegen wolle, um ein paar persönliche Sachen zu packen und mitzubringen.
„Willst Du nicht mitkommen?“ fragte er mich.
Die Frage schmerzte mich. Ich hatte noch zwei Aufträge für Werbeflüge. Außerdem war in der nächsten Woche meine erste Sendung im Radio geplant und ich hatte mich schon so sehr auf die Fortsetzung dieses Jobs gefreut.
Norman war sehr enttäuscht, als ich ihm das erklärte. Es tat mir ja auch so leid, noch einmal von ihm getrennt zu sein.
Nach einigen Überlegungen einigten wir uns, dass er nach spätestens einer Woche wieder zurück sei und ich keine neuen Aufträge für Flüge mehr annehmen würde.
Die verbleibenden Tage nutzten wir zum Aussuchen von Bett und Schrank. Außerdem kaufte ich für uns einen günstigen kleinen Gebrauchtwagen, um bei der zukünftigen Fahrerei etwas unabhängiger zu sein.
Am Freitag brachte ich die beiden standesgemäß mit dem kleinen Flugzeug meines Vereins zum Flughafen Frankfurt.
Ich bedankte mich noch einmal bei Jason, wünschte ihm viel Glück und wir versprachen uns in den nächsten Semesterferien wieder zu sehen. Dann verabschiedete ich mich von Norman und bat ihn sich zu beeilen.
Er umarmte mich. „Ich komme so schnell ich kann. Ich liebe Dich und vermisse Dich jeden Tag.“
Ja, das ging mir genauso.
Nun flog ich allein zurück und erledigte in den Tagen alles was noch zu erledigen war. Norman und ich telefonierten jeden Tag. Zwar nur kurz, denn Telefonate mit Amerika waren damals sündhaft teuer aber wir wollten wenigstens einmal am Tag die Stimme des anderen hören.
Als er mir sagte, dass er am nächsten Freitag wieder gen Deutschland fliegen würde, war ich sehr glücklich. Am Tag zuvor hatte ich meine erste zweistündige Sendung im Radio und es klappte wieder so gut wie vor etwas mehr als einem Jahr.
Als ich am Samstagmorgen aufwachte, lag ich mit Norman eng umschlungen in meinem Bett. Wir hatten seit seiner Ankunft nicht viel Zeit für uns. Durch den Zeitunterschied und den anstrengenden Flug war Norman sehr müde und wir sind deshalb früh ins Bett gegangen. Jetzt schlief er noch friedlich in meinen Armen und ich wollte ihn nicht aufwecken. Ich war sehr glücklich. Er war bei mir und dieses Gefühl war einfach unbeschreiblich.
Ende
Wenn Dir der Beitrag gefallen hat, klicke auf das Herz um ein Like dazulassen

Autor: Kabundaboy
Geschlecht: männlichGastautor
weitere Geschichten:
Kontaktiere den Autor Kabundaboy direkt für Feedback: